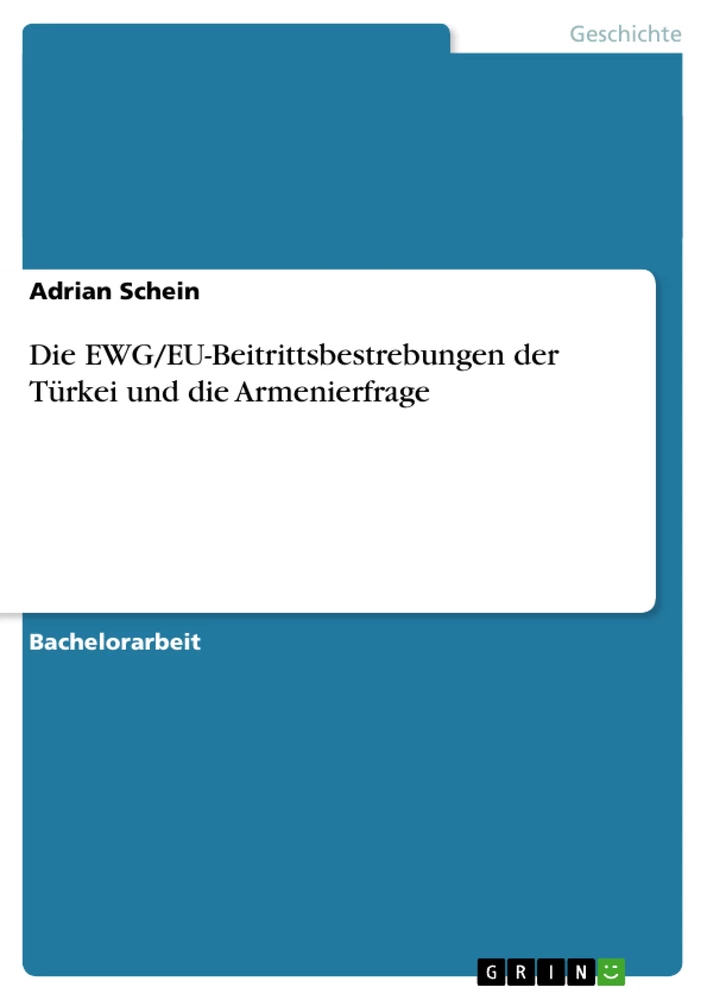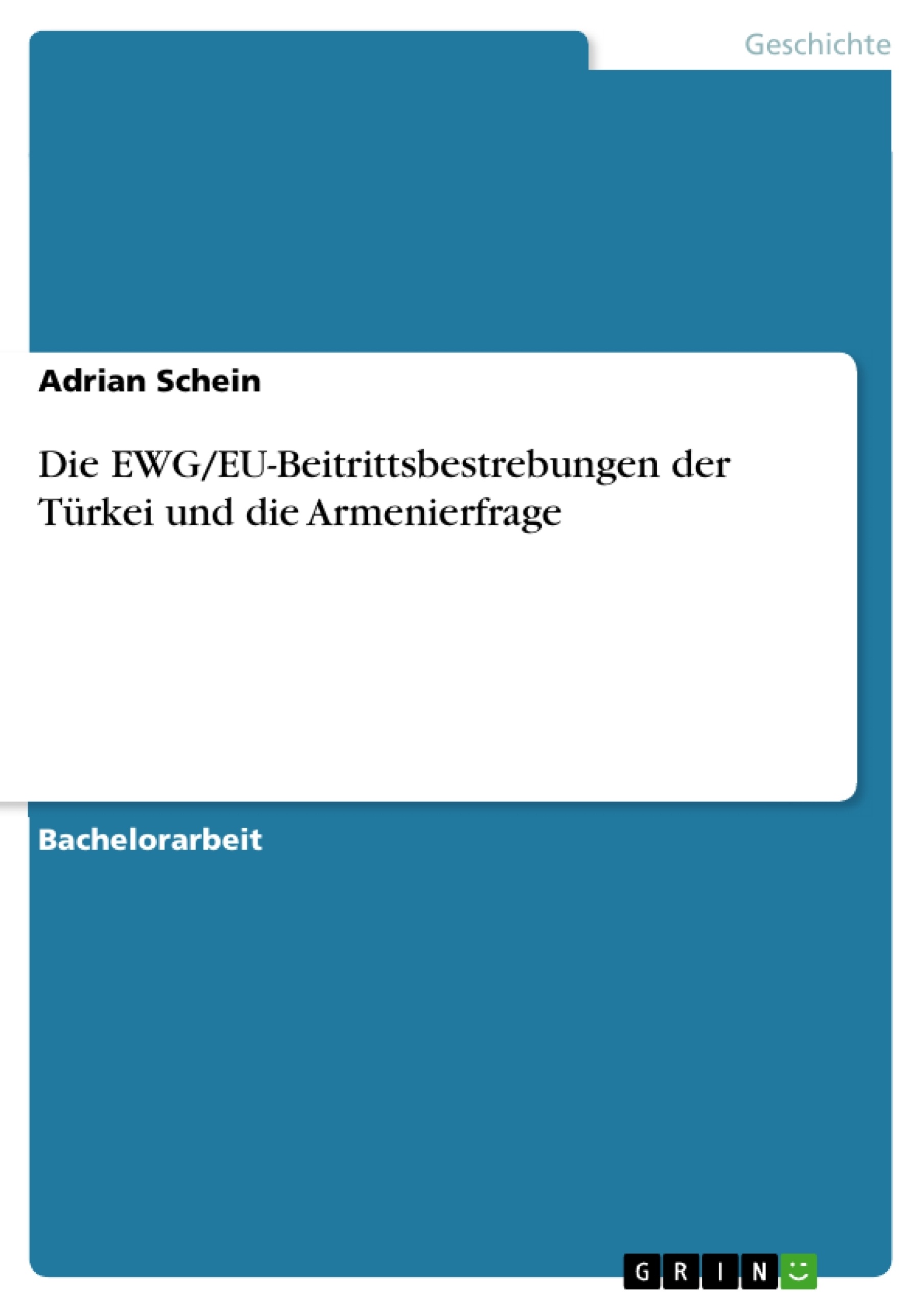Ein unabgeschlossenes Thema hinsichtlich freier Meinungsäußerung, Menschenrechte und Minderheitenpolitik ist die armenische Frage, deren öffentliche Diskussion in der Türkei weiterhin verboten ist. Ursprung der armenische Frage sind dabei die von den Jungtürken durchgeführten Deportationen und Massaker zwischen 1915-1917 im Osmanischen Reich, bei denen bis zu 1, 5 Mio. Armenier ums Leben gekommen sind. Am 24. April 2015 jähren sich Ereignisse des Jahres 1915 zum 100. Mal. Bis heute weigert sich die Türkei als Rechtsnachfolgerin des Osmanischen Reiches, Verantwortung für diese Geschehnisse zu übernehmen. Die ungleiche Behandlung von christlichen Minderheiten in der Türkei geht scheinbar mit der Leugnung beziehungsweise mit der Verharmlosung der Ereignisse einher. Die ethno-kulturelle Diversität der Türkei wird von der offiziellen Sicht der homogenen türkischen Nation verdrängt. Obwohl die christlichen Minderheiten durch den Lausanner Friedensvertrag anerkannt worden sind, werden nicht-muslimische Minderheiten in der Türkei fortlaufend diskriminiert und sind vom Begriff der „türkischen Gesellschaft" nicht erfasst. Der Artikel 301 des türkischen Strafgesetzbuches, der die „Herabsetzung der türkischen Nation, des Staates der Republik Türkei“ unter Verbot stellt, wird in der Gegenwart dazu benutzt, eine wahrheitsorientierte Debatte über die armenische Frage in der Türkei zu verhindern.
Folgende Fragen sollen erörtert werden:
Inwieweit hat die armenische Frage in der Türkei die Beitrittsverhandlungen zwischen der Türkei und der Europäischen Union beeinflusst? Welche Kriterien müssen von Beitrittskandidaten erfüllt werden? Wie wirken sich diese Kriterien auf die türkische Innenpolitik in Sachen Minderheiten, Meinungsfreiheit und der armenischen Frage aus? Wie reagiert die Türkei auf Resolutionen, in denen der Völkermord an den Armeniern verurteilt wird? Welche Auswirkungen haben Resolutionen und Gesetzesbeschlüsse von Mitgliedstaaten der EU auf die Beitrittsgespräche zwischen der Türkei und der EU? Da seit 2005 mit der Türkei offizielle Beitrittsverhandlungen geführt und seitdem jährlich Fortschrittsberichte von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht werden, sollen diese Fortschrittsberichte in der vorliegenden Arbeit unter den Gesichtspunkten der Fragestellung, inwieweit die armenische Frage und die damit einhergehende Minderheitenpolitik in der Türkei und der EU beeinflusst hat, untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangslage
- Der türkische Nationalismus und die Minderheitenpolitik in der Türkei nach dem 1. Weltkrieg
- Die EWG/EU-Beitrittsbestrebungen der Türkei
- Das Ankara-Abkommen
- Die Beitrittsverhandlungen während der Rezession
- Die EG stellt neue Beitrittsanforderungen an die Türkei
- Die Vollendung der Zollunion
- Der Beginn der Beitrittsverhandlungen
- Die armenische Frage und die türkischen EU-Beitrittsbestrebungen
- Auswirkungen des Konfliktes um Berg-Karabach
- Die Kopenhagener Kriterien
- Die Resolutionsproblematik
- Die Fortschrittsberichte der EU-Kommission zur Türkei
- Zusammenfassung
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht die Auswirkungen der armenischen Frage auf die EU-Beitrittsverhandlungen der Türkei. Sie analysiert die historische Entwicklung der türkischen EU-Beitrittsbestrebungen und die Rolle der armenischen Frage in diesem Prozess. Die Arbeit beleuchtet die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen der EU-Beitrittsverhandlungen, insbesondere die Kopenhagener Kriterien, und untersucht, inwieweit die Türkei diese Kriterien in Bezug auf Minderheitenrechte und Meinungsfreiheit erfüllt. Darüber hinaus werden die Reaktionen der Türkei auf Resolutionen des Europäischen Parlaments und nationaler Parlamente zur Anerkennung des Völkermordes an den Armeniern analysiert.
- Die historische Entwicklung der türkischen EU-Beitrittsbestrebungen
- Die Rolle der armenischen Frage in den EU-Beitrittsverhandlungen
- Die Kopenhagener Kriterien und ihre Bedeutung für die Türkei
- Die Reaktionen der Türkei auf Resolutionen zum Völkermord an den Armeniern
- Die Auswirkungen der armenischen Frage auf die türkische Innenpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der armenischen Frage für die türkischen EU-Beitrittsbestrebungen dar und erläutert die Forschungsfrage der Arbeit. Das Kapitel „Ausgangslage“ beleuchtet den türkischen Nationalismus und die Minderheitenpolitik in der Türkei nach dem Ersten Weltkrieg. Es analysiert die historischen Hintergründe der armenischen Frage und die Rolle des türkischen Staates in der Verhinderung einer offenen Debatte über die Ereignisse von 1915-1917. Das Kapitel „Die EWG/EU-Beitrittsbestrebungen der Türkei“ zeichnet die Geschichte der türkischen EU-Beitrittsbestrebungen nach, beginnend mit dem Ankara-Abkommen von 1963. Es analysiert die verschiedenen Phasen der Verhandlungen, die Herausforderungen und die Entwicklung der Beitrittskriterien. Das Kapitel „Die armenische Frage und die türkischen EU-Beitrittsbestrebungen“ untersucht die Auswirkungen der armenischen Frage auf die Beitrittsverhandlungen. Es analysiert die Rolle der Kopenhagener Kriterien, die Resolutionsproblematik und die Fortschrittsberichte der EU-Kommission zur Türkei.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Förderschwerpunkt Lernen, den inklusiven und exklusiven Unterricht sowie die schulische Inklusion, insbesondere in Nordrhein-Westfalen. Empirische Forschungsergebnisse werden präsentiert, um die Rahmenbedingungen und Herausforderungen der inklusiven Beschulung von Kindern mit dem Förderschwerpunkt Lernen zu beleuchten. Ein besonderer Fokus liegt auf der Bielefelder Längsschnittstudie (BiLieF-Projekt), die die Leistungsentwicklung und das Wohlbefinden von Schülern in inklusiven und exklusiven Förderarrangements vergleicht. Weitere Themen sind Förderempfehlungen, die Herausforderungen der Inklusion sowie Implikationen für die Schulentwicklung und Inklusionspraxis.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die „armenische Frage“ im Kontext der EU-Verhandlungen?
Es geht um die völkerrechtliche Anerkennung und Aufarbeitung der Deportationen und Massaker an Armeniern im Osmanischen Reich (1915-1917), die die Türkei bis heute offiziell leugnet oder verharmlost.
Wie beeinflusst dieses Thema den EU-Beitritt der Türkei?
Die armenische Frage berührt zentrale Beitrittskriterien (Kopenhagener Kriterien) wie Menschenrechte, Minderheitenschutz und freie Meinungsäußerung.
Was besagt Artikel 301 des türkischen Strafgesetzbuches?
Dieser Artikel verbietet die „Herabsetzung der türkischen Nation“ und wird oft genutzt, um eine kritische öffentliche Debatte über den Völkermord an den Armeniern zu unterdrücken.
Welche Rolle spielen die jährlichen Fortschrittsberichte der EU?
Die Berichte bewerten regelmäßig, inwieweit die Türkei Fortschritte bei der Einhaltung demokratischer Standards und der Lösung von Minderheitenkonflikten macht.
Wie reagiert die Türkei auf internationale Resolutionen zum Völkermord?
Die Türkei weist solche Resolutionen meist scharf zurück, was regelmäßig zu diplomatischen Spannungen mit EU-Mitgliedstaaten führt und die Beitrittsgespräche belastet.
- Citation du texte
- Adrian Schein (Auteur), 2013, Die EWG/EU-Beitrittsbestrebungen der Türkei und die Armenierfrage, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284765