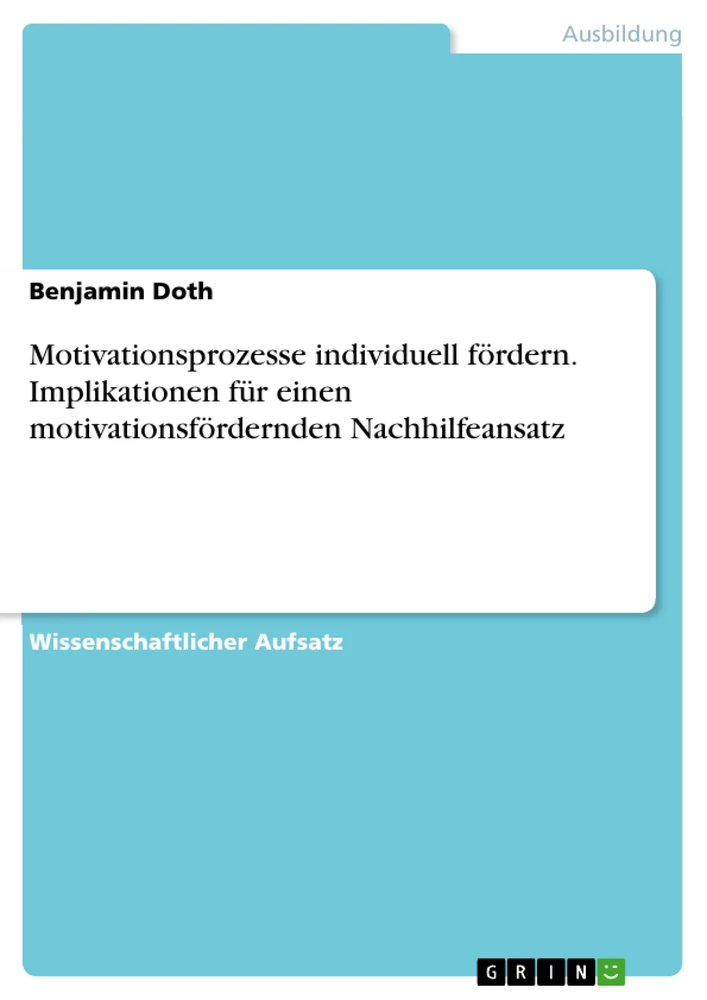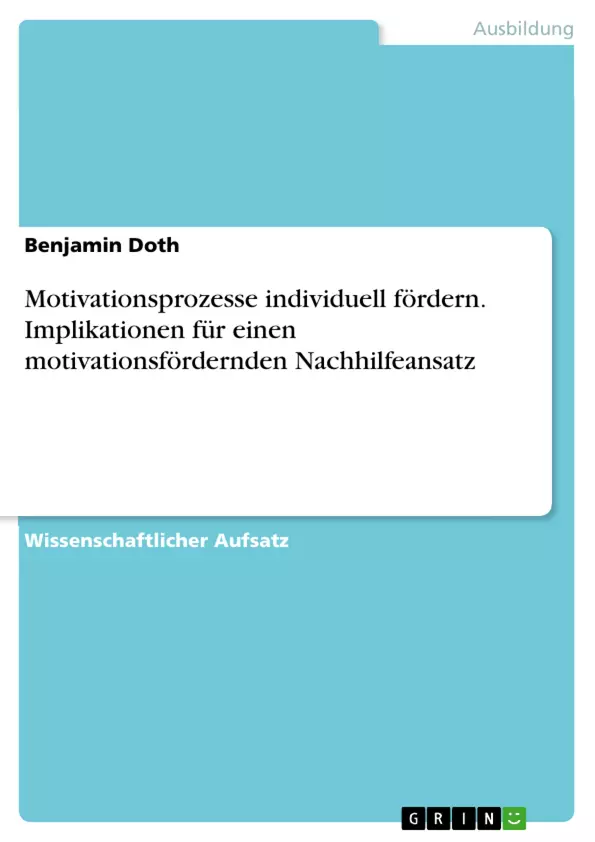Warum ist es wichtig, sich mit Motivationsprozessen auseinanderzusetzen? Zunächst einmal wird gerade das Gefühlsleben von Schülerinnen und Schülern durch ein ausgeprägtes Gefühl von Lust oder Unlust dominiert. Dieses Gefühl kann dazu führen, dass sich ein Schüler a) gerne mit einem Thema auseinandersetzt oder b) gar keine Leistungsbereitschaft für ein Thema zeigt.
Die Unterrichtsdidaktik kann nun entscheidend dazu beitragen, ein Gefühl von Unlust zu forcieren, oder ein bereits bestehendes Lustgefühl zu verstärken. Das hiermit verbundene emotionale Erleben steht im Fokus eines motivationsfördernden Unterrichtsansatzes.
Der Verwirklichung eines motivationsfördernden Unterrichtsansatzes muss jedoch zunächst eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem Motivationsbegriff vorausgehen, um hieraus Implikationen für die Praxis des Nachhilfeunterrichts entwickeln zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Der Motivationsbegriff
- 1.1: Intrinsische Motivation
- 1.1.1: Flow-Erleben
- 1.1.2: Motivatoren
- 1.2: Extrinsische Motivation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Aufsatz untersucht die Bedeutung von Motivationsprozessen im Nachhilfeunterricht und entwickelt Implikationen für einen motivationsfördernden Ansatz. Der Fokus liegt auf der individuellen Förderung von Lernenden und der Vermeidung von demotivierenden Faktoren.
- Intrinsische Motivation und deren Bedeutung für den Lernerfolg
- Das Flow-Erleben als Schlüssel zur intrinsischen Motivation
- Der Einfluss externer Anreize auf die intrinsische Motivation
- Didaktische Reduktion und Anpassung des Unterrichts an die individuellen Fähigkeiten der Schüler
- Entwicklung eines motivationsfördernden Nachhilfeansatzes
Zusammenfassung der Kapitel
1. Der Motivationsbegriff: Dieses Kapitel definiert den Begriff der intrinsischen Motivation und beleuchtet die Bedeutung des "Flow-Erlebens" als Voraussetzung für ihre Entstehung. Es wird erläutert, wie äußere Anreize unter bestimmten Bedingungen die intrinsische Motivation negativ beeinflussen können und wie diese negativen Effekte vermieden werden können. Ein Beispiel mit zwei Schülern veranschaulicht die Problematik von Belohnungssystemen, die nicht auf individuelle Leistungen, sondern nur auf die korrekte Ausführung von Aufgaben achten. Die Bedeutung einer differenzierten Aufgabenstellung und die Berücksichtigung der individuellen Bemühungen werden hervorgehoben.
1.1: Intrinsische Motivation: Der Abschnitt befasst sich eingehend mit dem Konzept der intrinsischen Motivation, definiert sie als einen inneren Antrieb, der von der Tätigkeit selbst ausgeht, und erklärt den Zusammenhang mit dem Flow-Erleben. Es wird detailliert beschrieben, unter welchen Umständen extrinsische Belohnungen die intrinsische Motivation negativ beeinflussen können. Der Text betont die Wichtigkeit, dass Belohnungen nicht nur die korrekte Ausführung einer Aufgabe belohnen, sondern auch den individuellen Einsatz und das Bemühen des Schülers berücksichtigen. Ein Beispiel mit Schülern, die freiwillige Aufgaben bearbeiten, illustriert dies. Die Bedeutung der Gestaltung von Aufgaben wird betont, damit ein Flow-Erlebnis ermöglicht wird.
1.1.1: Flow-Erleben: Dieser Abschnitt beschreibt das Flow-Erleben als einen Zustand tiefer Konzentration und positiven emotionalen Erlebens während einer Tätigkeit. Er wird als Voraussetzung für intrinsische Motivation dargestellt. Es wird betont, dass die Anforderungen der Aufgabe den Fähigkeiten des Lernenden entsprechen müssen, um ein Flow-Erlebnis zu ermöglichen. Ein Beispiel eines Schülers, der durch eine an seine Fähigkeiten angepasste Aufgabe im Biologieunterricht ein Flow-Erlebnis erlebte und dadurch nachhaltig motiviert wurde, veranschaulicht die praktische Relevanz.
Schlüsselwörter
Intrinsische Motivation, extrinsische Motivation, Flow-Erleben, Motivatoren, individuelle Förderung, Nachhilfeunterricht, Lernmotivation, Unterrichtsdidaktik, didaktische Reduktion, Leistungsbereitschaft.
Häufig gestellte Fragen zum Aufsatz: Motivation im Nachhilfeunterricht
Was ist der zentrale Gegenstand des Aufsatzes?
Der Aufsatz untersucht die Bedeutung von Motivationsprozessen, insbesondere intrinsischer Motivation, im Nachhilfeunterricht und entwickelt daraus Implikationen für einen motivationsfördernden Ansatz. Der Fokus liegt auf der individuellen Förderung der Lernenden und der Vermeidung demotivierender Faktoren.
Welche Arten von Motivation werden behandelt?
Der Aufsatz unterscheidet zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Intrinsische Motivation wird als innerer Antrieb, der von der Tätigkeit selbst ausgeht, definiert, während extrinsische Motivation durch äußere Anreize bestimmt wird. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Einfluss extrinsischer Belohnungen auf die intrinsische Motivation.
Welche Rolle spielt das "Flow-Erleben"?
Das Flow-Erleben, ein Zustand tiefer Konzentration und positiven emotionalen Erlebens während einer Tätigkeit, wird als Schlüssel zur intrinsischen Motivation dargestellt. Es wird betont, dass die Anforderungen der Aufgabe den Fähigkeiten des Lernenden entsprechen müssen, um ein Flow-Erlebnis zu ermöglichen.
Wie wird die individuelle Förderung im Nachhilfeunterricht berücksichtigt?
Der Aufsatz betont die Bedeutung der individuellen Förderung durch didaktische Reduktion und Anpassung des Unterrichts an die individuellen Fähigkeiten der Schüler. Es wird deutlich gemacht, dass Belohnungssysteme nicht nur die korrekte Ausführung von Aufgaben, sondern auch den individuellen Einsatz und das Bemühen des Schülers berücksichtigen sollten.
Welche konkreten Maßnahmen werden zur Steigerung der Motivation vorgeschlagen?
Der Aufsatz schlägt einen motivationsfördernden Nachhilfeansatz vor, der auf der Berücksichtigung individueller Fähigkeiten, der Gestaltung von Aufgaben, die ein Flow-Erlebnis ermöglichen, und der Vermeidung demotivierender Faktoren durch differenzierte Aufgabenstellung und Berücksichtigung individuellen Bemühens basiert.
Welche Kapitel umfasst der Aufsatz und worum geht es in ihnen?
Der Aufsatz gliedert sich in Kapitel zum Motivationsbegriff (inkl. intrinsischer und extrinsischer Motivation und Flow-Erleben). Jedes Kapitel analysiert die jeweiligen Aspekte detailliert mit Beispielen aus dem Nachhilfeunterricht.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Aufsatz?
Schlüsselwörter sind: Intrinsische Motivation, extrinsische Motivation, Flow-Erleben, Motivatoren, individuelle Förderung, Nachhilfeunterricht, Lernmotivation, Unterrichtsdidaktik, didaktische Reduktion, Leistungsbereitschaft.
Für wen ist dieser Aufsatz relevant?
Dieser Aufsatz ist relevant für Nachhilfelehrer, Pädagogen, Studenten der Pädagogik und alle, die sich mit Lernmotivation und individueller Förderung im Unterricht auseinandersetzen.
- Quote paper
- Kinder- und Jugendcoach (IPE) Benjamin Doth (Author), 2014, Motivationsprozesse individuell fördern. Implikationen für einen motivationsfördernden Nachhilfeansatz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284808