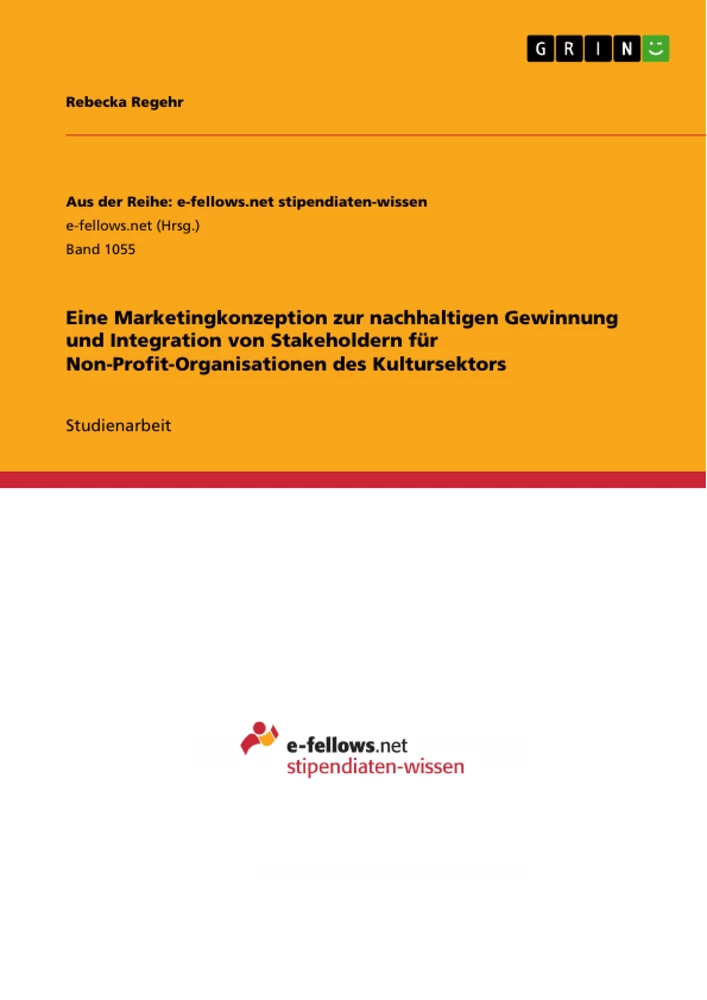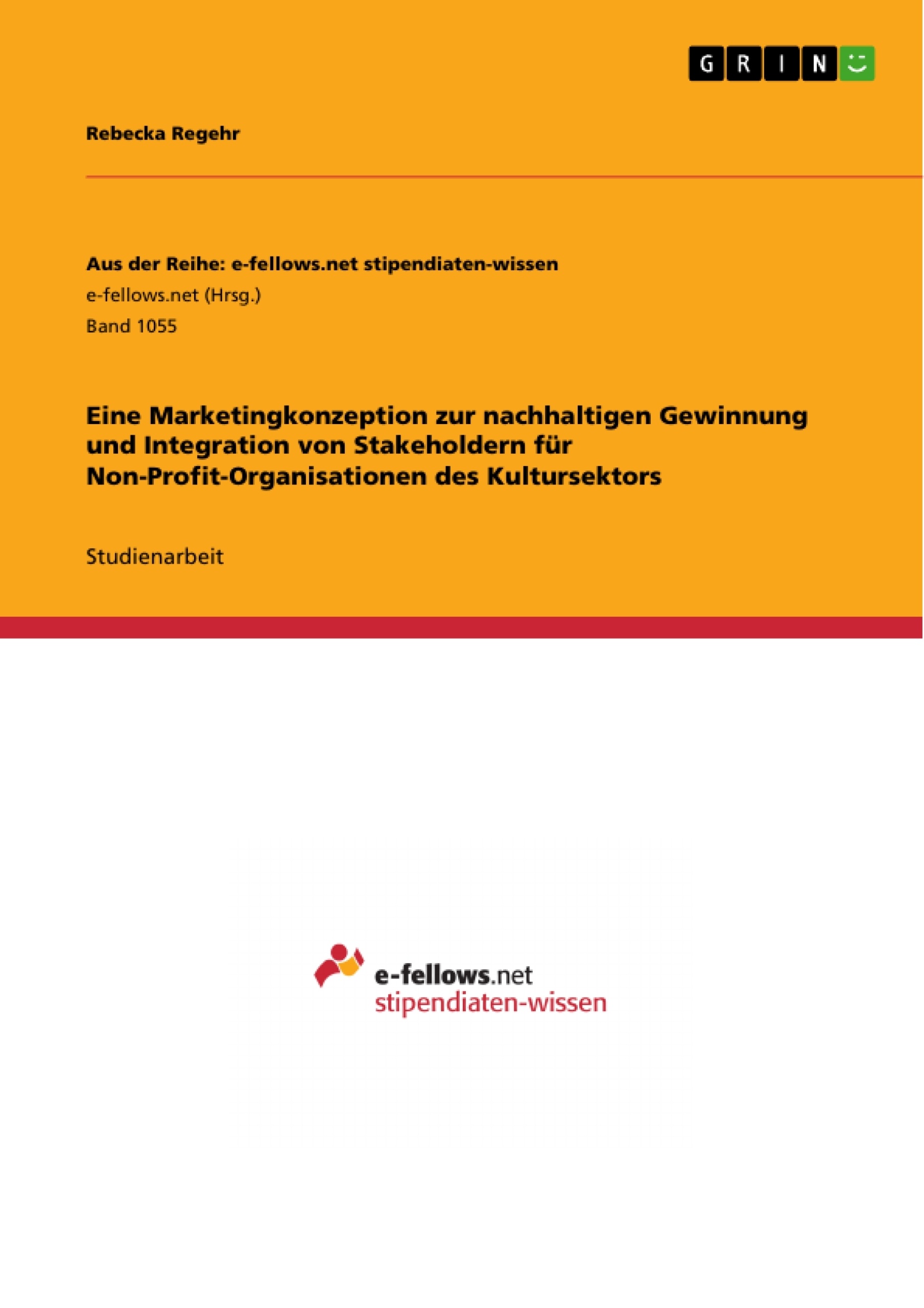Um sich als NPO auf dem Markt behaupten zu können, bedarf es einer geschickten strategischen Marketing- und Kommunikationsarbeit, um das Vertrauen potenzieller
Stakeholder zu erlangen. Die vorliegende Marketingkonzeption befasst sich mit der Gewinnung und nachhaltigen Bindung potenzieller Stakeholder für den Verein Musiker ohne Grenzen (MoG), der seit seiner Gründung im Jahr 2008 ehrenamtlich von
Studenten organisiert wird.
Dabei werden mittels einer Marketingsituationsanalyse
externe und interne Faktoren untersucht und die Ergebnisse in Form eines SWOTProfils verdichtet dargestellt. Auf Grundlage des Selbstverständnisses des MoG e. V. und der angestrebten Ziele werden geeignete Marketingstrategien ausgewählt, die
den Verein effektiv am Markt positionieren, um die Stakeholder zu erreichen. Die Strategie- und Marketing-Mix-Planungen erfolgen unter Berücksichtigung eines geringen
Marketingbudgets. Neben Entscheidungen auf den Ebenen der Leistungs-, Preis-, Distributions- und Kommunikationspolitik kommt zusätzlich das Cause-Related Marketing zum Einsatz, das attraktive Möglichkeiten zur Erreichung der Ziele des Vereins inkludiert.
Das operative und strategische Marketingcontrolling bietet
zudem die Möglichkeit, das Ergebnis sowie einen Änderungsbedarf in den Marketingaktivitäten sichtbar zu machen. Diese Hausarbeit beinhaltet keine vollständig ausgearbeitete und bereits angewandte Marketingkonzeption, sondern soll ausschließlich einen möglichen groben Leitfaden
für eine zukünftige Realisierung an die Hand geben.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Analyse und Bewertung der Marketingsituation
- 2.1 Analyse der externen Einflussgrößen
- 2.1.1 Umfeldanalyse
- 2.1.2 Marktanalyse
- 2.1.3 Wettbewerbsanalyse
- 2.1.4 Stakeholderanalyse
- 2.2 Erfassung vereinsinterner Einflussgrößen
- 2.3 Bewertung der Marketingsituation mithilfe der SWOT-Analyse
- 2.1 Analyse der externen Einflussgrößen
- 3 Festlegung der Marketingziele
- 4 Strategieprofil der Marketingkonzeption
- 5 Operative Darstellung der Marketingkonzeption
- 5.1 Leistungspolitik
- 5.2 Preispolitik
- 5.3 Distributionspolitik
- 5.4 Kommunikationspolitik
- 5.5 Cause-Related Marketing
- 6 Strategisches und operatives Controlling der Marketingkonzeption
- 7 Ausblick
- 8 Literaturverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Entwicklung einer Marketingkonzeption für Non-Profit-Organisationen im Kulturbereich, speziell für den Verein Musiker ohne Grenzen (MoG). Ziel ist es, eine Strategie zur nachhaltigen Gewinnung und Integration potenzieller Stakeholder zu entwickeln, die den Verein in seiner ehrenamtlichen Arbeit unterstützt und seine Ziele fördert. Die Arbeit analysiert die Marketingsituation des Vereins, identifiziert relevante interne und externe Einflussfaktoren und entwickelt auf dieser Grundlage ein strategisches Marketingkonzept, das den Verein effektiv am Markt positioniert.
- Analyse der Marketingsituation des Vereins Musiker ohne Grenzen (MoG)
- Entwicklung einer Strategie zur Gewinnung und Bindung von Stakeholdern
- Definition von Marketingzielen und -strategien für den Verein
- Entwicklung eines Marketing-Mix, der die spezifischen Bedürfnisse des Vereins berücksichtigt
- Einbindung von Cause-Related Marketing als Instrument zur Steigerung der Bekanntheit und Akzeptanz des Vereins
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Marketingkonzeption für Non-Profit-Organisationen im Kulturbereich ein und erläutert die Relevanz des Marketings für den Erfolg von Vereinen wie dem MoG e. V. Die Analyse und Bewertung der Marketingsituation umfasst eine detaillierte Untersuchung der externen und internen Einflussfaktoren, die den Verein beeinflussen. Die Ergebnisse werden in Form eines SWOT-Profils zusammengefasst. Die Festlegung der Marketingziele definiert die angestrebten Ergebnisse der Marketingaktivitäten. Das Strategieprofil der Marketingkonzeption beschreibt die grundlegende Ausrichtung der Marketingstrategie und die Auswahl geeigneter Marketinginstrumente. Die operative Darstellung der Marketingkonzeption beinhaltet die konkrete Umsetzung der Marketingstrategie auf den Ebenen der Leistungs-, Preis-, Distributions- und Kommunikationspolitik. Das Cause-Related Marketing wird als zusätzliches Instrument zur Erreichung der Vereinsziele vorgestellt. Das strategische und operative Controlling der Marketingkonzeption dient der Erfolgsmessung und der Anpassung der Marketingaktivitäten.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Marketingkonzeption, Non-Profit-Organisationen, Kultursektor, Stakeholdergewinnung, Stakeholderintegration, Vereinsmarketing, SWOT-Analyse, Marketingziele, Marketingstrategie, Marketing-Mix, Cause-Related Marketing, Marketingcontrolling.
Häufig gestellte Fragen
Wie können NPOs im Kulturbereich neue Stakeholder gewinnen?
Durch eine strategische Marketingsituationsanalyse und gezielte Kommunikationsarbeit, die das Vertrauen potenzieller Unterstützer und Mitglieder aufbaut.
Was ist Cause-Related Marketing für Vereine?
Es ist eine Kooperation zwischen einem Unternehmen und einer NPO, bei der der Verkauf eines Produkts mit einer Spende für den guten Zweck verknüpft wird, um Ziele beider Partner zu erreichen.
Warum ist eine SWOT-Analyse für Non-Profit-Organisationen wichtig?
Sie hilft, interne Stärken und Schwächen sowie externe Chancen und Risiken zu identifizieren, um den Verein effektiv am Markt zu positionieren.
Welche Marketingstrategien eignen sich für Vereine mit geringem Budget?
Gezielte Online-Kommunikation, Stakeholder-Integration und Kooperationen im Rahmen des Cause-Related Marketings sind kosteneffiziente Wege zur Zielerreichung.
Was leistet Marketingcontrolling für eine NPO?
Es macht Ergebnisse sichtbar und zeigt Änderungsbedarf in den Aktivitäten auf, um sicherzustellen, dass die begrenzten Ressourcen wirkungsvoll eingesetzt werden.
- Arbeit zitieren
- Rebecka Regehr (Autor:in), 2014, Eine Marketingkonzeption zur nachhaltigen Gewinnung und Integration von Stakeholdern für Non-Profit-Organisationen des Kultursektors, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284820