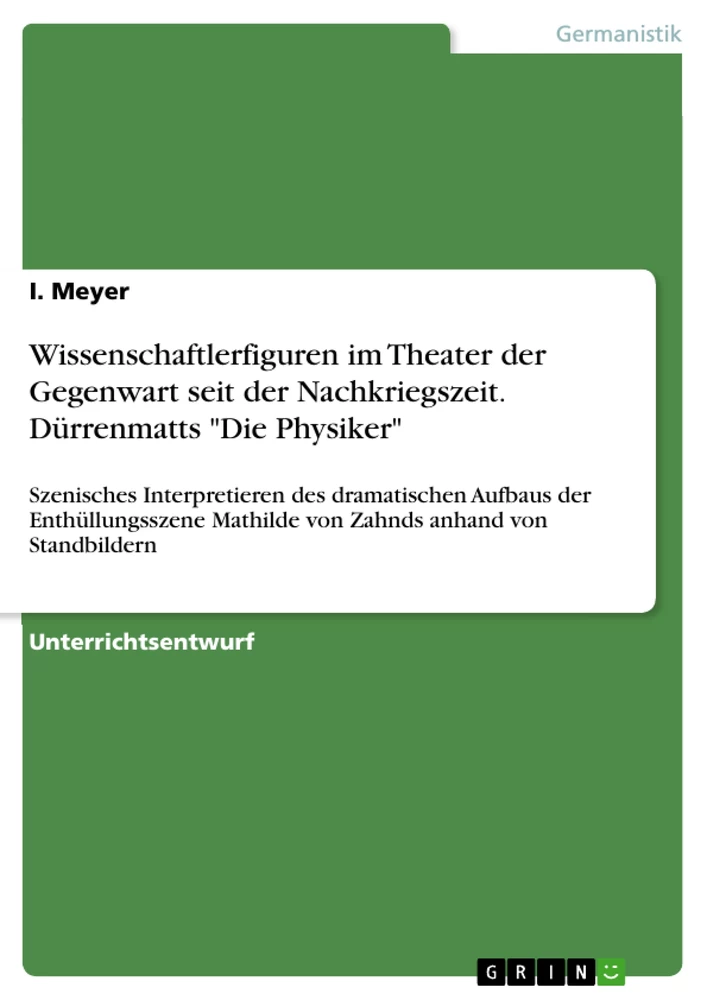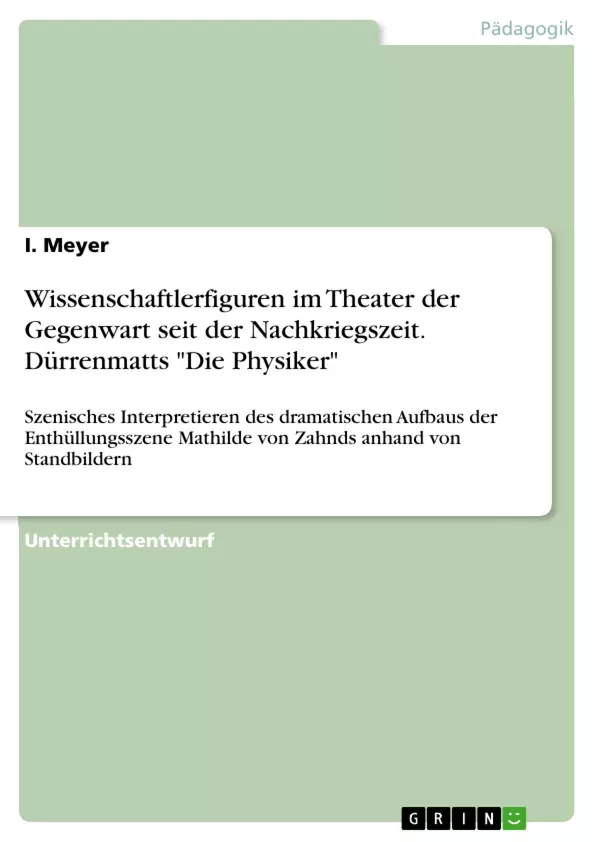Die Unterrichtsreihe „Wissenschaftlerfiguren im Theater der Gegenwart seit der Nachkriegszeit – Dürrenmatts Die Physiker“ entspricht dem in den Richtlinien und Lehrplänen für die Sek. II vorgesehenen Halbjahresthema der „Mitverantwortung des Einzelnen in der wissenschaftlich-technischen Lebenswelt von heute.“ Im Rahmen des Lernbereichs „Umgang mit Texten: Epochen, Gattungen“ sollen laut Lehrplan Theaterstücke behandelt werden, in denen der Wissenschaftler und seine gesellschaftliche Verantwortung im Mittelpunkt stehen. Zusammen mit weiteren Dramen, wie z.B. Brechts Galilei oder Kipphardts Oppenheimer, bieten Dürrenmatts Physiker noch immer eine aktuelle Grundlage für die Auseinandersetzung mit der Problematik von Wissenschaft und Verantwortung. Gerade vor dem Hintergrund der aktuell wieder aufkeimenden Diskussionen um atomare Energie und Katastrophen überzeugt das 1962 uraufgeführte Theaterstück auch heute noch durch seine brisante Thematik. Doch es ist nicht nur allein die Thematik, die den Zuschauer bzw. den Schüler/die Schülerin fesselt, sondern auch die groteske und teilweise schaurige Komik des Dramas. Durch überraschende und teilweise schockierende Enthüllungen werden die Leser bzw. Zuschauer immer wieder dazu gezwungen, ihre bisher konstruierten Sinnzusammenhänge zu verwerfen und neue Deutungs- und Interpretationsansätze zu finden.
Inhaltsverzeichnis
- Thema der Reihe
- Wissenschaftlerfiguren im Theater der Gegenwart seit der Nachkriegszeit - Dürrenmatts Die Physiker
- Thema der Stunde
- Die,,schlimmstmögliche Wendung" - Szenisches Interpretieren des dramatischen Aufbaus der Enthüllungsszene Mathilde von Zahnds anhand von Standbildern
- 1. Einordnung der Unterrichtsstunde in die Unterrichtsreihe
- Stunde(n)
- 1-2
- 3-4
- 5-6
- 7-8
- 9-10
- 11-12
- 13-14
- 15-16
- 17
- 18-19
- 21-22
- 22-23
- Inhaltlicher Schwerpunkt
- Wer oder was sind,,Die Physiker"?
- Der Aufbau des Dramas
- Familienbesuch im Irrenhaus
- Verantwortung der Wissenschaft | - drei Physiker, drei Ansichten
- Verantwortung der Wissenschaft II - der historische Hintergrund
- Exkurs - Aspekte und Methoden der Dramenanalyse
- Das Gespräch zwischen dem Inspektor und Frl. Doktor (S. 27-29)
- Exkurs - Standbildbauen
- Die,,schlimmstmögliche Wendung" - Szenisches Interpretieren des dramatischen Aufbaus der Enthüllungsszene Mathilde von Zahnds anhand von Standbildern
- Die letzten Worte
- Belanglos oder perfekt? Zur Rezeption der,,Physiker"
- „Die Physiker" auf Leinwand
- Didaktisch-methodischer Schwerpunkt
- Antizipieren von inhaltlichen Aspekten des Dramas durch Beschreiben von Dürrenmatts Zeichnung „Die Physiker I" und Reflektieren der Bühnenanweisungen des ersten Aktes.
- Gliedern des Dramas in Szenen, um den SuS einen Überblick über Ort, Zeit und Handlung des Dramas zu vermitteln.
- Analysieren und Vergleichen der beiden Aktanfänge, um Wiederholungen und Parallelen in der Konzeption des Dramas aufzudecken.
- Charakterisieren von Möbius durch arbeitsteiliges Erarbeiten der unterschiedlichen Sichtweisen auf die Figur (Frau Rose, Schwester Monika, Frl. Doktor).
- Schreiben einer Selbstcharakterisierung Möbius' auf der Grundlage des „Psalm Salomos“ (S. 41-42) zur Förderung der Empathiefähigkeit der SuS.
- Herausarbeiten der unterschiedlichen Wissenschaftsauffassungen der drei Physiker durch arbeitsteiliges, textnahes Analysieren der ersten Enthüllungsszene (Akt II, S. 61-77), um die SuS auf die zentrale Thematik des Stückes hinzuweisen.
- Erarbeiten der historischen Umstände des kalten Krieges und der Atomphysik im Allgemeinen anhand eines Sachtextes.
- Schreiben eines fiktiven Leserbriefs an Dürrenmatt als Antwort auf seine Buchrezension zu „Heller als tausend Sonnen" von Robert Jungk.
- Erarbeiten von Merkmalen eines gelungenen Standbildes; Umsetzen der vorher analysierten Szene in ein Standbild.
- Bestimmen der Funktion der Schlussmonologe durch Herausarbeiten des in ihnen enthaltenen Wissenschaftsverständnisses der drei Physiker.
- Diskutieren kontroverser Interpretationsansätze anhand der Rezeptionen Hans Mayers und Bernhard Greiners.
- Auseinandersetzen mit der filmischen Adaption des Stückes von 1964 zum Vergleich von literarischer Vorlage und Inszenierung.
- 2,2. Angestrebte Lernziele/ Kompetenzbeiträge
- Stundenlernziel:
- Die SuS erkennen anhand körperlicher und mimischer Ausdrucksmittel, in welchen Etappen sich der Konflikt zwischen den Physikern und Mathilde von Zahnd in der Enthüllungsszene zuspitzt.
- Teilziele:
- Die Sus reaktivieren und präzisieren ihre Textkenntnisse hinsichtlich des dramatischen Wendepunktes des Dramas, indem sie Punkt 3 der „,21 Punkte zu den Physikern" erläutern.
- Die Sus stellen eine vorläufige Deutungshypothese auf, indem sie den Aufbau der Enthüllungsszene als dramatisch ansteigend beschreiben.
- Die SuS visualisieren anhand eines Standbildes die Handlungs- und Beziehungsstruktur des jeweiligen Szenenausschnittes, indem sie sich in die einzelnen Figuren hineinversetzen und überlegen, wie die Gefühle, Gedanken und Beziehungen der Figuren durch Körperhaltung und Mimik ausgedrückt werden können.
- Die Sus werten die dargestellten Standbilder aus, indem sie diese zunächst beschreiben und anschließend in Hinblick auf die etappenweise Steigerung der Dramatik deuten.
- Die Sus reflektieren die Methode des Erstellens von Standbildern, indem sie ihre Meinung dazu äußern, inwiefern die Methode ihnen dabei geholfen hat, die dramatische Entwicklung der Enthüllungsszene nachzuvollziehen.
- Kompetenzen:
- Lernbereich,,Umgang mit Texten und Medien"
- Die Sus können einen Text szenisch interpretieren.¹
- Die SuS können Texte in eine andere Ausdrucksform bringen.²
- Die Sus können Textausschnitte analogisieren und kontrastieren.³
- Die Sus können innerhalb einer Gruppe unterschiedliche Formen der Wahrnehmung und des Verstehens von Texten reflektieren und umsetzen.4
- 3. Zentrale didaktisch-methodische Begründungen
- 4. Literatur
- Primärliteratur:
- Dürrenmatt, Friedrich: Die Physiker. Eine Komödie in zwei Akten. Neufassung 1980. Zürich: Diogenes 1998.
- Sekundärliteratur:
- Brenner, Gerd: Fundgruben Methoden II. Für Deutsch und Fremdsprachen. Berlin: Cornelsen Scriptor 2007.
- Diekhans, Johannes (Hrsg.): Einfach Deutsch. Friedrich Dürrenmatt. Die Physiker. Paderborn: Schöningh 2005.
- Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Sekundarstufe II. Gymnasium/Gesamtschule. Deutsch. Richtlinien und Lehrpläne. Frechen: Ritterbachverlag 1999.
- Scheller, Ingo: Szenische Interpretation. Theorie und Praxis eines handlungs- und erfahrungsbezogenen Literaturunterrichts in der Sekundarstufe I und II. 3. Aufl. Seelze: Klett/ Kallmeyer 2010.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Unterrichtsreihe „Wissenschaftlerfiguren im Theater der Gegenwart seit der Nachkriegszeit - Dürrenmatts Die Physiker“ zielt darauf ab, die Schüler/innen mit dem Werk Friedrich Dürrenmatts vertraut zu machen und sie in die Lage zu versetzen, das Drama „Die Physiker“ auf verschiedenen Ebenen zu analysieren und zu interpretieren. Die Reihe soll die Schüler/innen dazu anregen, sich mit der Problematik von Wissenschaft und Verantwortung auseinanderzusetzen und die Rolle des Wissenschaftlers in der Gesellschaft zu reflektieren.
- Die Verantwortung des Wissenschaftlers in der Gesellschaft
- Die Grenzen von Wissenschaft und Vernunft
- Die Folgen von wissenschaftlichem Fortschritt
- Die Rolle des Zufalls und der Ironie in der Geschichte
- Die Bedeutung von Sprache und Kommunikation in der Dramaturgie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Unterrichtsreihe beginnt mit einer Einführung in das Thema „Wissenschaftlerfiguren im Theater der Gegenwart seit der Nachkriegszeit“ und stellt Dürrenmatts „Die Physiker“ als ein zentrales Beispiel für diese Thematik vor. Die Schüler/innen werden mit den wichtigsten Figuren und dem Handlungsverlauf des Dramas vertraut gemacht.
In den folgenden Stunden werden verschiedene Aspekte des Dramas analysiert, darunter die unterschiedlichen Wissenschaftsauffassungen der drei Physiker, die historische und gesellschaftliche Bedeutung des kalten Krieges und die Rolle der Ironie und des Zufalls in der Dramaturgie. Die Schüler/innen werden dazu angeregt, sich mit den verschiedenen Interpretationen des Dramas auseinanderzusetzen und eigene Deutungen zu entwickeln.
Ein wichtiger Schwerpunkt der Reihe liegt auf der szenischen Interpretation des Dramas. Die Schüler/innen werden mit verschiedenen Methoden der szenischen Analyse vertraut gemacht und lernen, den Text auf kreative und spielerische Weise zu erarbeiten.
Die Reihe endet mit einer Diskussion über die Rezeption des Dramas und die filmische Adaption von 1964. Die Schüler/innen werden dazu angeregt, die literarische Vorlage mit der Inszenierung zu vergleichen und die unterschiedlichen Interpretationen des Dramas zu reflektieren.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Verantwortung der Wissenschaft, den kalten Krieg, die Atomphysik, die Dramenanalyse, die szenische Interpretation, Standbildbauen, die Enthüllungsszene, die Figurencharakterisierung, die Wissenschaftsauffassungen, die Rezeption des Dramas und die filmische Adaption.
Häufig gestellte Fragen
Welche zentrale Thematik behandelt Dürrenmatts „Die Physiker“?
Das Drama thematisiert die Verantwortung des Wissenschaftlers gegenüber der Gesellschaft und die Frage, ob wissenschaftliche Erkenntnisse kontrollierbar bleiben.
Was ist die „schlimmstmögliche Wendung“ bei Dürrenmatt?
Ein dramatisches Prinzip Dürrenmatts, wonach eine Geschichte dann ihr Ende gefunden hat, wenn sie die schlimmste Wendung nimmt – hier die Machtübernahme durch die wahnsinnige Ärztin.
Warum geben sich die Physiker als Wahnsinnige aus?
Möbius flüchtet ins Irrenhaus, um seine gefährlichen Entdeckungen vor der Welt zu schützen; die anderen beiden sind Geheimagenten, die ihn für ihre Regierungen gewinnen wollen.
Inwiefern ist das Stück heute noch aktuell?
Die Debatte um die Ethik der Forschung (z.B. Atomkraft, KI, Gentechnik) und die politische Instrumentalisierung von Wissen ist zeitlos relevant.
Welche Rolle spielt die Groteske in dem Drama?
Dürrenmatt nutzt Humor und schockierende Enthüllungen, um die Absurdität einer Welt darzustellen, in der Vernunft ins Chaos führt.
- Quote paper
- I. Meyer (Author), 2013, Wissenschaftlerfiguren im Theater der Gegenwart seit der Nachkriegszeit. Dürrenmatts "Die Physiker", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284864