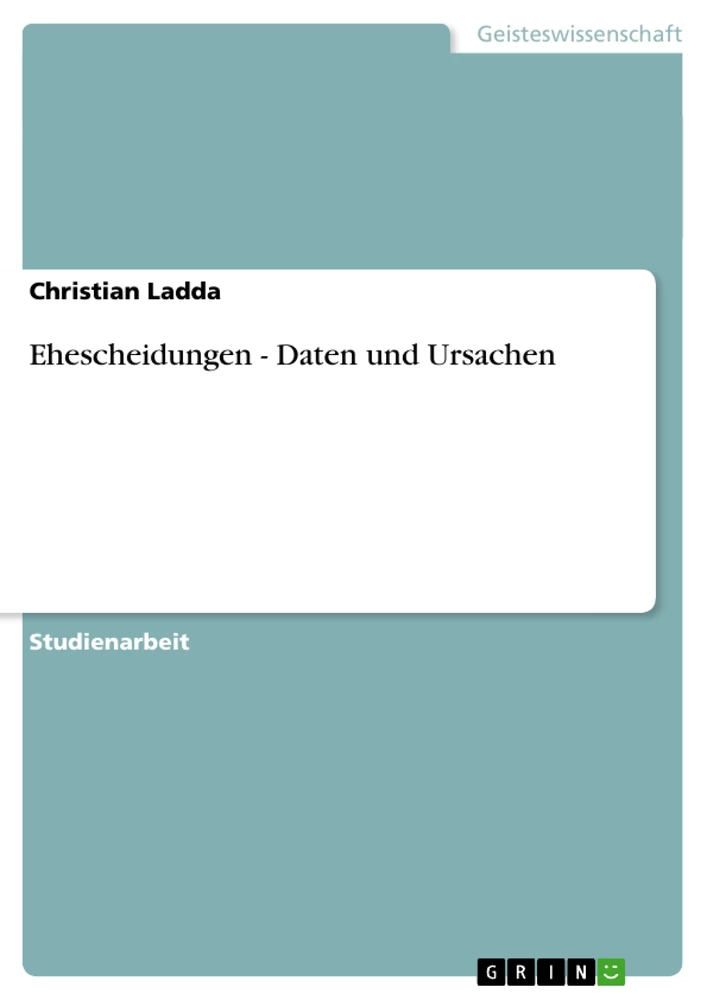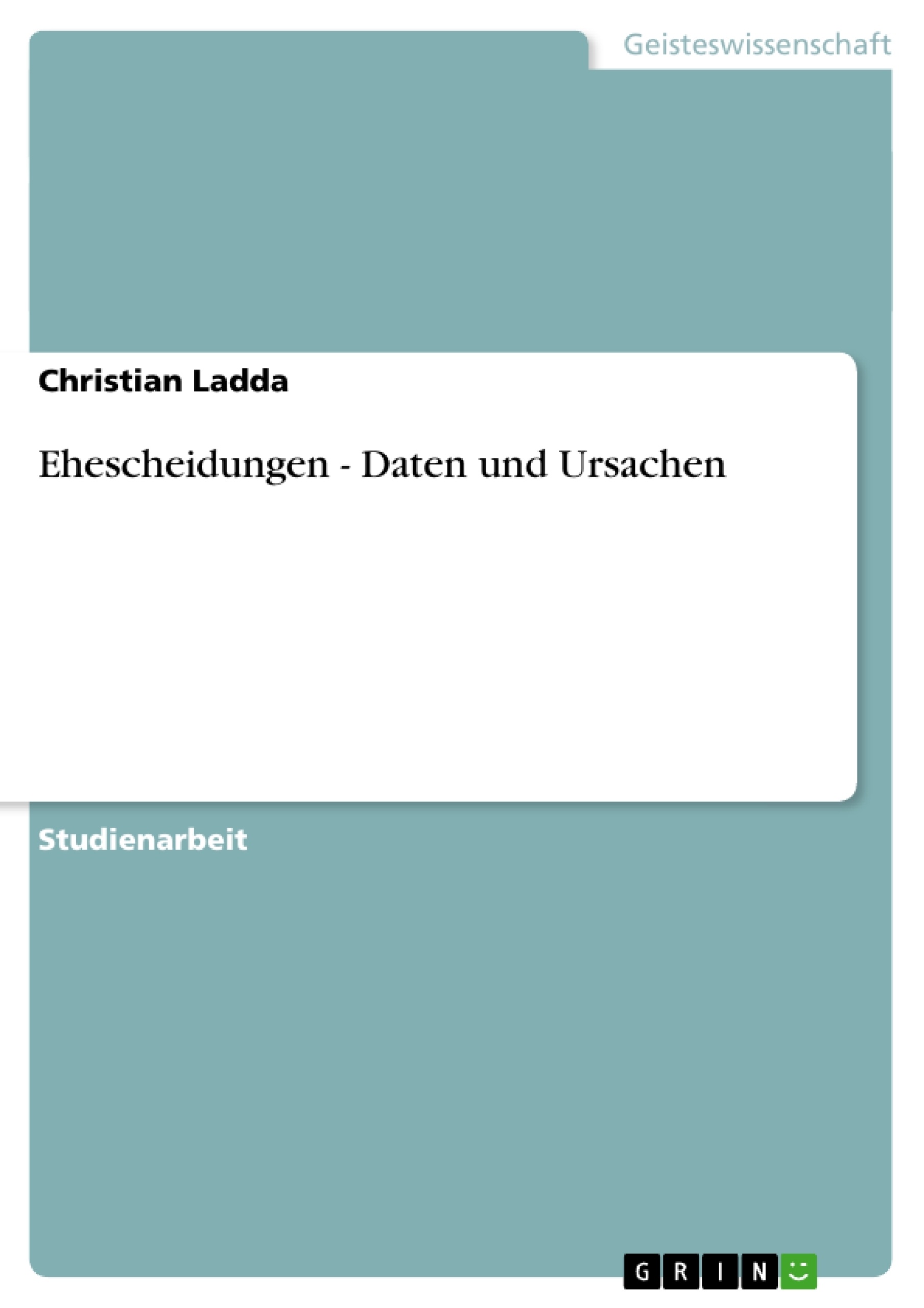„Neuer Höchststand bei den Ehescheidungen im Jahr 2002“, so lautet die Überschrift
der offiziellen Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes vom 6. November
2003. Dieses Ergebnis bestätigt den Trend der ansteigenden Scheidungshäufigkeit
in der Bundesrepublik Deutschland, der bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts
zu beobachten ist und bis auf vereinzelte, kurzzeitige Unterbrechungen,
einer kontinuierlichen Zunahme unterliegt. In der Bundesrepublik Deutschland wird
heutzutage bereits jede dritte Ehe geschieden, wobei die Prognosen für die Zukunft
auf einen weiteren Anstieg hindeuten.
Die Gründe dafür sind vielfältig. Der bereits seit 1960 stattfindende Wertewandel
hat die Ansprüche an den Partner gravierend verändert, die traditionelle Eheauffassung
verlor zunehmend an Bedeutung. Bis dahin geltende Normen wie Treue und
das Einhalten traditioneller Geschlechterrollen wurde durch individuelle Selbstentfaltungsbestrebungen
abgelöst. Die gesetzlich festgelegte Gleichstellung zwischen
Mann und Frau, Bildungsexpansion sowie zunehmende Frauenerwerbsbeteiligung
waren wesentliche Auslöser dieser Tendenzen (vgl. Scheller 1992, S.15).
Die vorliegende Arbeit gibt zunächst einen Überblick über die Entwicklung der
Scheidungshäufigkeit in Deutschland ab 1950. Im Anschluss werden ursächliche
Bedingungen und Erklärungsansätze zu den Ursachen von Ehescheidungen dargestellt
und untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Daten zur Scheidungsentwicklung
- 3. Zur Ursachendiskussion von Ehescheidungen
- 3.1. Entwicklung des Scheidungsrechts
- 3.2. Der Wandel der Rolle der Frau
- 3.3. Einfluss ehelicher Arbeitsteilung
- 3.4. Strukturwandel der Ehe
- 3.5. Ehescheidungen in austauschtheoretischer Perspektive
- 3.6. Scheidungsursachen aus Sicht der Betroffenen
- 4. Schlussbetrachtung
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Entwicklung der Scheidungszahlen in der Bundesrepublik Deutschland ab 1950 und analysiert die zugrundeliegenden Ursachen. Sie untersucht den Einfluss des gesellschaftlichen Wandels auf die Ehe und die individuellen Lebensentwürfe.
- Entwicklung des Scheidungsrechts und des Zerrüttungsprinzips
- Wandel der Rolle der Frau und die Auswirkungen auf die Ehe
- Eheliche Arbeitsteilung und ihre Relevanz für die Stabilität der Ehe
- Strukturwandel der Ehe und neue Formen des Zusammenlebens
- Ehescheidungen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einem Überblick über die Entwicklung der Scheidungsrate in Deutschland ab 1950, die einen stetigen Anstieg aufzeigt. Sie untersucht die Ursachen für diese Entwicklung, angefangen vom Wandel des Scheidungsrechts und der Einführung des Zerrüttungsprinzips im Jahr 1977. Die Analyse beleuchtet zudem die Bedeutung der veränderten Rollenverteilung zwischen Mann und Frau, die zunehmende Frauenerwerbsbeteiligung und die Folgen der ehelichen Arbeitsteilung für die Stabilität der Ehe. Die Arbeit betrachtet die Ehescheidung außerdem aus der Perspektive der Austauschtheorie und beleuchtet schließlich die subjektiven Sichtweisen der Betroffenen auf die Gründe für Scheidungen.
Schlüsselwörter
Ehescheidung, Scheidungsentwicklung, Scheidungsrecht, Zerrüttungsprinzip, Rolle der Frau, eheliche Arbeitsteilung, Strukturwandel der Ehe, Austauschtheorie, Scheidungsursachen, gesellschaftlicher Wandel, Wertewandel, Individualisierung, Selbstentfaltung
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich die Scheidungsrate in Deutschland seit 1950 entwickelt?
Die Scheidungshäufigkeit ist seit Ende des 19. Jahrhunderts kontinuierlich gestiegen; heute wird in Deutschland etwa jede dritte Ehe geschieden.
Was ist das Zerrüttungsprinzip?
Das 1977 eingeführte Prinzip besagt, dass eine Ehe geschieden werden kann, wenn sie gescheitert ist, ohne dass einem Partner eine Schuld zugewiesen werden muss.
Welchen Einfluss hat der Wertewandel auf Ehescheidungen?
Individuelle Selbstentfaltung und veränderte Ansprüche an die Partnerschaft haben traditionelle Normen wie lebenslange Treue zunehmend abgelöst.
Wie beeinflusst die Erwerbstätigkeit von Frauen das Scheidungsrisiko?
Zunehmende ökonomische Unabhängigkeit durch Frauenerwerbstätigkeit ermöglicht es Frauen eher, unglückliche Ehen zu beenden.
Was erklärt die Austauschtheorie bei Scheidungen?
Sie betrachtet die Ehe als Kosten-Nutzen-Verhältnis: Übersteigen die Belastungen die Vorteile und gibt es attraktive Alternativen, steigt die Scheidungswahrscheinlichkeit.
- Quote paper
- Christian Ladda (Author), 2004, Ehescheidungen - Daten und Ursachen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28488