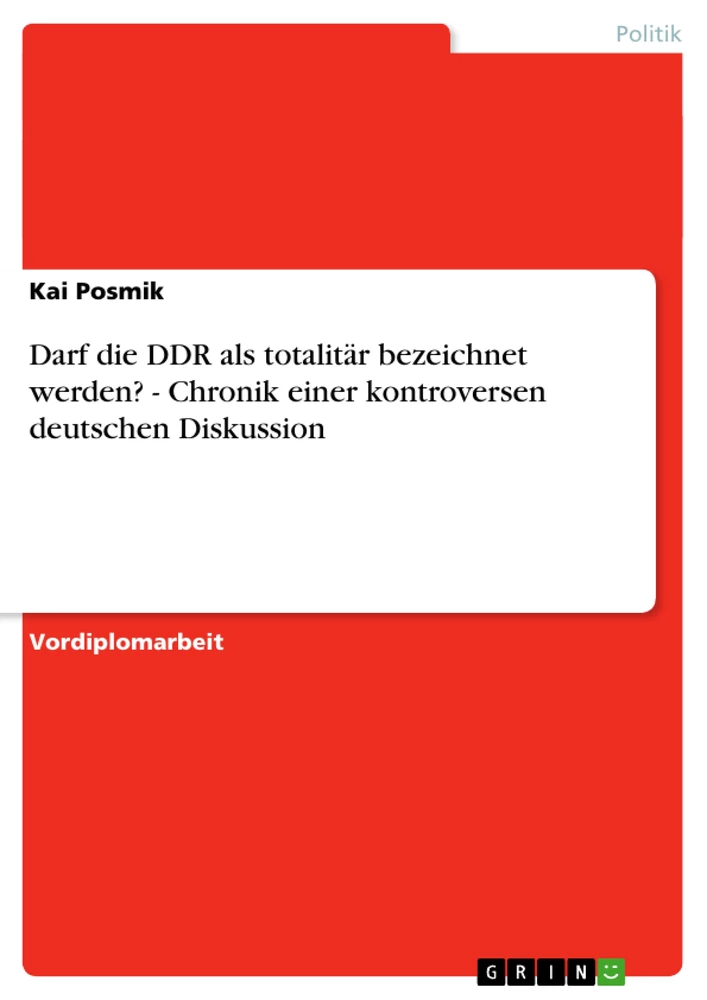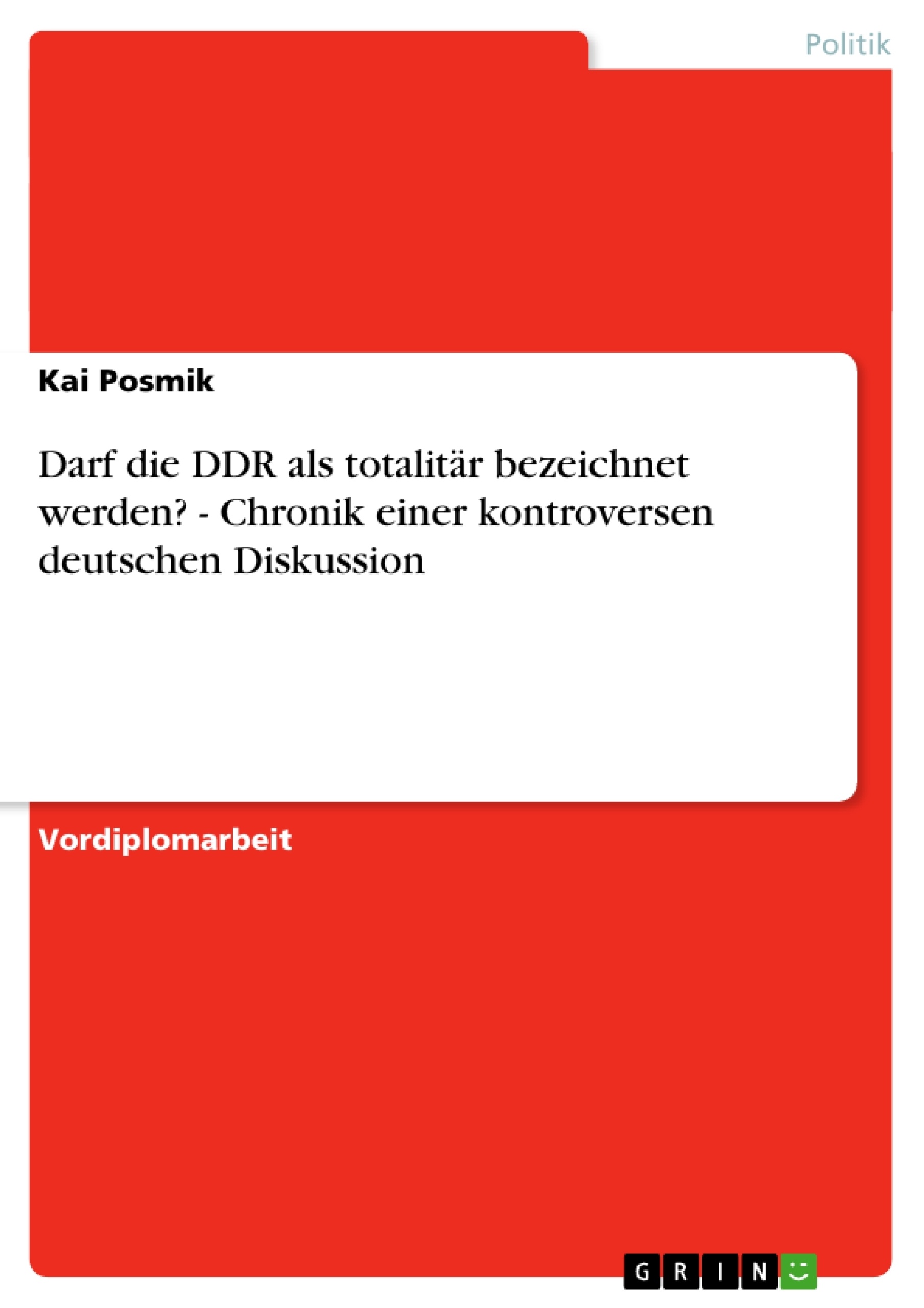Einleitung
Wenn Karl-Heinz Roth im Untertitel seines Buches von der „Wiedergeburt der Totalitarismustheorie“ 2 spricht, dann impliziert er damit, dass es so eine allgemein gültige und anerkannte Theorie geben würde, auf die sich alle – positive wie negative – Kritik konzentriert. Dass dem nicht so ist, weiß Roth natürlich genau, womit man beim Dilemma angekommen wäre, welchem die Totalitarismusdebatte seit Jahrzehnten unterliegt: Erstens gibt es nicht die allgemein anerkannte, unangefochten stehende Theorie. „Die Zahl der Totalitarismusansätze ist Legion“,3 um mit Eckhard Jesse zu sprechen. Eine große Anzahl von Personen hat sich mit dem Thema befasst: Politologen, Historiker, Psychologen, Germanisten, Juristen oder einfach nur Interessierte, die Liste ließe sich fortsetzen. Eine integrative Totalitarismusforschung steht noch aus4 und ist auch nötig, wenn man die bis heute bestehende inter- und intradisziplinäre Zerstrittenheit betrachtet. Zweitens: Das Wort Totalitarismus polarisiert die Diskutanten, wie kaum ein anderer gesellschaftswissenschaftlicher Begriff. Loben die einen die Möglichkeiten des Vergleiches von Herrschaftssystemen angeblich gleicher Struktur, und fordern auf zum antitotalitären Konsens, um die Demokratie zu schützen,5 werfen wiederum die anderen den einen Gleichsetzung unterschiedlichster Systeme und damit vor allem Nivellierung nationalsozialistischer Verbrechen vor,6 bzw. bemängeln die Abhängigkeit des Begriffs von der aktuellen „politischen Wetterlage“. Oder, und damit sind wir wieder bei Karl-Heinz Roth, die Befürworter einer Verwendung des Totalitarismusbegriffs werden per se in die (neu-) rechte Ecke gestellt, beziehungsweise, wenn sie ehedem einmal dem Totalitarismusbegriff negativ gegenüberstanden, ihn inzwischen aber befürworten, als „nekrophile Renegaten“ bezeichnet.7 Deswegen kann Roth auch von der Totalitarismustheorie sprechen, für ihn gibt es tatsächlich nur eine, nämlich die, welcher er den Kampf angesagt hat. Eine besondere Bedeutung hat die Diskussion von je her in Deutschland, welches innerhalb eines Jahrhunderts gleich zwei solcher totalitärer Diktaturen erlebte, eine von rechts und eine von links, jedenfalls sagen das die einen. Das sehen die anderen nun wieder gar nicht gerne, sie befürchten, dass durch den Vergleich von Drittem Reich und DDR ein Gleichsetzen beider politischer Systeme erfolgt. Dies ist der Kern eines Streits, den diese Hausarbeit zum Thema hat...
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Grundlegungen
- B. I. Zur Genese eines kontroversen Begriffs
- B. II. Erste theoretische Konzeptionen
- B. III. Drei klassische Totalitarismustheorien
- C. Darf die DDR als totalitär bezeichnet werden?
- C. I. Die „lebendige Totalitarismustheorie“
- C. II. Totalitarismus vs. systemimmanenter Ansatz
- C. III. Der ostdeutsche „Konsens“
- C. IV. Die Diskussion seit dem Untergang der DDR
- D. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der kontroversen Frage, ob die DDR als totalitäres System bezeichnet werden darf. Sie analysiert die Diskussion um den Begriff des Totalitarismus und seine Anwendung auf die DDR in einem chronologischen Überblick, beginnend mit der Entstehung des Begriffs bis hin zu aktuellen Debatten.
- Die Genese und Entwicklung des Totalitarismusbegriffs
- Die Anwendung des Totalitarismuskonzepts auf die DDR in der Bundesrepublik Deutschland
- Die Kritik am Totalitarismusansatz und alternative Perspektiven auf die DDR
- Die Diskussion um den Totalitarismusbegriff nach dem Fall der Mauer
- Die Rolle von Politikwissenschaftlern in der Debatte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und erläutert das Dilemma, dem die Totalitarismusdebatte seit Jahrzehnten unterliegt: Es gibt keine allgemein gültige und anerkannte Theorie des Totalitarismus, und der Begriff polarisiert die Diskutanten. Die Hausarbeit untersucht die Diskussion über die Anwendung des Begriffs auf die DDR in vier Zeitabschnitten, wobei der Fokus auf der Entwicklung der Debatte in der Bundesrepublik Deutschland liegt.
Die Kapitel „Grundlegungen“ befassen sich mit der Entstehung des Begriffs Totalitarismus, ersten theoretischen Konzeptionen und drei klassischen Totalitarismustheorien.
Das Kapitel „Darf die DDR als totalitär bezeichnet werden?“ analysiert die Anwendung des Totalitarismuskonzepts auf die DDR in der Bundesrepublik Deutschland und betrachtet die Entwicklung der Diskussion vor 1989. Es werden die unterschiedlichen Perspektiven und Argumente von Wissenschaftlern aus der Bundesrepublik und der DDR beleuchtet.
Schlüsselwörter
Totalitarismus, DDR, Bundesrepublik Deutschland, politische Systeme, Herrschaft, Diskussion, Kontroverse, Geschichte, Politikwissenschaft, Systemimmanenz, Historisierung, SED-Diktatur, Geschichtsrevisionismus, Ideologie, Politische Religion.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Bezeichnung der DDR als "totalitär" so umstritten?
Die Debatte ist umstritten, weil Kritiker befürchten, dass ein Vergleich zwischen dem Dritten Reich und der DDR zu einer Gleichsetzung und damit zu einer Relativierung nationalsozialistischer Verbrechen führen könnte.
Was ist der Kern der Totalitarismustheorie?
Die Theorie versucht, Herrschaftssysteme mit ähnlichen Strukturen (wie Einparteienherrschaft und umfassende Ideologie) zu vergleichen, um demokratische Systeme besser zu schützen.
Was bedeutet der "systemimmanente Ansatz" in der DDR-Forschung?
Dieser Ansatz versucht, die DDR aus ihren eigenen Strukturen und Logiken heraus zu verstehen, anstatt sie primär durch den Vergleich mit westlichen Demokratien oder dem Nationalsozialismus zu bewerten.
Wie hat sich die Diskussion nach dem Fall der Mauer verändert?
Nach 1989 kam es zu einer "Wiedergeburt" der Totalitarismustheorie, da neue Archivzugänge und die Aufarbeitung der SED-Diktatur die Debatte über die Natur des ostdeutschen Staates neu entfachten.
Gibt es eine allgemein anerkannte Theorie des Totalitarismus?
Nein, es gibt eine Vielzahl von Ansätzen von Politologen, Historikern und Juristen, aber eine integrative, unangefochtene Theorie steht bis heute aus.
- Citar trabajo
- Kai Posmik (Autor), 2003, Darf die DDR als totalitär bezeichnet werden? - Chronik einer kontroversen deutschen Diskussion, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28501