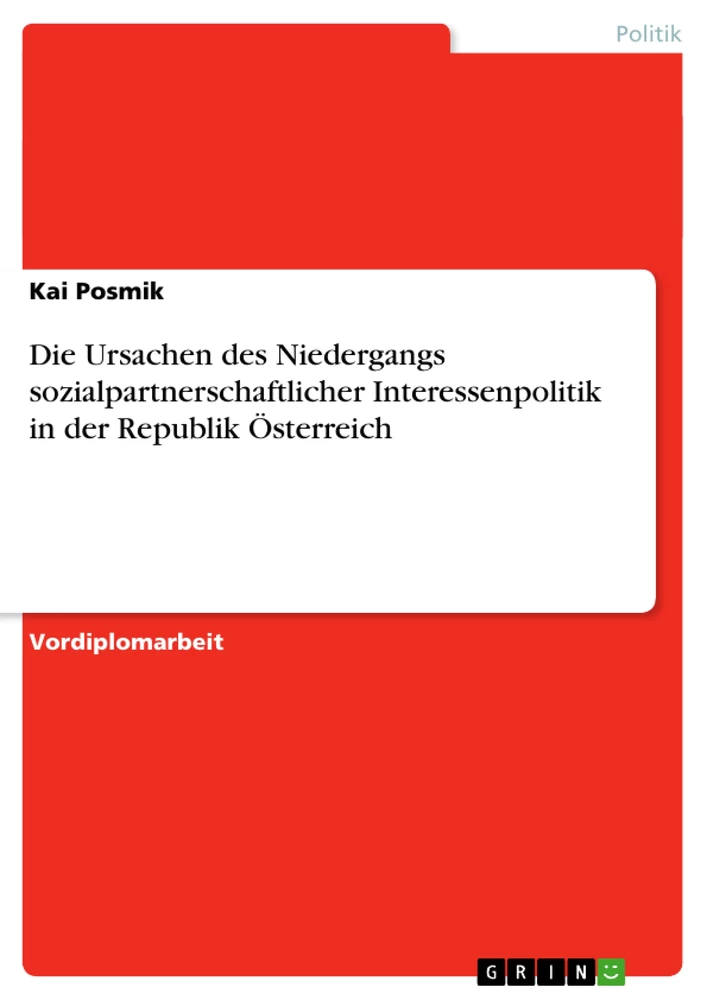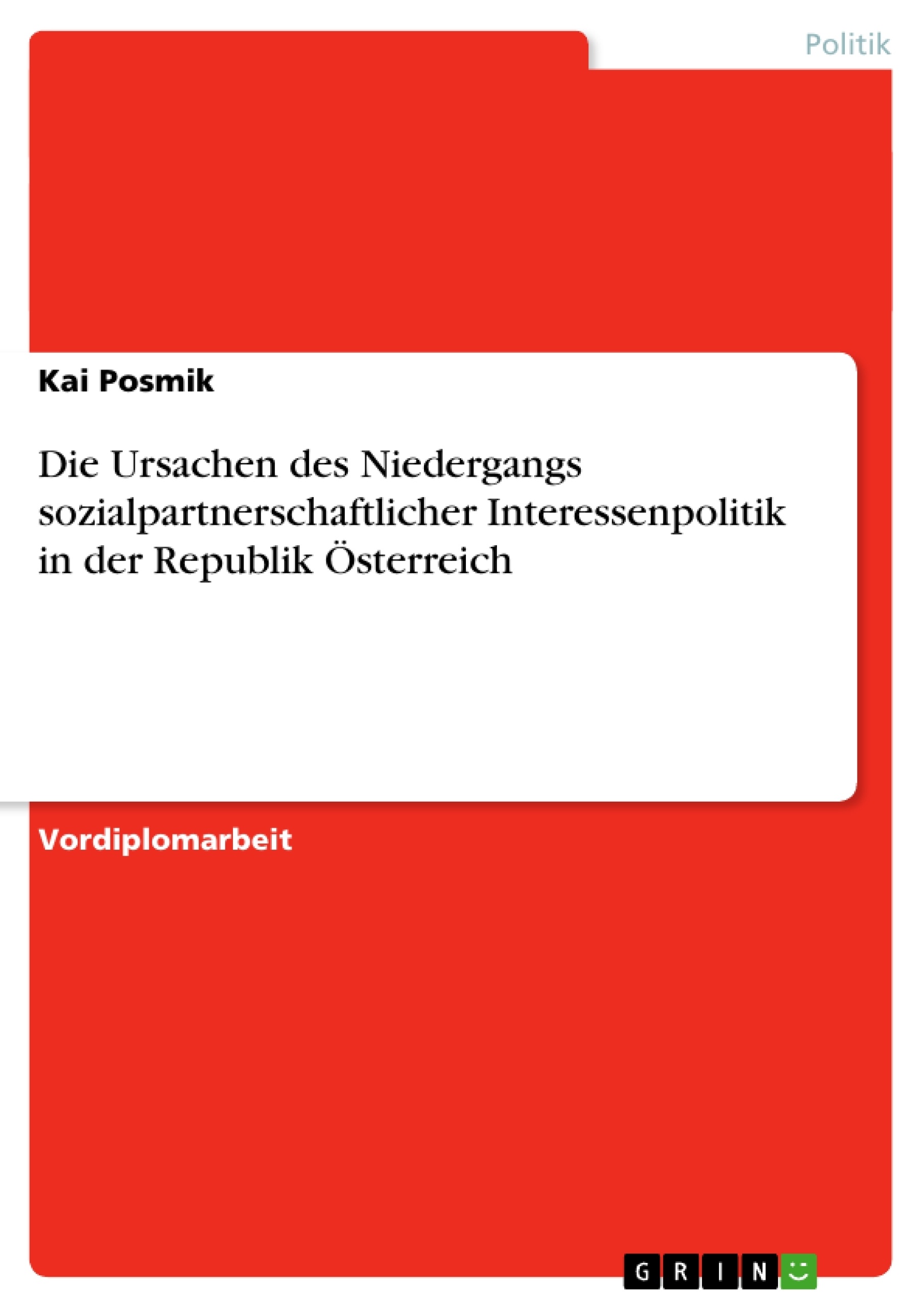Einleitung
Dass die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Österreich viel verbindet – im Guten wie im Schlechten – bedarf keiner näheren Erläuterung: Die Sprache wird jedem sofort einfallen, ein ähnlicher kultureller Hintergrund, gemeinsam erlebte und durchlittene Geschichte... Seit dem 4. Februar 2000 haben Deutsche und Österreicher nun noch eine kleine Gemeinsamkeit mehr, nämlich die Nutzung des Wortes „Wende“1, als Bezeichnung für eine einschneidende politische Änderung in beiden Staaten. An diesem Tag ging die Österreichische Volkspartei (ÖVP) mit der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) eine Regierungskoalition auf Bundesebene ein. Nicht dass dieses Ereignis mit jener politischen Wende in der ehemaligen DDR und der sich daran anschließenden Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten vergleichbar wäre, bei allem Respekt vor der Alpenrepublik. Erst recht wenn man bedenkt, dass die FPÖ ja schon im Jahre 1983 mit den österreichischen Sozialdemokraten koalierte. Der Begriff Wende ist in Österreich auch nicht alleine deshalb gewählt worden, weil mit Jörg Haider ein Politiker mit polarisierenden politischen Ansichten die Parteilinie der FPÖ bestimmt und damit nun auch über Einfluss auf die Bundesregierung verfügt.
Die Nutzung des Wende-Begriffes zielte vor allem auf ein Phänomen ab, welchem die neue Regierung namentlich den Kampf ansagte: Dem korporatistischen Arrangement der Sozialpartnerschaft, als eine österreichische Form der Interessenvermittlung und Interessenpolitik, welche die Wirtschafts- und Sozialpolitik seit den 60er Jahren mitbestimmte und mitgestaltete. Ob die Nutzung des Wortes Wende zur Charakterisierung der Vorgänge in Österreich jedoch geeignet ist, scheint eher zweifelhaft. Denn auch wenn es mit der ÖVP/FPÖ-Koalition zweifellos zu einer Intensivierung des Rückgangs der Sozialpartnerschaft, als Element der jahrzehntelang stabilen Konkordanzdemokratie in der Österreich gekommen ist, so assoziiert doch der Wende-Begriff, dass die von ihm beschriebene Änderung nicht nur intensiv, sondern auch relativ zeitnah erfolgt. Dass aber gerade letzteres nicht der Fall ist, dass vielmehr die einschneidenden Veränderungen des sozialpartnerschaftlichen Gefüges sich über einen Zeitraum von fast zwei Jahrzehnten entwickelten und die ÖVP/FPÖ-Regierung daran nur anknüpfen brauchte, soll der Gegenstand dieser Arbeit sein. Dabei ist die Frage zu beantworten, worin letztendlich die Gründe für den sozialpartnerschaftlichen Niedergang zu suchen sind...
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Das Phänomen der Sozialpartnerschaft in Österreich
- I. Begriff und Neo-Korporatismus
- II. Herausformung und Voraussetzungen der Sozialpartnerschaft
- C. Ursachen des Niedergangs sozialpartnerschaftlicher Interessenpolitik
- I. Veränderung des Umfeldes
- II. Veränderungen innerhalb der Dachverbände
- III. Abnehmende Verflechtung zwischen Verbänden und Parteien
- D. Die Sozialpartnerschaft unter der ÖVP/FPÖ-Bundesregierung
- E. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ursachen des Niedergangs der Sozialpartnerschaft in Österreich. Sie stellt die Frage, warum das korporatistische Arrangement, das die Wirtschafts- und Sozialpolitik seit den 60er Jahren mitbestimmte, an Einfluss verloren hat.
- Entwicklung und Merkmale der Sozialpartnerschaft in Österreich
- Einflussfaktoren auf den Niedergang der Sozialpartnerschaft
- Veränderungen im sozioökonomischen Umfeld
- Entwicklungen innerhalb der Dachverbände
- Verändertes Verhältnis zwischen Verbänden und Parteien
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel B: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff der Sozialpartnerschaft in Österreich und setzt ihn in den Kontext des Neo-Korporatismus. Es beschreibt die Herausbildung und die Voraussetzungen dieses Systems der Interessenvermittlung.
- Kapitel C: Kapitel C befasst sich mit den Ursachen des Niedergangs der Sozialpartnerschaft. Es analysiert die Veränderungen im Umfeld, innerhalb der Dachverbände und im Verhältnis zwischen Verbänden und Parteien, die zu einem Rückgang des Einflusses der Sozialpartner geführt haben.
- Kapitel D: Dieses Kapitel untersucht die Rolle der ÖVP/FPÖ-Bundesregierung im Kontext des Niedergangs der Sozialpartnerschaft. Es beleuchtet, inwiefern die neue Regierung den Prozess der Abnahme sozialpartnerschaftlicher Einflussnahme beschleunigt und intensiviert hat.
Schlüsselwörter
Sozialpartnerschaft, Neo-Korporatismus, Österreich, Interessenpolitik, Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, Dachverbände, Parteien, ÖVP/FPÖ-Bundesregierung, Veränderungen, Rückgang, Einfluss, Konfrontation, Kooperation.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter der "Sozialpartnerschaft" in Österreich?
Ein korporatistisches System der Interessenpolitik zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern und dem Staat, das die Wirtschafts- und Sozialpolitik seit den 60ern prägte.
Warum wird im Zusammenhang mit der ÖVP/FPÖ-Regierung von einer "Wende" gesprochen?
Der Begriff zielt auf die bewusste Abkehr vom jahrzehntelangen System der Sozialpartnerschaft und den Übergang zu einer konfrontativeren Politik ab.
Was sind die Ursachen für den Niedergang dieses Systems?
Ursachen liegen in veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, internen Entwicklungen der Dachverbände und einer abnehmenden Verflechtung zwischen Verbänden und Parteien.
Ist der Niedergang der Sozialpartnerschaft ein plötzliches Ereignis?
Nein, die Arbeit zeigt, dass sich diese Veränderungen über fast zwei Jahrzehnte entwickelten und die Regierung von 2000 nur an bestehende Trends anknüpfte.
Was bedeutet Neo-Korporatismus?
Die Institutionalisierung der Zusammenarbeit zwischen großen gesellschaftlichen Gruppen (Verbänden) und der staatlichen Verwaltung zur Steuerung von Politik.
- Citation du texte
- Kai Posmik (Auteur), 2004, Die Ursachen des Niedergangs sozialpartnerschaftlicher Interessenpolitik in der Republik Österreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28502