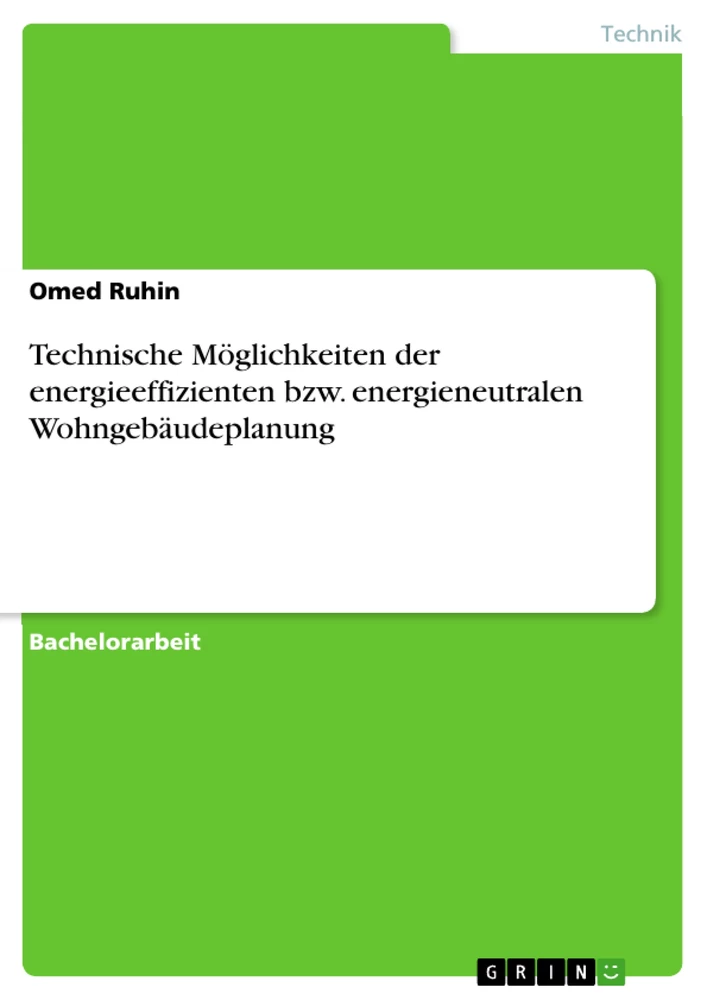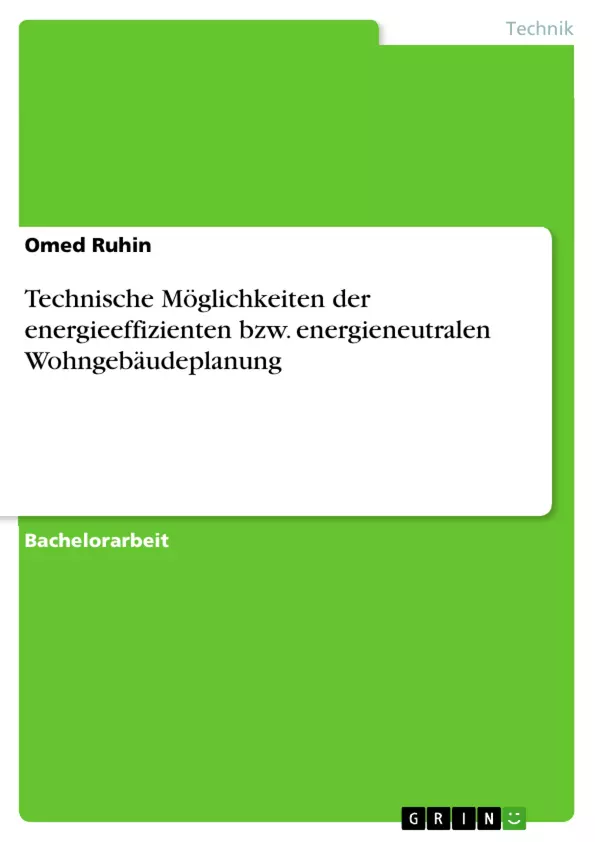Die „Energiewende“ ist aus der politischen und gesellschaftlichen Diskussion nicht mehr wegzu-denken. Dabei hat der Begriff nach dem Super-GAU im japanischen Fukushima und der damit verbundenen Ankündigung zum Atomausstieg massiven Einzug in die öffentliche Diskussion gefunden. In dem Ende 2013 ausgehandelten, fast 200 Seiten starkem Koalitionsvertrag zwischen der CDU/CSU und der SPD wird der Begriff 32-mal erwähnt.1 Dort wird folgende Ausführung dargelegt: „Die Senkung des Energieverbrauchs durch mehr Energieeffizienz muss als zentraler Bestandteil der Energiewende mehr Gewicht erhalten. Fortschritte bei der Energieeffizienz erfordern einen sektorübergreifenden Ansatz, der Gebäude, Industrie, Gewerbe und Haushalte umfasst und dabei Strom, Wärme und Kälte gleichermaßen in den Blick nimmt. Ausgehend von einer technisch-wirtschaftlichen Potenzialanalyse wollen wir Märkte für Energieeffizienz entwickeln und dabei alle Akteure einbinden.“2 Fast in einem Atemzug mit dem Begriff „Energiewende“ wird der Einsatz und Ausbau von „Erneuerbaren Energien“ genannt, gefordert und gefördert, wobei der Rahmen von dem Erneuerbare Energie Gesetz (EEG) festgesteckt ist. Die Umgestaltung der lokalen wie auch globalen Energiesysteme stellt eine in ihrem vollen Umfang kaum zu erfassende Herausforderung dar, die in den kommenden Jahrzehnten gemeistert werden muss, wenn man den wachsenden Energiebedarf entgegentreten will. Mit der Industriellen Revolution stieg der Bedarf an Energie immens und es fand ein fundamentaler Wandel statt.3 Um den in diesen Zeitraum enorm gestiegenen Energiebedarf zu stillen, konnte nicht mehr wie zuvor auf nachhaltige Quellen, wie z.B. Holz, zurückgegriffen werden, sondern es bedurfte der Erschließung neuer Ressourcen, den sogenannten fossilen Brennstoffen. Naturgemäß sind diese in Jahrmillionen entstandenen Rohstoffe nur im begrenzten Maße zugänglich und somit endlich. In einem im Vergleich zum Entstehungsprozess der Rohstoffe extrem kurzen Zeitraum von wenigen hundert Jahren ist ein großer Anteil dieser Ressourcen schon jetzt aufgebraucht. Gleichzeitig einhergehend mit der Verknappung der fossilen Brennstoffe, wächst die Weltbevölkerung jedes Jahr um ca. 70 Millionen Menschen, sodass man im Jahr 2050 eine Weltbevölkerungszahl von ca. 9 Milliarden Menschen zu erwarten hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Vorstellung, Definition und Abgrenzung von Grundbegriffen
- 2.1 Energie
- 2.1.1 Primär-, Sekundär-, End-, Nutzenergie und graue Energie
- 2.1.2 Quantitative und physikalische Größen
- 2.1.3 Energiefaktoren und Wirkungsgrad
- 2.1.4 Größen in der Energieeinsparverordnung
- 2.2 Fossile Energie
- 2.3 Erneuerbare bzw. regenerative Energien
- 2.1 Energie
- 3 Energiebilanzen von Wohnhäusern und Wohnhaus-Standards
- 3.1 KfW-Effizienzhausstandard
- 3.2 Passivhaus-Standard
- 3.3 Nullenergiehaus, Nullheizenergiehaus, Plusenergiehaus und energieautarkes Haus
- 3.4 Energieeffizienzklassen
- 4 Methoden zur Verbesserung der Energieeffizienz und deren physikalischen Grundlagen
- 4.1 Baustoffe - Konstruktion -Dämmung
- 4.2 Gebäudetechnik – Lüftung mit Wärmerückgewinnung
- 4.3 Kraft-Wärme-Kopplung - Blockheizkraftwerk
- 4.4 Geothermie - Wärmepumpe
- 4.4.1 Kompressionswärmepumpe
- 4.4.2 Absorptionswärmepumpe
- 4.4.3 Wasser-Wasser-/Sole-Wasser-/Luft-Wasser-Wärmepumpe
- 4.5 Energiespeicher
- 4.5.1 Wärmespeicher bzw. thermische Speicher
- 4.6 Solare Energie
- 4.6.1 Solarthermie
- 4.6.2 Photovoltaik
- 4.7 Windenergie
- 5 Vergleichsrechnung verschiedener Standards
- 5.1 Wärmeschutzmaßnahmen mit deren Mehrkosten zum EnEV-Standard
- 5.2 Heizungssysteme im Vergleich
- 6 Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die effiziente Gestaltung von Wohngebäuden im Hinblick auf den Energieverbrauch. Sie untersucht moderne Methoden und deren physikalischen Grundlagen, um die Energieeffizienz bis hin zur Energieneutraltät zu verbessern.
- Analyse der Energiebilanzen von Wohngebäuden
- Bewertung verschiedener Standards für energieeffizientes Bauen (KfW-Effizienzhaus, Passivhaus, Nullenergiehaus)
- Untersuchung von Methoden zur Verbesserung der Energieeffizienz, wie z.B. Wärmedämmung, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Kraft-Wärme-Kopplung und erneuerbare Energien
- Vergleich verschiedener Heizungssysteme und deren Kosten
- Zusammenfassung und Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Bereich der energieeffizienten Wohngebäudeplanung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung und führt in das Thema der energieeffizienten Wohngebäudeplanung ein. Das zweite Kapitel definiert wichtige Grundbegriffe wie Energie, fossile Energie und erneuerbare Energien. Im dritten Kapitel werden Energiebilanzen von Wohnhäusern und verschiedene Standards für energieeffizientes Bauen vorgestellt. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit Methoden zur Verbesserung der Energieeffizienz und deren physikalischen Grundlagen, einschließlich Baustoffen, Gebäudetechnik, Kraft-Wärme-Kopplung, Geothermie, Energiespeichern und erneuerbaren Energien. Das fünfte Kapitel präsentiert eine Vergleichsrechnung verschiedener Standards, die auf die Kosten für Heizung und Warmwasser eingeht. Abschließend bietet das sechste Kapitel eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Schlüsselwörter
Energieeffizienz, Wohngebäudeplanung, Energieneutraltät, Energiebilanzen, KfW-Effizienzhaus, Passivhaus, Nullenergiehaus, Wärmedämmung, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Kraft-Wärme-Kopplung, Geothermie, Wärmepumpe, Energiespeicher, Solare Energie, Photovoltaik, Windenergie, Heizungssysteme, Kostenvergleich.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel einer energieneutralen Wohngebäudeplanung?
Das Ziel ist die Senkung des Energieverbrauchs durch maximale Effizienz und die Nutzung regenerativer Quellen, um Gebäude zu schaffen, die ihre Energiebilanz selbst ausgleichen.
Welche Standards für energieeffizientes Bauen werden unterschieden?
Die Arbeit betrachtet unter anderem den KfW-Effizienzhausstandard, den Passivhaus-Standard sowie Nullenergie- und Plusenergiehäuser.
Welche technischen Methoden verbessern die Energieeffizienz?
Dazu zählen hochwertige Wärmedämmung, Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, Kraft-Wärme-Kopplung sowie der Einsatz von Wärmepumpen und Photovoltaik.
Was versteht man unter "Grauer Energie"?
Graue Energie ist die Energiemenge, die für die Herstellung, den Transport, die Lagerung und die Entsorgung eines Baustoffs oder Produkts benötigt wird.
Warum ist die Energiewende im Gebäudesektor so wichtig?
Da fossile Brennstoffe endlich sind und die Weltbevölkerung wächst, muss der Energieverbrauch in Haushalten massiv gesenkt werden, um den globalen Bedarf nachhaltig zu decken.
- Citation du texte
- Omed Ruhin (Auteur), 2014, Technische Möglichkeiten der energieeffizienten bzw. energieneutralen Wohngebäudeplanung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/285033