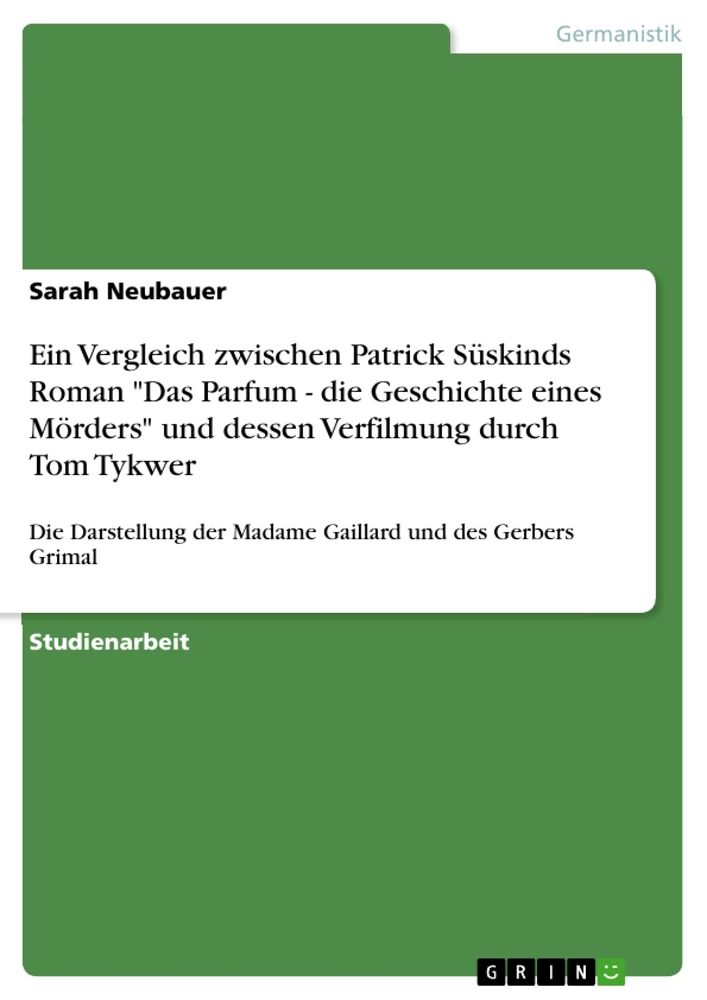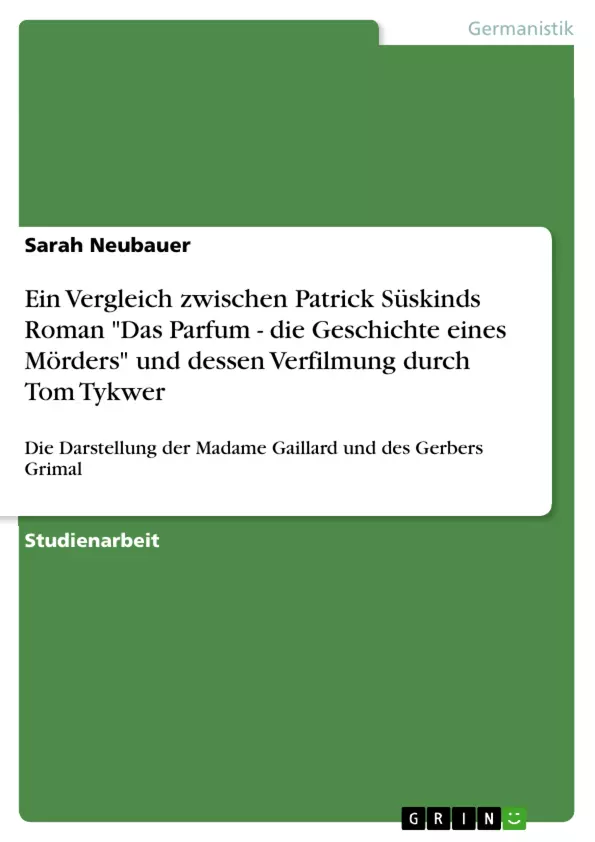Das Phänomen Literaturverfilmung ist bereits seit der Stummfilmzeit präsent und nahm ab den 1910er Jahren durch das Etablieren des Kinos als neue Medienform zu. Mitte der 70er Jahre befanden sich die Literaturverfilmungen dann in einer Krise, nachdem viele Klassiker der Literatur neu verfilmt worden waren und die Stoffe demzufolge erschöpft waren. Das deutsche Gegenwartskino ist dagegen stark von Literaturverfilmungen geprägt und lässt dabei zwei Tendenzen erkennen: die schnelle Verfilmung neuer Stoffe, sowie die Neuverfilmung von Klassikern.
So wurde auch der in Deutschland und international sehr erfolgreiche Roman "Das Parfum - die Geschichte eines Mörders" von Patrick Süskind unter der Regie von Tom Tykwer verfilmt und ist im Jahre 2006 in Deutschland erschienen. Bei der Übertragung des literarischen Stoffes in einen filmischen handelt es sich um einen Medientransfer, welcher sich nicht nur aufgrund der Tatsache, dass es sich bei Literatur und Film um unterschiedliche Medien mit unterschiedlichem Charakter handelt, als schwierig erweist. Während ein Roman üblicherweise einen Umfang von etwa 100-1000 Seiten aufweist, ist ein Film in der Regel 90-120 Minuten lang. Deshalb kommt es bei der filmischen Adaption eines literarischen Stoffes unweigerlich zu Kürzungen, sowie zu Streichungen beziehungsweise Auslassungen, aber auch zu Ergänzungen.
Aufgrund dieser Problematik soll anhand der Figuren der Madame Gaillard und des Gerbers Grimal aufgezeigt werden, inwieweit sich die Darstellung beider Charaktere gleicht und in welchen Aspekten sie sich unterscheidet. Dabei soll auch berücksichtigt werden, aus welchen Gründen im Film Veränderungen an den Figuren im Vergleich zur Buchvorlage vorgenommen wurden.
Hierfür wird zunächst die Darstellung der Madame Gaillard in Patrick Süskinds Roman (2.1) und anschließend die Umsetzung der Figur im Film von Tom Tykwer (2.2) beschrieben. Der nächste Schritt dient dann dazu, die Repräsentation der Figur in Literatur und Film miteinander zu vergleichen (2.3), um Unterschiede und Gemeinsamkeiten festzustellen.
Um dies zu verdeutlichen, wird auf gleiche Weise die Darstellung des Gerbers Grimals zunächst in der literarischen Vorlage (3.1) und anschließend in der filmischen Umsetzung (3.2) analysiert. Schließlich soll beides erneut miteinander abgeglichen und verglichen werden (3.3).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Darstellung der Madame Gaillard in Buch und Film
- Die Darstellung der Madame Gaillard in Patrick Süskinds Roman
- Die Darstellung der Madame Gaillard in Tom Tykwers Film
- Vergleich der Darstellung der Madame Gaillard zwischen Buch und Film
- Die Darstellung des Gerbers Grimal in Buch und Film
- Die Darstellung des Gerbers Grimal in Patrick Süskinds Roman
- Die Darstellung des Gerbers Grimal in Tom Tykwers Film
- Vergleich der Darstellung des Gerbers Grimal zwischen Buch und Film
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die filmische Adaption von Patrick Süskinds Roman "Das Parfum" durch Tom Tykwer. Im Fokus stehen die Charaktere der Madame Gaillard und des Gerbers Grimal, wobei der Vergleich ihrer Darstellung in Buch und Film im Vordergrund steht. Die Arbeit analysiert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Figuren und untersucht die Gründe für die vorgenommenen Veränderungen im Film.
- Vergleich der Figurenzeichnung von Madame Gaillard und Gerber Grimal in Roman und Film
- Analyse der Unterschiede in der Darstellung der Charaktere und deren Motivationen
- Untersuchung der filmischen Adaption und der damit verbundenen Herausforderungen
- Bewertung der getroffenen Entscheidungen bei der filmischen Umsetzung
- Interpretation der Figuren im Kontext des Gesamtwerks
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Literaturverfilmung ein, beleuchtet die Herausforderungen des Medientransfers von Literatur zu Film und begründet die Auswahl der Figuren Madame Gaillard und Gerber Grimal für die vergleichende Analyse. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und die Methodik des Vergleichs zwischen Roman und Film.
Die Darstellung der Madame Gaillard in Buch und Film: Dieses Kapitel analysiert die Figur der Madame Gaillard, zunächst in Süskinds Roman und dann in Tykwers Film. Der Roman präsentiert Madame Gaillard als profitorientierte Leiterin eines Waisenhauses, deren Emotionslosigkeit und gnadenloser Gerechtigkeitssinn hervorgehoben werden. Der Fokus liegt auf der detaillierten Beschreibung ihrer Persönlichkeit, ihrer Vergangenheit und ihrer Motivationen. Der Vergleich mit ihrer filmischen Darstellung wird darauf aufbauend untersucht, indem Gemeinsamkeiten und Abweichungen der beiden Versionen erörtert werden. Die Analyse betrachtet, welche Aspekte der Romanfigur im Film erhalten blieben und welche verändert oder weggelassen wurden, sowie die Gründe für diese Änderungen.
Die Darstellung des Gerbers Grimal in Buch und Film: Analog zur Analyse von Madame Gaillard, untersucht dieses Kapitel die Figur des Gerbers Grimal, wiederum zunächst im Roman und anschließend im Film. Die Analyse konzentriert sich auf die Charakterisierung Grimals im Roman, seine Rolle in der Geschichte und seine Interaktion mit Grenouille. Der Fokus liegt auf den erzählerischen Mitteln, die Süskind einsetzt, um Grimal darzustellen. Im Anschluss wird die filmische Umsetzung analysiert, wobei die Änderungen im Vergleich zum Roman im Detail beleuchtet werden. Der Vergleich beider Darstellungen zeigt die unterschiedlichen Schwerpunkte und die jeweiligen Auswirkungen auf die Gesamtwirkung der Figur.
Schlüsselwörter
Literaturverfilmung, Patrick Süskind, Das Parfum, Tom Tykwer, Madame Gaillard, Gerber Grimal, Romanadaption, Figurenvergleich, Medientransfer, Filmsprache, Charakterisierung.
Häufig gestellte Fragen zu: Vergleich der Roman- und Filmadaption von "Das Parfum" (Süskind/Tykwer)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die filmische Adaption von Patrick Süskinds Roman "Das Parfum" durch Tom Tykwer. Der Fokus liegt auf einem detaillierten Vergleich der Charaktere Madame Gaillard und Gerber Grimal in Buch und Film. Untersucht werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung der Figuren, die Gründe für Veränderungen im Film und die Auswirkungen dieser Änderungen auf die Gesamtwirkung.
Welche Aspekte der Figuren Madame Gaillard und Gerber Grimal werden verglichen?
Der Vergleich umfasst die Figurenzeichnung, die Motivationen, die Rolle in der Geschichte und die Interaktion mit anderen Charakteren (insbesondere Grenouille). Untersucht werden die erzählerischen Mittel, die Süskind im Roman und Tykwer im Film verwenden, um die Figuren darzustellen. Es werden Gemeinsamkeiten und Abweichungen in der Darstellung beider Versionen erörtert und die Gründe für die vorgenommenen Änderungen im Film analysiert.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Herausforderungen des Medientransfers von Literatur zu Film, die Unterschiede in der Figurenzeichnung zwischen Roman und Film, die Analyse der Motivationen der Charaktere, die Untersuchung der filmischen Adaption und deren Herausforderungen, die Bewertung der getroffenen Entscheidungen bei der filmischen Umsetzung und die Interpretation der Figuren im Kontext des Gesamtwerks.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur Darstellung von Madame Gaillard und Gerber Grimal (jeweils im Roman und Film mit anschließendem Vergleich), und eine Zusammenfassung. Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Methodik. Die Kapitel zu Madame Gaillard und Gerber Grimal analysieren die Figuren separat im Roman und Film und vergleichen anschließend die Darstellungen. Schlüsselwörter werden abschließend genannt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Literaturverfilmung, Patrick Süskind, Das Parfum, Tom Tykwer, Madame Gaillard, Gerber Grimal, Romanadaption, Figurenvergleich, Medientransfer, Filmsprache, Charakterisierung.
Welche Methode wird zur Analyse verwendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Analysemethode. Sie vergleicht die Darstellung der Figuren Madame Gaillard und Gerber Grimal im Roman und im Film, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen und die Gründe für die vorgenommenen Veränderungen zu untersuchen. Der Fokus liegt auf der detaillierten Beschreibung der Figuren und der Analyse der erzählerischen Mittel in beiden Medien.
Welches Ziel verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die filmische Adaption von "Das Parfum" hinsichtlich der Darstellung der ausgewählten Figuren zu analysieren und die Entscheidungen des Regisseurs im Vergleich zur Romanvorlage zu bewerten. Es soll aufgezeigt werden, welche Aspekte der Romanfiguren im Film erhalten blieben, welche verändert oder weggelassen wurden und warum.
- Quote paper
- Sarah Neubauer (Author), 2014, Ein Vergleich zwischen Patrick Süskinds Roman "Das Parfum - die Geschichte eines Mörders" und dessen Verfilmung durch Tom Tykwer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/285066