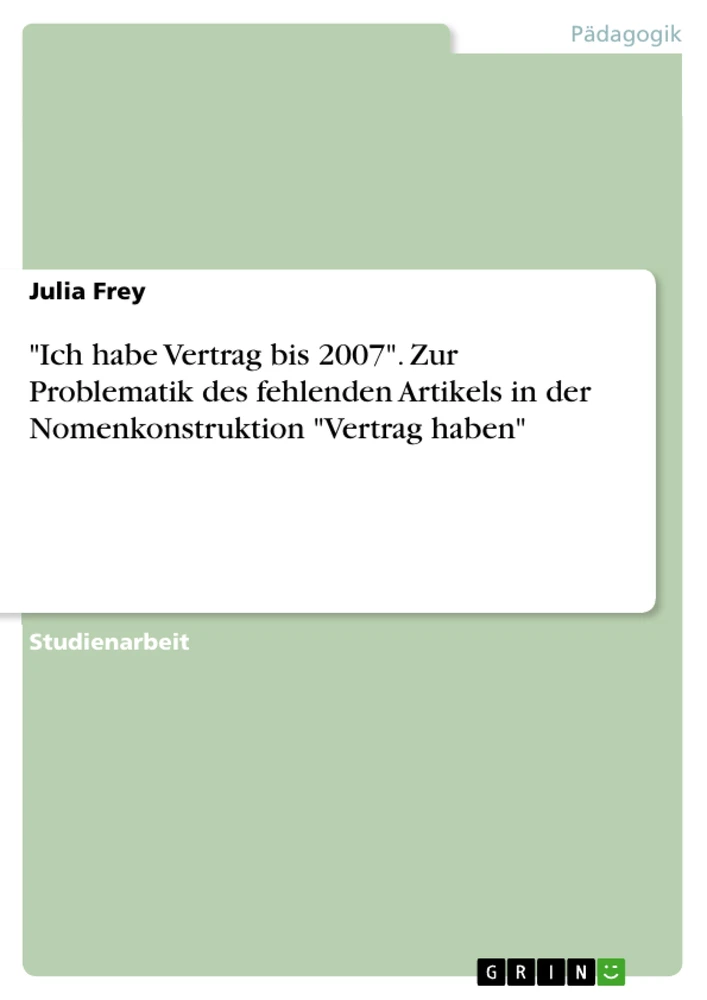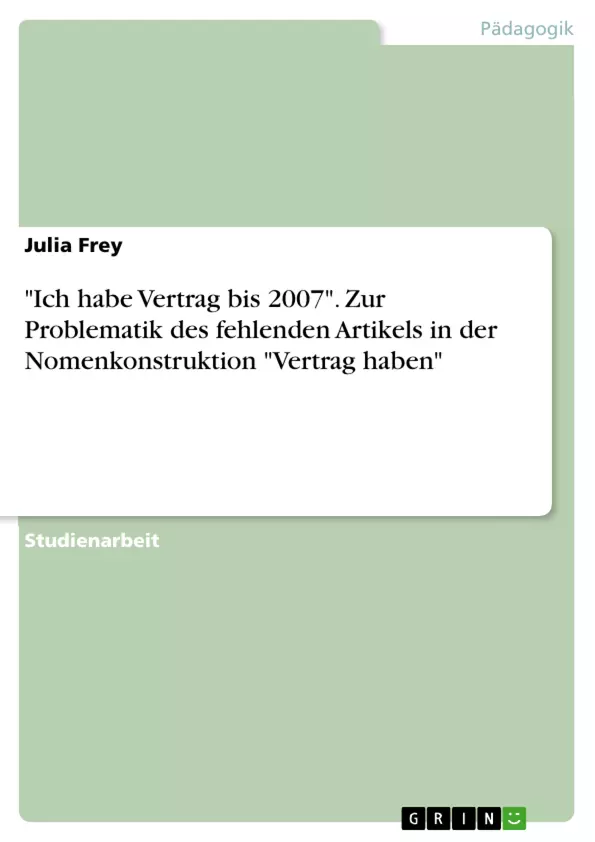Im Deutschen werden zählbare Nomen im Singular normalerweise nur in Begleitung eines Artikels verwendet, vgl.
(1-1) Ich habe ein Haus. (1-2) *Ich habe Haus.
Allerdings scheint es seit einiger Zeit möglich zu sein, dass das Nomen Vertrag in Konstruktionen wie „Warum sollte er gehen? Er hat Vertrag. [...]“ artikellos benutzt werden kann. Korpusrecherchen in Zeitungstexten aus den Jahren 1946 bis 2011 zeigen, dass solche Wendungen immer öfter vorkommen (Vgl. D’Avis und Finkbeiner 2013:215). Traten sie vor 20 Jahren eher selten auf, geht aus der 2000-2011-Korpusuntersuchung hervor, dass die artikellose Wendung hier fünf Mal häufiger zu finden ist als noch in dem 1990-1999-Korpus (Ebd.). Betrachtet man die Kontexte, in welchen diese Konstruktionen auftreten, so scheinen sie auf die vertragliche Bindung von Fußballspielern festgelegt zu sein. Fernerhin stellten D’Avis und Finkbeiner fest, dass die artikellose Variante die alternative Konstruktion mit indefinitem Artikel zu verdrängen scheint. Ist es auch Fakt, dass die artikellose Variante immer häufiger vorkommt, so stößt sie doch nicht auf vollständige Akzeptanz.....
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zählbare Nomen
- 2.1. Grundlegendes
- 2.2. Nominale Prädikate
- 2.3. Präpositionalphrasen
- 2.4. Inkorporationen
- 2.5. Funktionsverbgefüge
- 2.6. Zwischenfazit
- 3. Nicht zählbare Nomen
- 3.1. Stoffbezeichnungen und Massennomina
- 3.2. Abstrakta
- 3.2.1. Semantische Eigenschaften
- 3.2.2. Artikel vs. abstrakt
- 3.2.3. Pluralisierbarkeit
- 3.2.4. Zählbarkeit
- 3.3. Zwischenfazit
- 3.4. Überprüfung der Defizienz
- 4. Ambiguität
- 4.1. Grundlegendes
- 4.2. Kontextuelle Ambiguität
- 4.4. Zwischenfazit
- 5. Fazit
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Problematik des fehlenden Artikels in der Nominalkonstruktion „Vertrag haben“. Ziel ist es, die Gründe für die unterschiedliche Akzeptabilität dieser Konstruktion im Vergleich zu ähnlichen Wendungen wie „Hunger haben“ oder „Auto haben“ zu klären. Die Arbeit baut auf bestehenden Forschungsarbeiten auf und vertieft einzelne Aspekte.
- Der Gebrauch artikelloser zählbarer Nomen im Deutschen
- Die Rolle des Artikels in der Referentialität
- Analyse der Konstruktion „Vertrag haben“ im Kontext nominaler Prädikate
- Untersuchung der morphosyntaktischen Aspekte
- Das Konzept der Bedeutungsverschiebung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des artikellosen Gebrauchs des Nomens „Vertrag“ in Konstruktionen wie „Vertrag haben“ ein. Sie verweist auf die steigende Häufigkeit dieser Konstruktion in Korpora und stellt die Forschungsfrage nach den Gründen für die unterschiedliche Akzeptabilität im Vergleich zu anderen Wendungen. Die Arbeit stützt sich auf die Ergebnisse von D'Avis und Finkbeiner (2013) und erweitert deren Untersuchung.
2. Zählbare Nomen: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den Gebrauch artikelloser zählbarer Nomen im Deutschen. Es wird die Rolle des Artikels bei der Referentialität von Substantiven erläutert und die "bestimmten Bedingungen" für den artikellosen Gebrauch nach Duden (2009) und Eisenberg (1998) diskutiert. Zwei Typen des artikellosen Gebrauchs werden unterschieden: "globale" Kontexte (z.B. Schlagzeilen, Telegramme) und "lokale" Kontexte (nominale Prädikate, Präpositionalphrasen etc.). Das Kapitel legt den Grundstein für die spätere Analyse von "Vertrag haben".
3. Nicht zählbare Nomen: Dieses Kapitel befasst sich mit nicht zählbaren Nomen, insbesondere Stoffbezeichnungen und Abstrakta. Die Relativität des Begriffs "nicht zählbar" wird herausgestellt. Die Analyse zeigt, dass auch hier keine eindeutige Bilanz gezogen werden kann, was "Vertrag haben" als eine möglicherweise defekte Konstruktion erscheinen lässt, welche weiteren Tests unterzogen wird.
Schlüsselwörter
Artikel, zählbare Nomen, nicht zählbare Nomen, Nominalkonstruktion, Vertrag haben, Referentialität, Akzeptabilität, morphosyntaktische Gründe, Bedeutungsverschiebung, Soziolekt, Korpusforschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema "Artikellose Nominalkonstruktionen im Deutschen"
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Problematik des fehlenden Artikels in der Nominalkonstruktion „Vertrag haben“ im Deutschen. Sie analysiert die Gründe für die unterschiedliche Akzeptabilität dieser Konstruktion im Vergleich zu ähnlichen Wendungen wie „Hunger haben“ oder „Auto haben“ und baut auf bestehenden Forschungsarbeiten auf.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel ist die Klärung der Gründe für die unterschiedliche Akzeptabilität der Konstruktion „Vertrag haben“. Die Arbeit vertieft einzelne Aspekte bestehender Forschung und untersucht den Gebrauch artikelloser zählbarer Nomen im Deutschen, die Rolle des Artikels in der Referentialität und morphosyntaktische Aspekte.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Gebrauch artikelloser zählbarer Nomen, die Rolle des Artikels in der Referentialität, die Analyse der Konstruktion „Vertrag haben“ im Kontext nominaler Prädikate, morphosyntaktische Aspekte und das Konzept der Bedeutungsverschiebung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert: Einleitung, Zählbare Nomen (mit Unterkapiteln zu Grundlagen, nominalen Prädikaten, Präpositionalphrasen, Inkorporationen, Funktionsverbgefügen und einem Zwischenfazit), Nicht zählbare Nomen (mit Unterkapiteln zu Stoffbezeichnungen, Abstrakta, einem Zwischenfazit und der Überprüfung der Defizienz), Ambiguität (mit Unterkapiteln zu Grundlagen, Kontextueller Ambiguität und einem Zwischenfazit), Fazit und Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung.
Was wird in Kapitel 2 ("Zählbare Nomen") behandelt?
Kapitel 2 bietet einen Überblick über den Gebrauch artikelloser zählbarer Nomen. Es erläutert die Rolle des Artikels bei der Referentialität und diskutiert die Bedingungen für artikellosen Gebrauch basierend auf Duden (2009) und Eisenberg (1998). Es unterscheidet zwischen "globalen" und "lokalen" Kontexten und legt den Grundstein für die Analyse von "Vertrag haben".
Was wird in Kapitel 3 ("Nicht zählbare Nomen") behandelt?
Kapitel 3 befasst sich mit nicht zählbaren Nomen, insbesondere Stoffbezeichnungen und Abstrakta. Es betont die Relativität des Begriffs "nicht zählbar" und zeigt, dass auch hier keine eindeutige Bilanz für die Konstruktion "Vertrag haben" gezogen werden kann, was diese als möglicherweise defekte Konstruktion erscheinen lässt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Artikel, zählbare Nomen, nicht zählbare Nomen, Nominalkonstruktion, Vertrag haben, Referentialität, Akzeptabilität, morphosyntaktische Gründe, Bedeutungsverschiebung, Soziolekt, Korpusforschung.
Auf welchen Forschungsarbeiten baut die Arbeit auf?
Die Arbeit baut unter anderem auf den Ergebnissen von D'Avis und Finkbeiner (2013) auf und erweitert deren Untersuchung.
Welche Quellen werden zitiert?
Die Arbeit zitiert unter anderem Duden (2009) und Eisenberg (1998).
- Citar trabajo
- Julia Frey (Autor), 2014, "Ich habe Vertrag bis 2007". Zur Problematik des fehlenden Artikels in der Nomenkonstruktion "Vertrag haben", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/285109