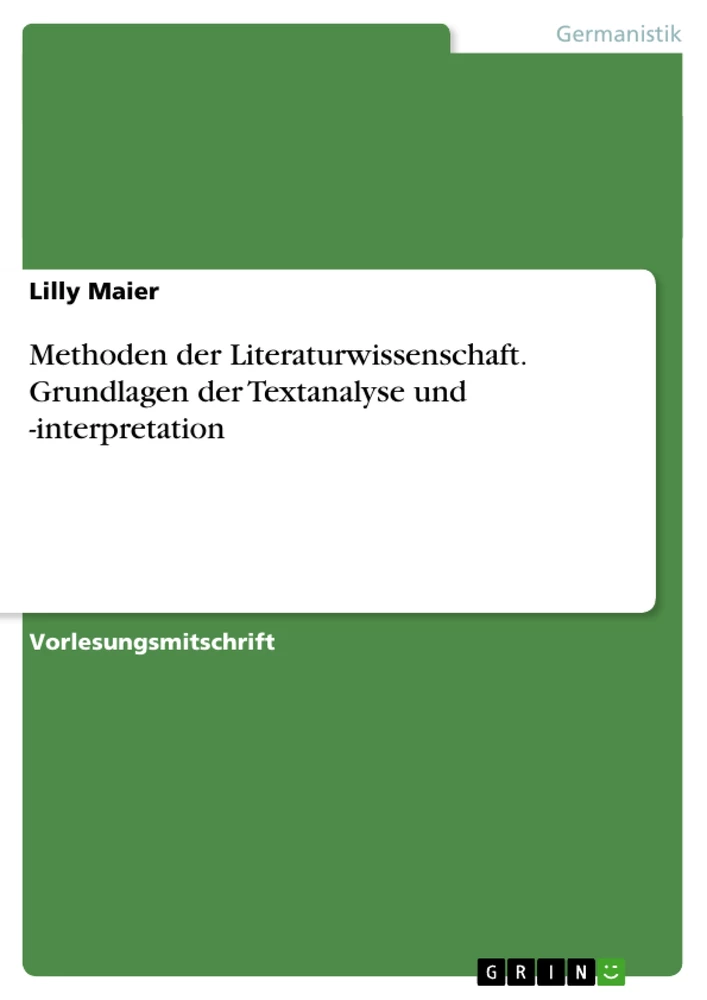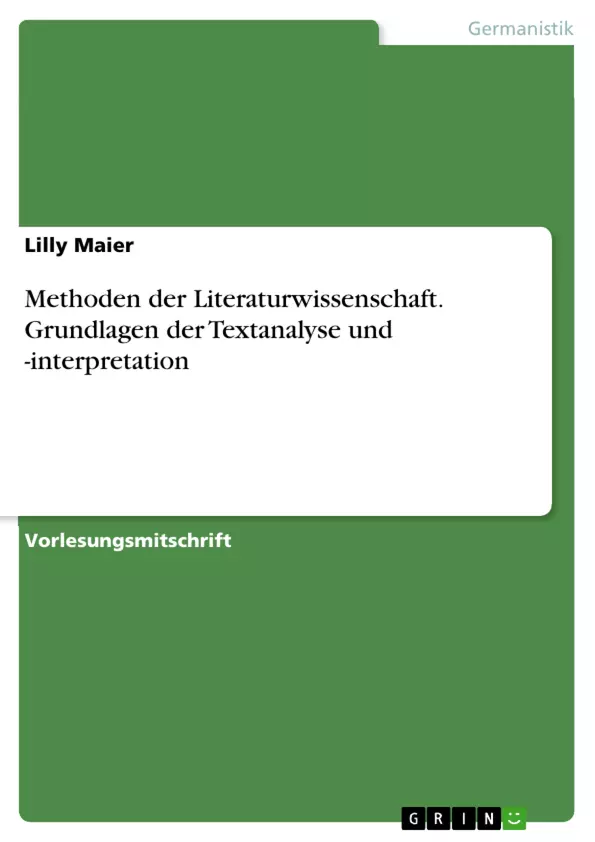Das folgende Vorlesungsskript beinhaltet die Themen der Ringvorlesung im Fach Sprache, Literatur, Kultur. Dabei werden folgende Fragen thematisiert:
Was ist ein Text, und wie lässt sich die unübersehbare Menge von Texten, die der Literatur zugerechnet werden, ordnen?
Was haben wir davon, wenn wir Texte literaturwissenschaftlich analysieren?
Inhaltsverzeichnis
- Grundlagen Literaturwissenschaft
- Germanistik
- Gebrüder Grimm
- Textkompetenz
- EDITION
- Grundbegriffe d. Edition
- Ausgabentypen
- Weg zur Herausgabe
- Auswahl d. Textgrundlage
- Frage nach Textkonstitution
- Variantenapperat
- Erläuterungen u. Kommentare
- TETXTANALYSE - HERMENEUTIK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Skript „Grundlagen Literaturwissenschaft“ von Lilly Maier bietet eine Einführung in die Literaturwissenschaft und ihre zentralen Bereiche. Es beleuchtet die Entwicklung der Germanistik, die Bedeutung von Textkompetenz sowie die Herausforderungen und Möglichkeiten der Edition und Textanalyse.
- Die Entwicklung der Germanistik im Kontext von Nationalstaatwerdung und Sprachentwicklung
- Die Rolle der Literatur als Kommunikationsmittel und kulturelles Gedächtnis
- Die Herausforderungen der Edition und die Bedeutung von Textgrundlagen, Varianten und Kommentaren
- Die Hermeneutik als Kunst des Verstehens und die Vieldeutigkeit literarischer Texte
- Die Bedeutung der Textrezeption und die vielfältigen Forschungsfragen, die sich daraus ergeben
Zusammenfassung der Kapitel
Das Skript beginnt mit einer Einführung in die Literaturwissenschaft und ihren Gegenstand. Es beleuchtet die Geschichte der Germanistik und die Entwicklung der deutschen Sprache. Anschließend werden die Gebrüder Grimm und ihre Bedeutung für die Germanistik vorgestellt. Das Kapitel „Textkompetenz“ behandelt die Schlüsselqualifikation der Verarbeitung und Vermittlung von Texten.
Der Abschnitt „EDITION“ beschäftigt sich mit den Grundlagen der Edition, verschiedenen Ausgabentypen und dem Weg zur Herausgabe eines Textes. Es werden wichtige Textgrundlagen und die Frage nach Textkonstitution behandelt. Der Abschnitt „TETXTANALYSE - HERMENEUTIK“ fokussiert auf die Auseinandersetzung mit Texten und die Hermeneutik als Kunst des Verstehens.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Skripts sind: Literaturwissenschaft, Germanistik, Textkompetenz, Edition, Textanalyse, Hermeneutik, Textrezeption, Sprache, Kultur, Geschichte, Interpretation, Textgrundlage, Variantenapperat, Rezeption.
- Quote paper
- Lilly Maier (Author), 2011, Methoden der Literaturwissenschaft. Grundlagen der Textanalyse und -interpretation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/285161