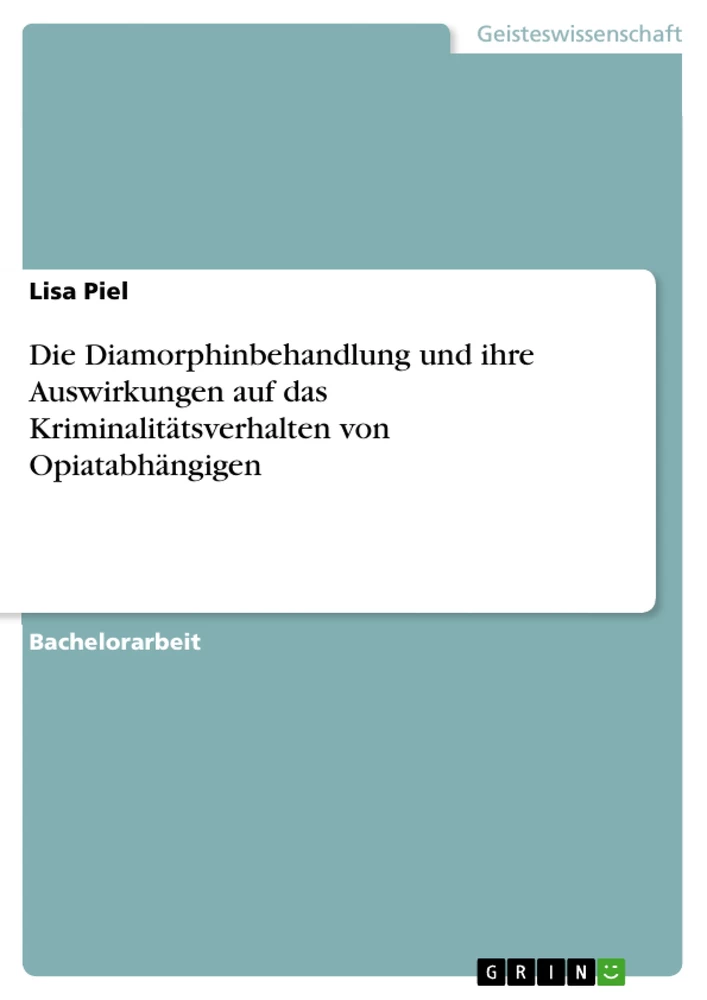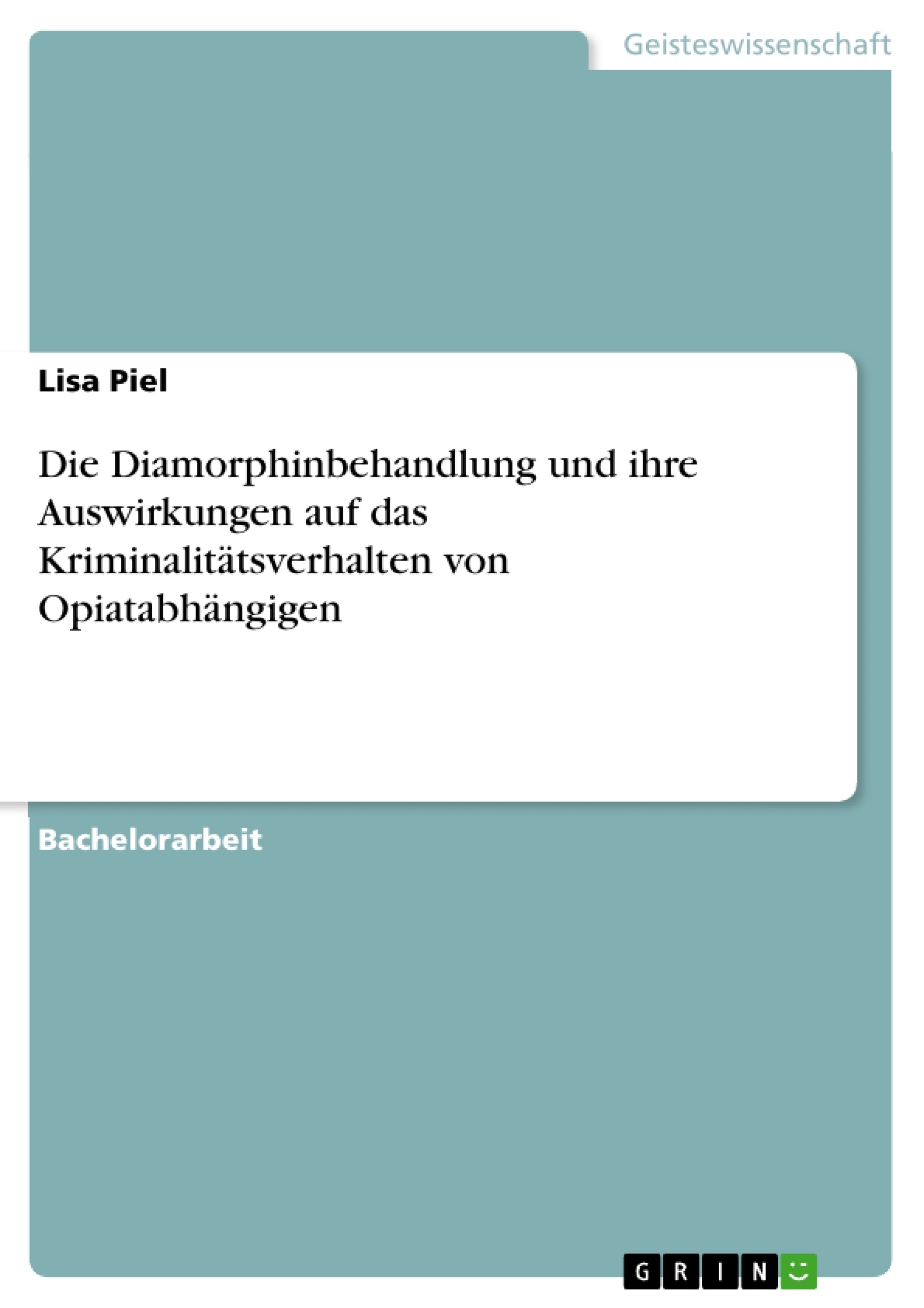In dieser Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit die Diamorphinbehandlung Auswirkungen auf das Kriminalitätsverhalten von Schwerstopiatabhängigen hat und welcher Beitrag durch sie zur Verbesserung der sozialen Reintegration des Klienten geleistet werden kann. Sie richtet sich somit hauptsächlich an Sozialarbeiter und pädagogen, die in der akzeptierenden Drogenhilfe tätig sind. Es soll ausschließlich auf Opiatabhängige in Deutschland eingegangen werden.
Zur Beantwortung dieser Fragestellung sollen im Teil A der Arbeit zunächst grundlegende Informationen zum besseren Verständnis der Thematik vermittelt werden. Nach einführenden Erläuterungen zur Klassifizierung und Operationalisierung von Störungen durch psychotrope Substanzen, speziell zur Diagnostik von Abhängigkeit, schädlichem Gebrauch und einer Substanzgebrauchsstörung, folgen im zweiten Kapitel allgemeine Informationen über Opiate und Opioide, welche im Wesentlichen Aufklärung über die begriffliche Einordnung, (Neben ) Wirkungen der Substanz und Entzugssymptomatik liefern sowie überblicksweise die Prävalenzsituation des Opioidkonsums in Deutschland und die häufig mit einer Opiatabhängigkeit verbundenen sozialen und gesundheitlichen Auswirkungen darstellen. Nachfolgend wird im dritten Kapitel ein Überblick darüber gegeben, wie die Drogen- und Suchthilfe in Deutschland den problematischen Folgen des Drogenkonsums begegnet. Das vierte Kapitel bearbeitet die, für diese Arbeit zentrale, Substitutionsbehandlung, inklusive einer Darstellung der für die Soziale Arbeit in der Drogenhilfe bedeutende psychosoziale Betreuungsmaßnahme als Bestandteil des Therapiekonzepts. Im fünften Kapitel soll nun eine genauere Betrachtung der Substitutionsbehandlung mit Diamorphin erfolgen. Hier wird insbesondere auf das bundesdeutsche Modellprojekt zur heroingestützten Behandlung Opiatabhängiger eingegangen, weil dieses umfassende Erkenntnisse zur Behandlungswirkung liefert. Anschließend widmet sich das sechste Kapitel dem Zusammenhang von Drogenkonsum und Delinquenz und dem Deliktspektrum Drogenabhängiger. Nach der Betrachtung dieser fundamentalen Informationen wird in Teil B der hier vorliegenden Ausarbeitung der Beantwortung der Fragestellung nach den Auswirkungen der Diamorphinbehandlung auf das Kriminalitätsverhalten Opiatabhängiger nachgegangen.
Inhaltsverzeichnis
- TEIL A: ALLGEMEINE INFORMATIONEN
- 1 STÖRUNGEN DURCH PSYCHOTROPE SUBSTANZEN
- 1.1 Abhängigkeitssyndrom
- 1.2 Schädlicher Gebrauch
- 1.3 Substanzgebrauchsstörung
- 2 OPIATE UND OPIOIDE
- 2.1 Begrifflichkeit und Einordnung
- 2.2 (Neben-) Wirkungen
- 2.3 Entzugssymptomatik
- 2.4 Heroin (Diacetylmorphin)
- 2.5 Opioidkonsum in Deutschland
- 2.6 Soziale Lage von Opiatabhängigen in Deutschland
- 2.7 Komorbiditäten
- 2.7.1 Physische und psychische Komorbiditäten
- 2.7.2 Drogenbezogene Todesfälle
- 2.7.3 Substanzbezogene Komorbiditäten
- 3 DIE DROGEN- UND SUCHTHIlfe
- 3.1 Strategie der Drogen- und Suchtpolitik in Deutschland
- 3.2 Das deutsche Versorgungssystem
- 3.3 Der Ansatz der Akzeptanzorientierung und Schadensminimierung
- 4 DIE SUBSTITUTIONSBEHANDLUNG
- 4.1 Therapiekonzept
- 4.2 Ziele einer Substitutionsbehandlung
- 4.3 Substitutionsmittel
- 4.4 Inanspruchnahme in Deutschland
- 4.5 Rechtliche Grundlage und Rahmenbedingungen
- 4.6 Psychosoziale Betreuung (PSB)
- 5 DIE DIAMORPHINBEHANDLUNG
- 5.1 Aufkommen der Debatte um die Diamorphinbehandlung
- 5.2 Das bundesdeutsche Modellprojekt
- 5.2.1 Studiendesign
- 5.2.2 Untersuchungsteilnehmer und Zulassungsvoraussetzungen
- 5.2.3 Untersuchungsziele
- 5.2.4 Zentrale Ergebnisse nach vier Behandlungsjahren
- 5.3 Legalisierung von Diamorphin als Arzneimittel
- 5.4 Zulassungsvoraussetzungen an den Patienten
- 5.5 Anforderungen an Arzt und Praxisräume
- 5.6 Angebot und Inanspruchnahme in Deutschland
- 5.7 Psychosoziale Betreuung (PSB)
- 5.8 Finanzierung
- 6 DROGENKONSUM UND DELINQUENZ
- 6.1 Zusammenhang von Drogenkonsum und Delinquenz
- 6.2 Deliktspektrum Drogenabhängiger
- 6.3 Kriminalstatistik
- TEIL B: AUSWIRKUNGEN DER DIAMORPHINBEHANDLUNG AUF DAS KRIMINALITÄTSVERHALTEN OPIATABHÄNGIGER
- 1 BEGLEITSTUDIE DES BUNDESMODELLPROJEKTES
- 1.1 Studiendesign, Methoden und Erhebungsinstrumente
- 1.1.1 Quantitative Teilstudie: Hellfeldanalyse
- 1.1.2 Quantitative Teilstudie: Dunkelfeldanalyse
- 1.1.3 Qualitative Teilstudie: Gießener Untersuchung
- 1.2 Potentielle Mediatoren und Moderatoren
- 1.3 Patienten charakteristika vor Behandlungsbeginn
- 1.4 Ergebnisse der Hellfeldstudie
- 1.4.1 Vergleich der Delinquenzentwicklung von Heroin- und Methadongruppe im ersten Behandlungsjahr
- 1.4.2 Langfristige Delinquenzentwicklung der Heroinpatienten über zwei Jahre
- 1.5 Ergebnisse der Dunkelfeldstudie
- 1.5.1 Vergleich der Delinquenzentwicklung von Heroin- und Methadongruppe im ersten Behandlungsjahr
- 1.5.2 Langfristige Delinquenzentwicklung der Heroinpatienten über zwei Jahre
- 1.6 Vergleich der Entwicklungstrends in Dunkel- und Hellfeld
- 1.7 Erklärungen zur Delinquenzentwicklung aus der Dunkelfeldstudie
- 1.8 Ergebnisse der qualitativen Teilstudie
- 2 FOLLOW-UP PHASE DES BUNDESMODELLPROJEKTES: ENTWICKLUNG DER DELINQUENZ ÜBER VIER JAHRE
- 3 QUALITÄTSSICHERUNGSPROJEKT
- 3.1 Studiendesign
- 3.2 Entwicklung des Legalverhaltens im Verlauf langfristiger Diamorphinbehandlung über acht Jahre
- 3.3 Zwei-Jahres-Verlauf der neu aufgenommenen Patienten
- 4 SOZIALE (RE-) INTEGRATION
- Auswirkungen der Diamorphinbehandlung auf das Kriminalitätsverhalten von Opiatabhängigen
- Analyse der Ergebnisse des bundesdeutschen Modellprojektes zur Diamorphinbehandlung
- Vergleich der Delinquenzraten bei Heroinabhängigen und Methadonpatienten
- Soziale und rechtliche Rahmenbedingungen der Diamorphinbehandlung in Deutschland
- Bedeutung der Diamorphinbehandlung für die (Re-) Integration von Opiatabhängigen in die Gesellschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Diamorphinbehandlung und ihren Auswirkungen auf das Kriminalitätsverhalten von Opiatabhängigen. Sie untersucht die Ergebnisse des bundesdeutschen Modellprojektes zur Diamorphinbehandlung und analysiert die Veränderung der Delinquenzraten bei Heroinabhängigen im Vergleich zu Methadonpatienten. Die Arbeit beleuchtet zudem die sozialen und rechtlichen Rahmenbedingungen der Diamorphinbehandlung in Deutschland.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile. Teil A behandelt die allgemeine Thematik der Opiatabhängigkeit, die Drogenhilfe und die Substitutionsbehandlung. Teil B fokussiert auf die Auswirkungen der Diamorphinbehandlung auf das Kriminalitätsverhalten von Opiatabhängigen. Kapitel 1 beleuchtet die Definition und Einordnung von Opiaten und Opioiden, ihre Wirkungen und Entzugssymptomatik sowie den Opioidkonsum in Deutschland. Kapitel 2 analysiert die soziale Lage von Opiatabhängigen in Deutschland und beschreibt die Komorbiditäten, die häufig mit der Opiatabhängigkeit einhergehen. Kapitel 3 gibt einen Überblick über die Drogenhilfe in Deutschland, einschließlich der Strategie der Drogen- und Suchtpolitik und dem deutschen Versorgungssystem. Kapitel 4 fokussiert auf die Substitutionsbehandlung, ihre Ziele und Substitutionsmittel sowie ihre Inanspruchnahme und rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland. Kapitel 5 befasst sich mit der Diamorphinbehandlung, ihrer Entstehung, dem bundesdeutschen Modellprojekt und der Legalisierung von Diamorphin als Arzneimittel. Kapitel 6 betrachtet den Zusammenhang von Drogenkonsum und Delinquenz, das Deliktspektrum von Drogenabhängigen und die Kriminalstatistik. Teil B der Arbeit beleuchtet die Ergebnisse der Begleitstudie des bundesdeutschen Modellprojektes zur Diamorphinbehandlung. Kapitel 1 analysiert das Studiendesign, die Methoden und die Erhebungsinstrumente sowie die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Teilstudien. Kapitel 2 beschreibt die Entwicklung der Delinquenz über vier Jahre in der Follow-up Phase des Modellprojektes. Kapitel 3 präsentiert die Ergebnisse des Qualitätssicherungsprojektes zur langfristigen Diamorphinbehandlung. Kapitel 4 behandelt die Bedeutung der Diamorphinbehandlung für die soziale (Re-) Integration von Opiatabhängigen.
Schlüsselwörter
Diamorphinbehandlung, Opiatabhängigkeit, Kriminalitätsverhalten, Substitutionsbehandlung, Modellprojekt, Delinquenz, soziale (Re-) Integration, Drogenhilfe, Deutschland
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Diamorphinbehandlung?
Es handelt sich um die kontrollierte Abgabe von pharmazeutisch reinem Heroin (Diamorphin) an Schwerstopiatabhängige unter ärztlicher Aufsicht.
Wie wirkt sich die Behandlung auf die Kriminalität aus?
Studien zeigen, dass die Beschaffungskriminalität signifikant sinkt, da Patienten den Stoff legal erhalten und nicht mehr auf illegale Wege angewiesen sind.
Was war das Ergebnis des bundesdeutschen Modellprojekts?
Das Projekt belegte eine deutliche Verbesserung der sozialen Lage und Gesundheit der Patienten sowie eine Reduktion der Delinquenz im Vergleich zur Methadonsubstitution.
Was ist psychosoziale Betreuung (PSB)?
PSB ist ein begleitender Teil der Therapie, der Patienten hilft, ihren Alltag zu strukturieren, soziale Probleme zu lösen und sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren.
Welche rechtlichen Voraussetzungen gelten für Patienten?
Patienten müssen mindestens 23 Jahre alt, seit mehreren Jahren abhängig sein und zwei erfolglose Behandlungen nachweisen können.
- Citar trabajo
- Lisa Piel (Autor), 2014, Die Diamorphinbehandlung und ihre Auswirkungen auf das Kriminalitätsverhalten von Opiatabhängigen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/285220