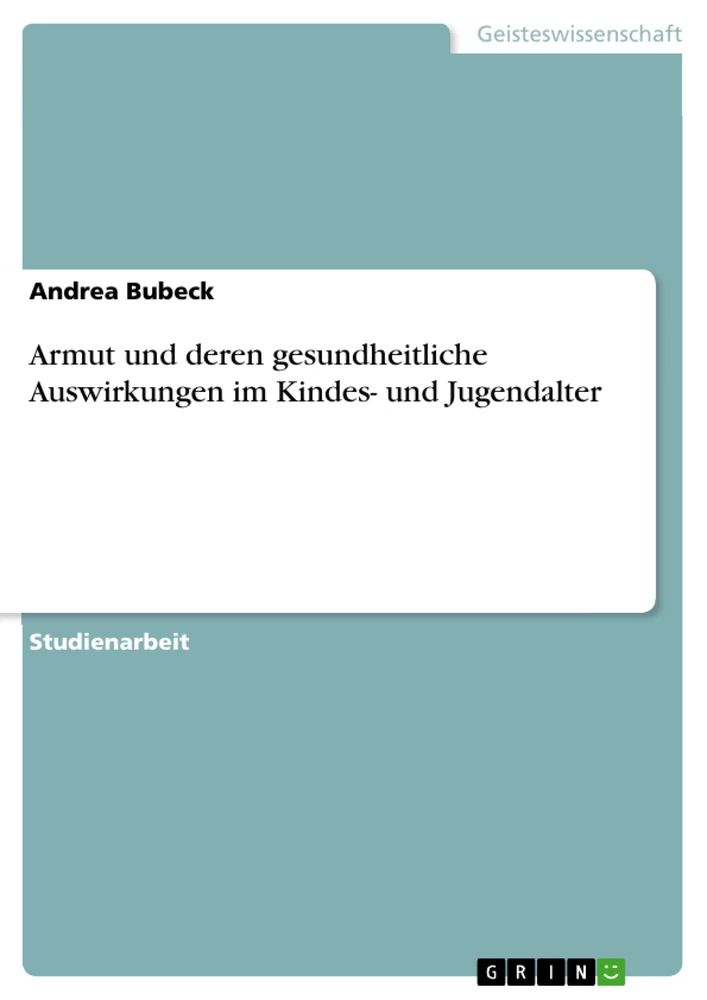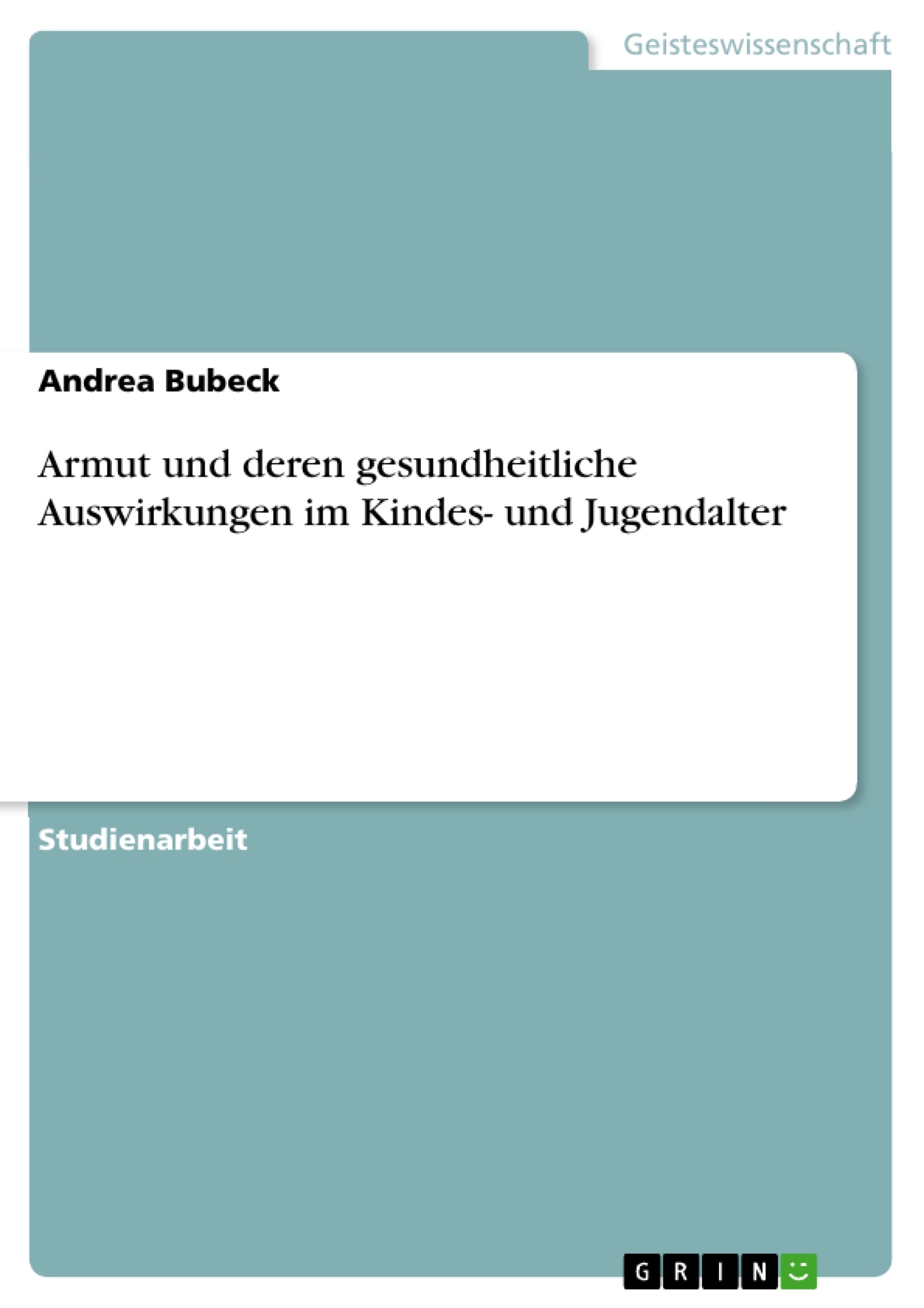Bei Armut denkt man zuerst an die afrikanischen Kinder in der Wüste mit ihren aufgeblähten Bäuchen und ohne Bekleidung oder an die Lebensbedingungen in den Favelas dieser Welt, in der es Wellblechhütten, keinen Strom und erst recht keinen ausreichenden Wohnraum für eine Familie hat. Die Kinder müssen betteln und/oder arbeiten gehen, damit sie nicht verhungern und kommen früh mit Gewalt, Drogen und Prostitution in Kontakt. Armut in Deutschland gibt es nicht im Sinne einer existenziellen Notlage, was das Fehlen der Mittel zum physischen Überleben bedeutet, sondern in Deutschland bedeutet es arm zu sein im Sinne von sozialer Ungleichheit, Benachteiligung und Ausgrenzung. Und das hat zahlreiche Auswirkungen auf das Aufwachsen der Kinder und für ihren Lebensverlauf und ist verbunden mit sozialer Diskriminierung und ungleichen Bildungschancen. In Deutschland wurde das Thema „Kinderarmut“ lange Zeit nicht beachtet und fand erst spät Interesse in der Öffentlichkeit und in der Politik. Selbst in der Fachwelt wird erst seit den neunziger Jahren dazu geforscht. In der folgenden Hausarbeit geht es um die Darstellung der Armut im Allgemeinen, um Kinderarmut und ihre Auswirkungen auf das Gesundheitsverhalten bei Kindern und Jugendlichen. Die Forschungsfrage lautet:
„Inwieweit wirkt sich Armut auf das Gesundheitsverhalten von Kindern und Jugendlichen aus?“ Im Kapitel 2 wird die Armut begrifflich definiert und die unterschiedlichen Armutskonzepte vorgestellt. Darin finden sich auch der Lebenslagenansatz und der Ressourcenansatz erklärt. Kapitel 3 beschäftigt sich mit den Ursachen von Armut und mit den Auswirkungen allgemein und speziell auf die Kinder und Jugendlichen. Armut von Kindern kann nicht losgelöst von der Armut ihrer Eltern wahrgenommen werden und ist auch immer ein mehrdimensionales Problem. Im darauffolgenden Kapitel geht es um den Zusammenhang von Armut und Gesundheit in Bezug auf die Auswirkungen für Kinder und Jugendliche. Im Kapitel 5 werden mögliche Interventionen durch die Soziale Arbeit und präventive Möglichkeiten beleuchtet. Den letzten Teil dieser Arbeit bildet das Fazit und fasst die Erkenntnisse kurz zusammen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. ARMUT WAS IST DAS?
- 2.1 ABSOLUTE ARMUT.
- 2.2 RELATIVE ARMUT
- 2.3 KINDERARMUT...
- 3. URSACHEN UND AUSWIRKUNGEN VON ARMUT.
- 3.1 URSACHEN...
- 3.2 AUSWIRKUNGEN....
- 4. ARMUT UND GESUNDHEITLICHE UNGLEICHHEIT
- 4.1 ZUSAMMENHANG ZWISCHEN ARMUT UND GESUNDHEIT/KRANKHEIT...
- 4.2 AUSWIRKUNGEN VON ARMUT AUF DIE GESUNDHEIT BEI KINDERN UND JUGENDLICHEN
- 5 INTERVENTIONEN.
- 6 FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Thematik der Armut, insbesondere der Kinderarmut, und deren Auswirkungen auf das Gesundheitsverhalten von Kindern und Jugendlichen. Die Arbeit analysiert die Definitionen und Konzepte von Armut, beleuchtet die Ursachen und Folgen von Armut, untersucht den Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit, sowie die Auswirkungen von Armut auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Schließlich werden Interventionen und präventive Möglichkeiten der Sozialen Arbeit in Bezug auf die Thematik der Armut und Gesundheit von Kindern und Jugendlichen beleuchtet.
- Definitionen und Konzepte von Armut (absolute und relative Armut)
- Ursachen und Auswirkungen von Armut
- Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit
- Auswirkungen von Armut auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
- Interventionen und präventive Möglichkeiten der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Armut und deren Auswirkungen auf das Gesundheitsverhalten von Kindern und Jugendlichen ein. Sie stellt die Forschungsfrage und gibt einen Überblick über die Struktur der Arbeit. Kapitel 2 definiert den Begriff Armut und stellt verschiedene Armutskonzepte vor, darunter den Lebenslagenansatz und den Ressourcenansatz. Kapitel 3 beschäftigt sich mit den Ursachen von Armut und deren Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche. Kapitel 4 untersucht den Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit und beleuchtet insbesondere die Auswirkungen von Armut auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Kapitel 5 präsentiert verschiedene Interventionen und präventive Möglichkeiten der Sozialen Arbeit, die sich mit dem Thema Armut und Gesundheit von Kindern und Jugendlichen befassen. Das Fazit fasst die Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Armut, Kinderarmut, Gesundheitsverhalten, Lebenslagenansatz, Ressourcenansatz, soziale Ungleichheit, Gesundheitliche Ungleichheit, Interventionen, Prävention, Soziale Arbeit.
- Citar trabajo
- Andrea Bubeck (Autor), 2014, Armut und deren gesundheitliche Auswirkungen im Kindes- und Jugendalter, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/285230