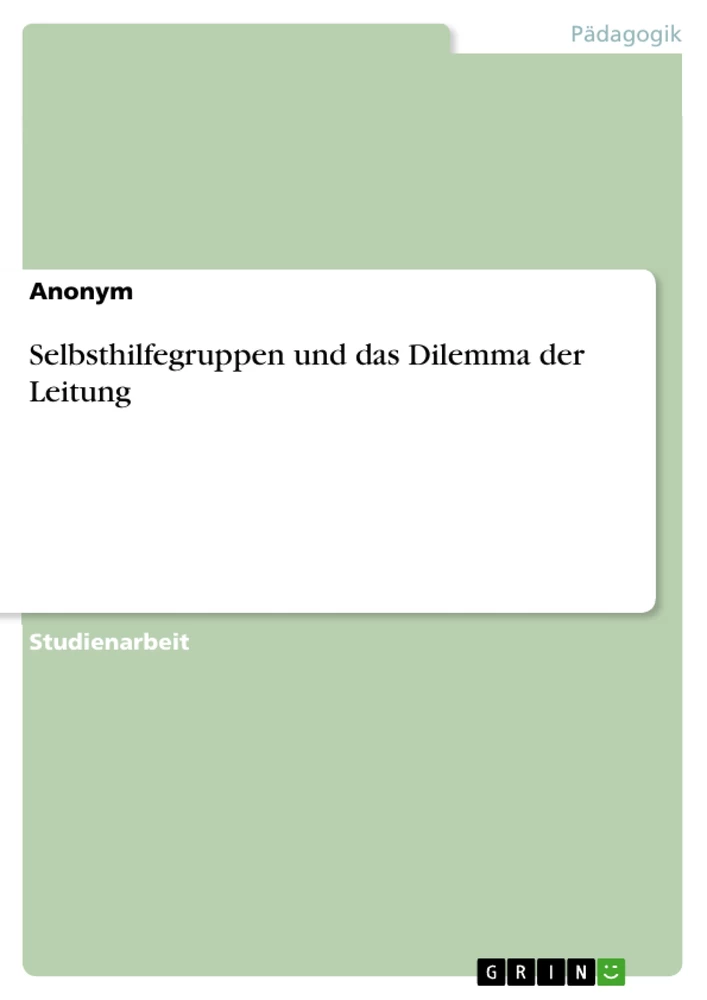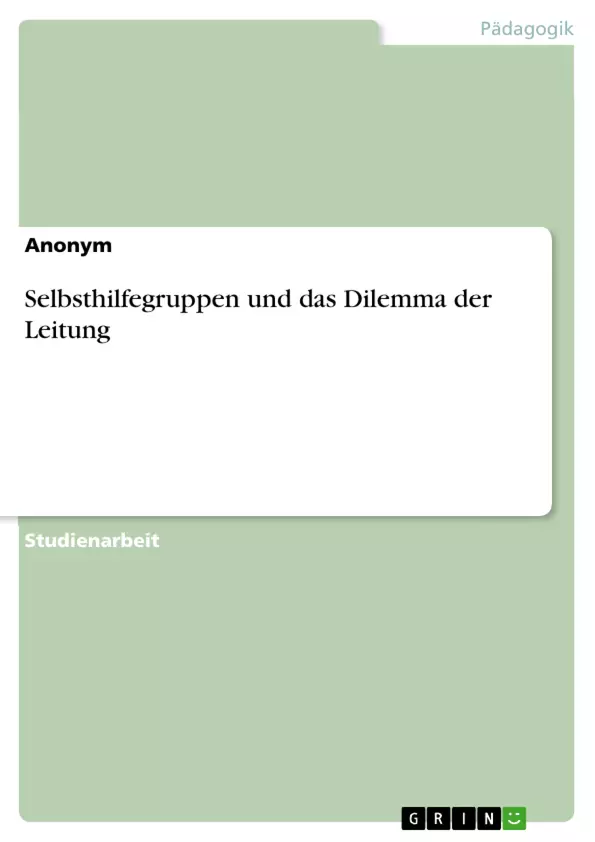In Deutschland bestehen zurzeit 70000 bis 100000 Selbsthilfegruppen, wobei sich die Anzahl in den vergangenen zwei Jahrzehnten verdoppelt hat. In diesen Gruppen befinden sich ca. 3,5 Millionen Mitglieder (NAKOS,o.J.). Selbsthilfegruppen haben aufgrund ihrer wachsenden Zahl in der heutigen Zeit eine zunehmende Bedeutung, jedoch eine geringe Aufmerksamkeit in der wissenschaftlichen Diskussion.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Selbsthilfegruppen und das Dilemma der Leitung
- 2.1 Begriffsklärungen
- 2.2 Charakteristika
- 2.3 Schwierigkeiten und positive Wirkungen
- 2.4 Die Leitung von Selbsthilfegruppen - ein Widerspruch?
- 3. Fazit
- 4. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Dilemma der Leitung von Selbsthilfegruppen. Sie beleuchtet die Frage, ob die Unterstützung und Förderung von Selbsthilfegruppen zu Abhängigkeit und einem Verlust der Selbstständigkeit führen kann. Der Text analysiert die Charakteristika und Herausforderungen von Selbsthilfegruppen und diskutiert die Rolle professioneller Helfer in diesem Kontext.
- Definition und Charakteristika von Selbsthilfegruppen
- Schwierigkeiten und positive Auswirkungen von Selbsthilfegruppen
- Das Dilemma der Leitung von Selbsthilfegruppen
- Abwägung von Unterstützung und Selbstbestimmung
- Die Rolle professioneller Helfer in Selbsthilfegruppen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Dilemma der Leitung von Selbsthilfegruppen vor und führt in die Thematik ein. Im zweiten Kapitel werden zunächst grundlegende Begriffe geklärt und die Charakteristika von Selbsthilfegruppen erläutert. Anschließend werden die Schwierigkeiten und positiven Auswirkungen dieser Form der Selbsthilfe beleuchtet. Der Schwerpunkt des Textes liegt auf dem Dilemma der Leitung von Selbsthilfegruppen, welches im dritten Kapitel diskutiert wird.
Schlüsselwörter
Selbsthilfegruppen, Leitung, Dilemma, Unterstützung, Selbstbestimmung, Abhängigkeit, soziale Gruppenarbeit, Methode, soziale Arbeit, Schwierigkeiten, positive Wirkungen, professioneller Helfer, wissenschaftliche Diskussion.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das "Dilemma der Leitung" in Selbsthilfegruppen?
Das Dilemma besteht darin, ob professionelle Leitung oder zu starke Unterstützung die Selbstständigkeit und Eigenverantwortung der Gruppe untergraben und zu Abhängigkeit führen könnte.
Wie viele Selbsthilfegruppen gibt es in Deutschland?
Schätzungen zufolge gibt es in Deutschland zwischen 70.000 und 100.000 Selbsthilfegruppen mit etwa 3,5 Millionen Mitgliedern.
Welche Rolle spielen professionelle Helfer in der Selbsthilfe?
Professionelle Helfer stehen oft vor der Herausforderung, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, ohne die Autonomie der Gruppe durch klassische Führungsmuster zu gefährden.
Was sind die Hauptcharakteristika von Selbsthilfegruppen?
Selbsthilfegruppen zeichnen sich durch Freiwilligkeit, Betroffenheit der Mitglieder, gegenseitige Unterstützung und eine meist nicht-hierarchische Struktur aus.
Warum nimmt die Bedeutung von Selbsthilfegruppen zu?
Ihre Zahl hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten verdoppelt, da sie eine wichtige Ergänzung zum professionellen Gesundheitssystem bei der Bewältigung chronischer Probleme bieten.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2014, Selbsthilfegruppen und das Dilemma der Leitung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/285254