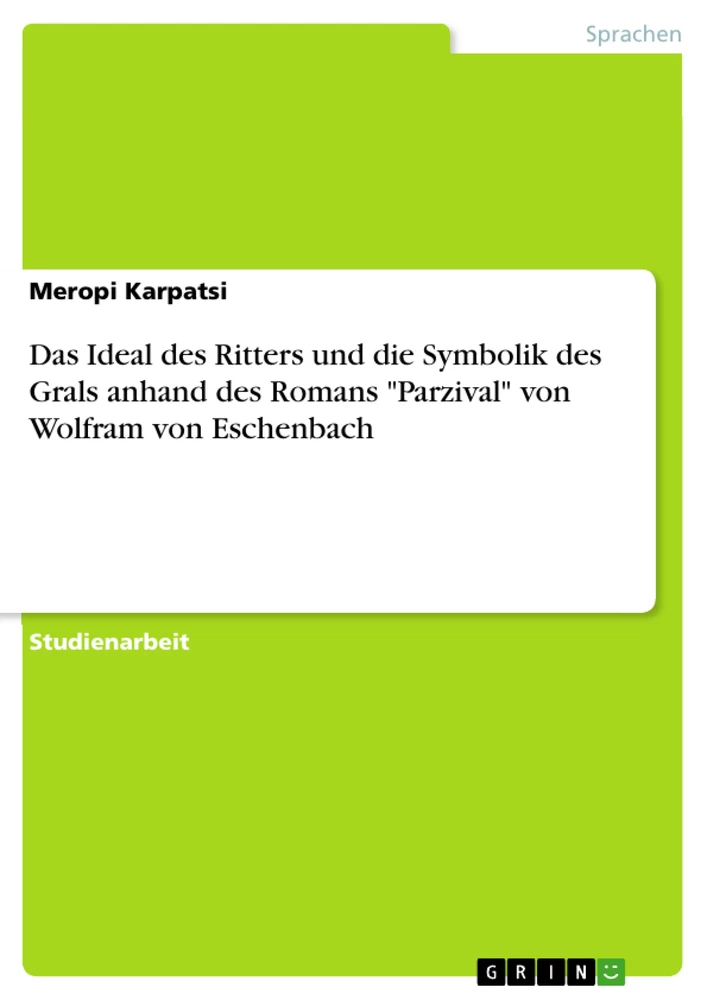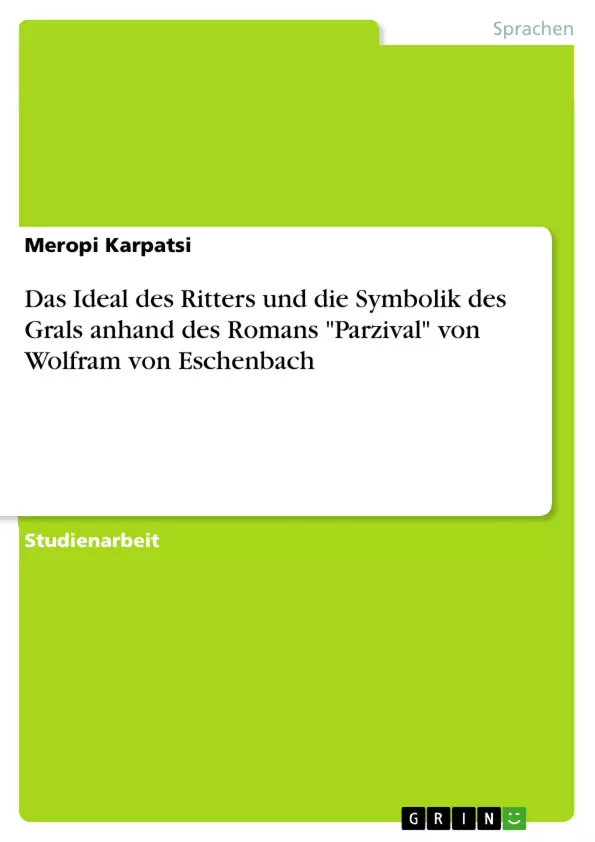In der folgenden Seminararbeit werden wir uns anhand des höfischen Epos „Parzival“ von Wolfram von Eschenbach mit dem Ideal des Ritters und der Gralslegende beschäftigen.
Der Titel „Parzival“ bezieht sich auf den Protagonisten dieses Romans, der ein Artusritter zu werden versucht und am Ende ein Gralskönig wird. „Ein Ritter muss bestimmten Anforderungen gerecht werden beziehungsweise einem höfischen Ritterideal entsprechen.“ Diesem Ritterideal entspricht unser Protagonist, da er sich in Waffen übt, höfisch bildet, sich moralisch sittet und religiös unterweist. Seine Entwicklung vom Gralsritter zum Gralskönig lehnt sich jedoch nicht nur an seine ritterlichen Taten, sondern ist ein Ergebnis seiner Leidensbereitschaft zu Gott.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der höfische Roman
- Entstehung und Entwicklung des höfischen Romans
- Der Artusroman
- Die Symbolik des Grals
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem höfischen Epos „Parzival“ von Wolfram von Eschenbach und untersucht das Ideal des Ritters sowie die Gralslegende. Ziel ist es, die Entwicklung des Protagonisten Parzival vom Gralsritter zum Gralskönig im Kontext der höfischen Literatur und der Gralsmythologie zu analysieren.
- Der höfische Roman und seine Entwicklung
- Das Ritterideal im Mittelalter
- Die Gralslegende und ihre Symbolik
- Parzivals Entwicklung zum Gralskönig
- Die Rolle der Minne und der Gottesfürchtigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Seminararbeit ein und stellt den Protagonisten Parzival sowie die Gralslegende vor. Im ersten Kapitel wird der höfische Roman als literarische Gattung analysiert, wobei die Entstehung und Entwicklung des höfischen Romans im 12. Jahrhundert in Frankreich sowie die Adaption antiker und orientalischer Erzähltraditionen beleuchtet werden. Das Kapitel beleuchtet auch die Bedeutung des Artusromans als Teil der höfischen Literatur und die Rolle von König Artus als Ideal des hochhöfischen Ritters.
Das zweite Kapitel widmet sich der Symbolik des Grals und seiner Bedeutung in der mittelalterlichen Literatur. Der Heilige Gral wird als wundertätiges und heiliges Objekt dargestellt, das weltliche und himmlische Glückseligkeit verheißt. Der Gral steht symbolisch für die ideale Symbiose des Irdischen mit dem Göttlichen und kann nur von auserwählten Personen gefunden werden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ritterideal im „Parzival“?
Ein Ritter muss den Anforderungen des höfischen Ideals entsprechen: Übung in Waffen, höfische Bildung, moralische Sittlichkeit und religiöse Unterweisung.
Wofür steht die Symbolik des Grals?
Der Gral ist ein heiliges Objekt, das weltliche und himmlische Glückseligkeit verheißt. Er symbolisiert die ideale Verbindung zwischen dem Irdischen und dem Göttlichen.
Wie entwickelt sich Parzival im Roman?
Parzival beginnt als „tumber Tor“ und entwickelt sich durch Fehler und Leidensbereitschaft vom Artusritter zum würdigen Gralskönig.
Was unterscheidet den Artusritter vom Gralsritter?
Während der Artusritter nach weltlicher Ehre und Minne strebt, ist der Gralsritter (und spätere König) durch eine tiefere religiöse Dimension und die unmittelbare Beziehung zu Gott gekennzeichnet.
Wer ist der Autor des „Parzival“?
Das Werk wurde von Wolfram von Eschenbach im frühen 13. Jahrhundert verfasst und gilt als einer der bedeutendsten höfischen Romane der mittelhochdeutschen Literatur.
- Arbeit zitieren
- Meropi Karpatsi (Autor:in), 2012, Das Ideal des Ritters und die Symbolik des Grals anhand des Romans "Parzival" von Wolfram von Eschenbach, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/285608