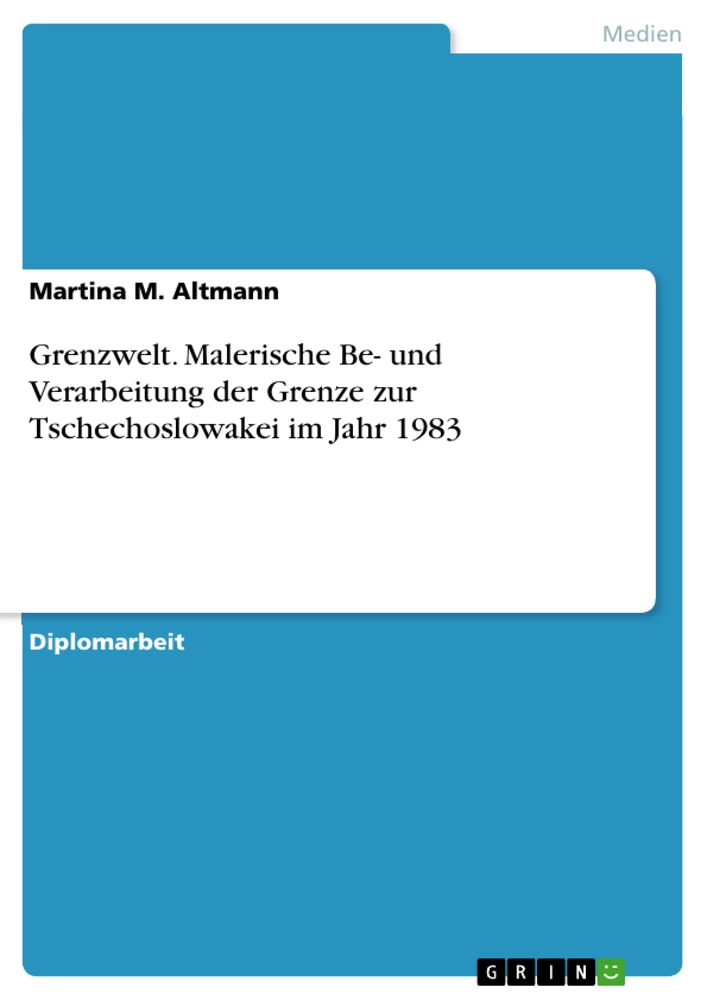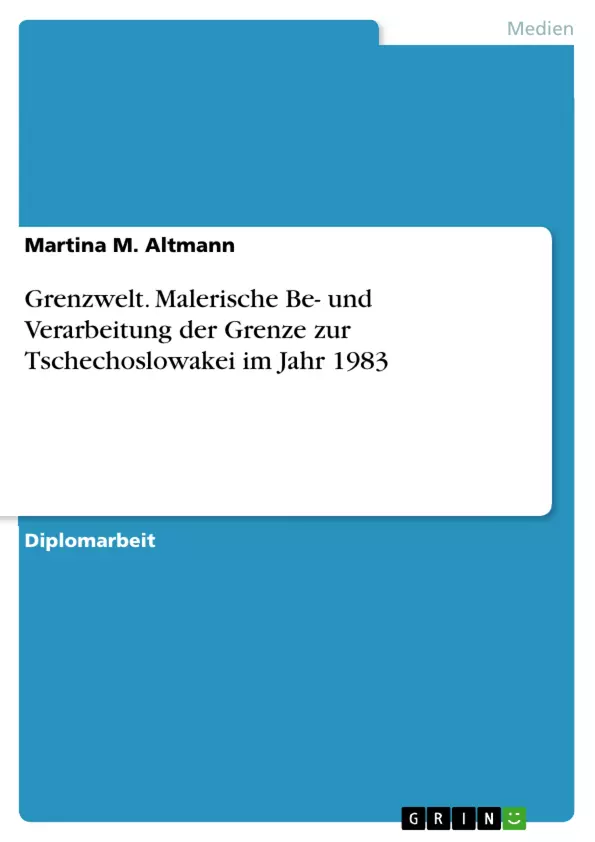In der vorliegenden Diplomarbeit befasst sich die Künstlerin Martina M. Altmann mit ihrer Kindheit an der Grenze zur Tschechoslowakei, speziell die Zeit um das Jahr 1983. Im Alter von etwa 9 – 10 Jahren hat sie begonnen zu der Grenze zu Tschechien, damals noch Tschechoslowakei, ein Gefühl zu entwickeln, das sie bis heute nicht los gelassen hat, welches sie mit Worten aber auch bis heute nicht hundertprozentig beschreiben kann. Um so interessanter ist die malerische Umsetzung, welche inklusive der Farbenlehre detailliert beschrieben wird.
Die Künstlerin weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei um ihre EIGENEN Erlebnisse und ihr EIGENES subjektives Empfinden handelt. Die Wahrnehmung derselben Zeit und derselben Geschehnisse durch andere Personen mag anders sein.
Inhaltsverzeichnis
- ERINNERUNG
- GRENZWELT
- EINFÜHRUNG
- MOTIVATION
- BEGRIFFSKLÄRUNG
- GRENZE
- WELT
- ABSICHT
- ABSTRAKTE KUNST
- ABSTRAKTER EXPRESSIONISMUS
- EINORDNUNG MEINER EIGENEN WERKE
- VON DER IDEE ZUM BILD
- IDEE
- BILDTRÄGER, MATERIAL UND TECHNIK
- RAHM
- ,,LEINWAND"
- GRUNDIERUNG
- FARBMATERIAL
- VORBEREITUNG
- KOMPOSITION & GESTALTUNG
- TECHNIK
- FARBENLEHRE
- MEINE FARBPALETTE UND IHRE BEDEUTUNG
- DEFINITION VON FARBE
- BEDEUTENDE FARBORDNUNGEN
- FARBSYMBOLIK
- KONTRAST
- PERSÖNLICHE STELLUNGNAHME
- GEDANKEN ZUR GRENZE
- SCHLUSSWORT
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der subjektiven Wahrnehmung der Autorin, die in ihrer Kindheit an der Grenze zur Tschechoslowakei aufwuchs. Die Arbeit analysiert die persönlichen Erlebnisse und das Gefühl der Grenze, die die Autorin bis heute prägen. Die Arbeit zielt darauf ab, die subjektive Erfahrung der Grenze künstlerisch zu verarbeiten und in abstrakten Bildern auszudrücken.
- Die subjektive Wahrnehmung der Grenze in der Kindheit
- Die künstlerische Verarbeitung der Grenzerfahrung
- Die Bedeutung von Farbe und Form in der abstrakten Kunst
- Die Rolle der Erinnerung und des Gefühls in der Kunst
- Die Verbindung von persönlicher Erfahrung und künstlerischer Gestaltung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel „Erinnerung“ beginnt mit einem Gedicht von Josef Hrubý, das die Thematik der Erinnerung und der Grenzerfahrung einführt. Das zweite Kapitel „Grenzwelt“ beschäftigt sich mit der Einführung der Thematik und der Motivation der Autorin. Es werden die persönlichen Erlebnisse der Autorin an der Grenze zur Tschechoslowakei in den 1980er Jahren beschrieben. Das Kapitel beleuchtet auch die historische und politische Situation der Zeit, insbesondere den Kalten Krieg und die Spannungen zwischen Ost und West. Die Autorin beschreibt ihre persönlichen Erinnerungen an die Grenze, die von Angst, Neugier und Unverständnis geprägt waren. Sie schildert ihre Faszination für die Grenze und ihre Versuche, die Grenzerfahrung zu verstehen. Das Kapitel „Begriffsklärung“ definiert die Begriffe „Grenze“ und „Welt“ und stellt die Bedeutung dieser Begriffe für die Arbeit der Autorin dar. Das Kapitel „Absicht“ beschreibt die künstlerische Absicht der Autorin, ihre Grenzerfahrungen in abstrakten Bildern auszudrücken. Das dritte Kapitel „Abstrakte Kunst“ beschäftigt sich mit dem abstrakten Expressionismus und der Einordnung der eigenen Werke in diesen Kontext. Das vierte Kapitel „Von der Idee zum Bild“ beschreibt den Entstehungsprozess der Bilder. Es werden die Ideen, die Materialien, die Technik und die Komposition der Bilder erläutert. Das Kapitel „Farbenlehre“ beschäftigt sich mit der Bedeutung von Farbe in der abstrakten Kunst. Die Autorin beschreibt ihre eigene Farbpalette und ihre Bedeutung für die Bilder. Das fünfte Kapitel „Persönliche Stellungnahme“ beinhaltet die Gedanken der Autorin zur Grenze und ihre Schlussfolgerungen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Grenzerfahrung, die subjektive Wahrnehmung, die abstrakte Kunst, der Kalte Krieg, die Tschechoslowakei, die Erinnerung, die Farbe, die Form und die künstlerische Gestaltung. Die Arbeit beleuchtet die persönlichen Erlebnisse der Autorin an der Grenze und ihre künstlerische Auseinandersetzung mit dieser Erfahrung. Die Autorin verwendet abstrakte Bilder, um ihre Gefühle und Gedanken zur Grenze auszudrücken. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Bedeutung von Farbe und Form in der abstrakten Kunst und der Rolle der Erinnerung und des Gefühls in der Kunst.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Diplomarbeit „Grenzwelt“?
Die Arbeit befasst sich mit der malerischen Verarbeitung der Kindheitserlebnisse der Künstlerin Martina M. Altmann an der Grenze zur Tschechoslowakei im Jahr 1983.
Welche Kunstform nutzt die Künstlerin für ihre Werke?
Die Künstlerin ordnet ihre Werke dem abstrakten Expressionismus zu, um Gefühle auszudrücken, die schwer in Worte zu fassen sind.
Welche Rolle spielt die Farbenlehre in dieser Arbeit?
Die Farbwahl ist von zentraler Bedeutung; die Künstlerin nutzt eine spezifische Palette, um die bedrückende und faszinierende Atmosphäre der Grenze symbolisch darzustellen.
Wie wird die Grenze subjektiv wahrgenommen?
Für die damals 9- bis 10-jährige Künstlerin war die Grenze ein Ort der Angst, Neugier und des Unverständnisses inmitten des Kalten Krieges.
Welche Materialien wurden für die Bilder verwendet?
Die Arbeit detailliert den Prozess vom Bildträger (Rahmen und Leinwand) über die Grundierung bis hin zur speziellen Maltechnik.
- Quote paper
- Martina M. Altmann (Author), 2014, Grenzwelt. Malerische Be- und Verarbeitung der Grenze zur Tschechoslowakei im Jahr 1983, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/285694