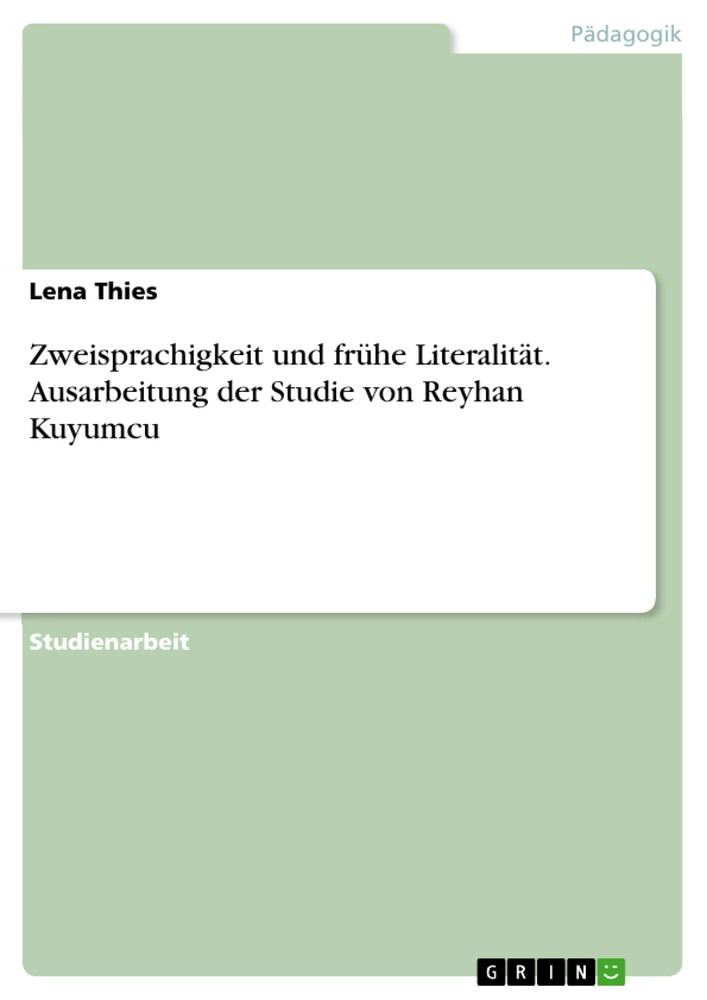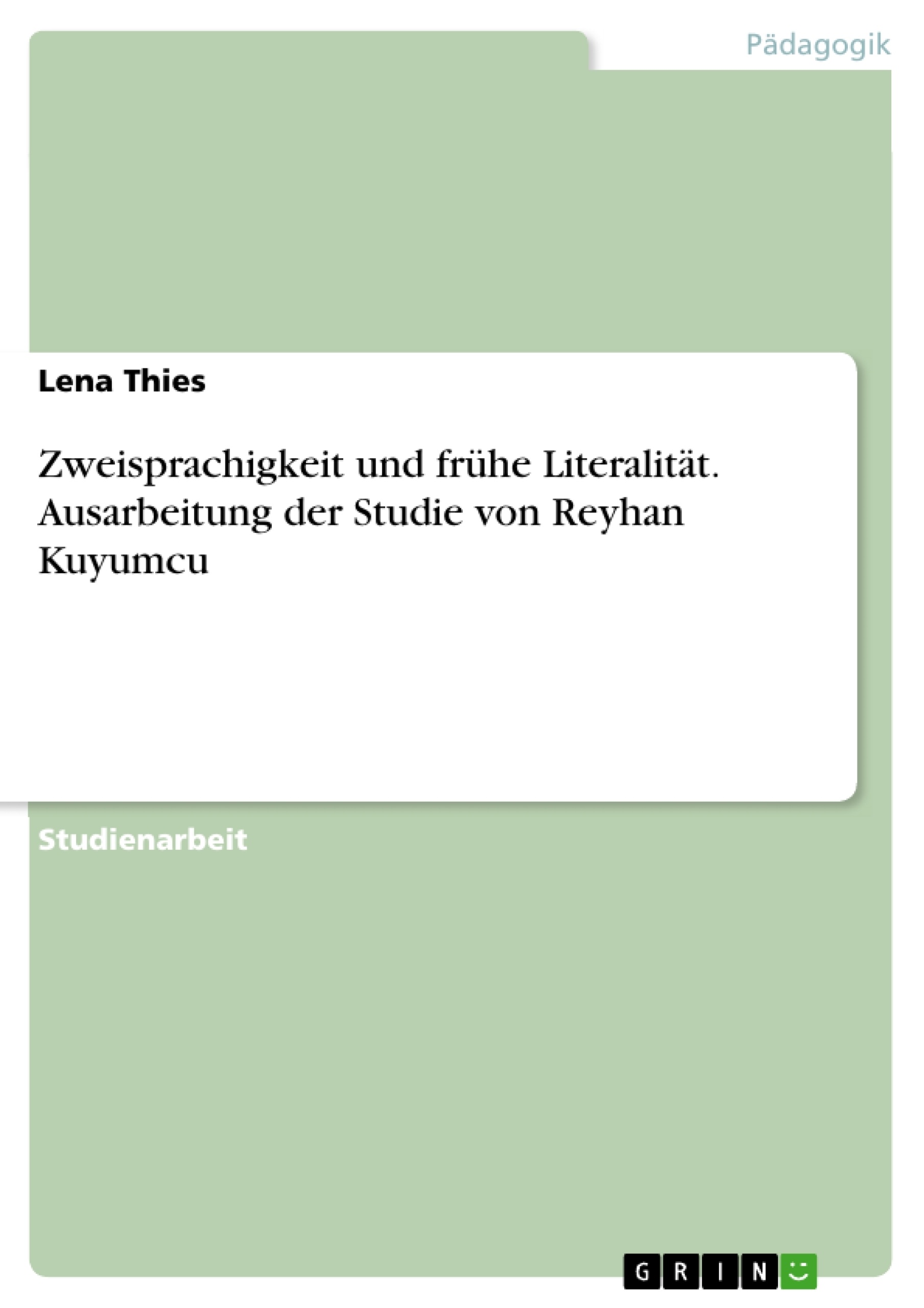Was ist Literalität? Und inwiefern steht sie mit dem Erwerb einer Zweitsprache in Verbindung? Diese und andere Fragen lassen sich bei der Betrachtung des Begriffs Literalität stellen. Im Seminar „Individuelle und unterrichtliche Bedingungen und Modelle von Zweisprachigkeit“, das der Lehrveranstaltungsreihe „Interkulturelle Differenz und Geschlechter-Differenz in der Schule“ angehört, habe ich mich mit der Studie „Jetzt male ich dir einen Brief.“ Literalitätserfahrungen von (türkischen) Migrantenkindern im Vorschulalter“ von Reyhan Kuyumcu auseinandergesetzt, ein Referat ausgearbeitet und dieses vorgetragen.
Im Folgenden findet sich zunächst die Begriffsdefinition von Literalität, um eine Grundlage für das Thema zu bieten. Dann folgt ein Überblick über die oben genannte Studie, worauf die in der Studie angesprochene Problematik von Migrantenkindern, sowie verschiedene Fördermöglichkeiten thematisiert werden. Auch ein Auszug aus einem Elternratgeber ist dieser Ausarbeitung im Anhang beigefügt, u.a. um aufzuzeigen, wie präsent diese Thematik wirklich ist, aber auch, um darzustellen, wie einfach eine gezielte Förderung, auch im Elternhaus, sein kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zum Begriff „Literalität“
- 3. Die Studie
- 4. Literalität in Migrantenfamilien
- 5. Förderung von Migrantenkindern
- 6. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung setzt sich mit der Studie "Jetzt male ich dir einen Brief." von Reyhan Kuyumcu auseinander, welche die Literalitätserfahrungen türkischer Migrantenkinder im Vorschulalter untersucht. Ziel ist es, die zentralen Aspekte der Studie zu präsentieren und die Thematik der Literalität im Kontext von Migrantenfamilien zu beleuchten.
- Der Begriff "Literalität" und seine Bedeutung für den Spracherwerb.
- Die Literalitätserfahrungen türkischer Migrantenkinder im Vorschulalter.
- Unterschiede in der Literalitätsförderung zwischen Migrantenfamilien und der Majoritätsgesellschaft.
- Möglichkeiten zur Förderung der Literalität bei Migrantenkindern.
- Die Rolle der Eltern und Institutionen bei der Unterstützung des Literalitätserwerbs.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Literalität und ihres Zusammenhangs mit dem Erwerb einer Zweitsprache ein. Sie stellt die Studie von Reyhan Kuyumcu vor, auf der die Ausarbeitung basiert, und umreißt den Aufbau des Textes. Die zentrale Frage nach der Bedeutung von Literalität im Kontext des zweisprachigen Aufwachsens wird hier bereits aufgeworfen und als roter Faden für die gesamte Arbeit etabliert. Die Einbindung der Studie in ein größeres Seminar zur interkulturellen Differenz in der Schule wird hervorgehoben. Der Bezug auf die Präsentation eines Referats unterstreicht den praktischen Bezug der Arbeit. Die Ankündigung der beigefügten Materialien aus einem Elternratgeber deutet auf die Praxisrelevanz der Erkenntnisse hin.
2. Zum Begriff „Literalität“: Dieses Kapitel liefert eine Definition von Literalität basierend auf Apeltauers Werk. Es geht über die einfache Definition des Lesens und Schreibens hinaus und betont die Bedeutung von Vorläuferfähigkeiten im Kleinkindalter. Die Entwicklung von Schriftlichkeit wird als umfassender Prozess dargestellt, der weit über das reine Lesen und Schreiben von Texten hinausgeht und bereits frühe Erfahrungen mit Geschichten, Kritzeleien oder dem eigenen Namen einschließt. Der Einfluss der Familie und des familiären Umfelds auf die Entwicklung der Literalität wird hervorgehoben, wobei interaktives Vorlesen und das Einbeziehen von Kindern in den schriftlichen Alltag als wichtige Förderfaktoren genannt werden. Der Einfluss der elterlichen Lesegewohnheiten auf die Kinder, besonders in bildungsfernen Familien, wird als kritischer Faktor für den späteren Schulerfolg herausgestellt, was besonders für Migrantenkinder relevant ist, deren Zugang zu Schriftsprache oft eingeschränkt ist. Der Bezug zu Rosebrock/Nix unterstreicht den wissenschaftlichen Stand der Argumentation.
3. Die Studie: Dieses Kapitel beschreibt die Studie von Reyhan Kuyumcu (2007), die sich mit den Literalitätserfahrungen türkischer Migrantenkinder im Vorschulalter befasst. Der Fokus liegt auf den Schwierigkeiten dieser Kinder im Umgang mit formeller Schulsprache und dem Mangel an notwendigen Fertigkeiten. Die Forschungsfragen der Studie werden dargelegt: Welche Voraussetzungen bringen Migrantenkinder mit? Welche Unterschiede zur Mehrheitsgesellschaft gibt es? Wie kann der Erwerb dieser Fertigkeiten gefördert werden? Die Methodik der Studie wird kurz beschrieben (Beobachtungen, Interviews, Hausbesuche). Die Unterteilung der Untersuchung in die Bereiche Erzählen, Lesen/Vorlesen, Schreiben und Medienkompetenz wird erläutert. Es wird angedeutet, dass die Ergebnisse aufzeigen, dass Eltern Bildung zwar wichtig finden, die Verantwortung jedoch oft eher bei Institutionen sehen. Der Mangel an schriftlichem Material in den Haushalten wird erwähnt, ebenso wie Unterschiede in Erzählpraktiken und Medienkonsum zwischen den Familien und der Mehrheitsgesellschaft.
Schlüsselwörter
Literalität, Frühe Literalität, Zweisprachigkeit, Migrantenkinder, Migrantenfamilien, Spracherwerb, Schriftspracherwerb, Interkulturelle Bildung, Fördermöglichkeiten, Elternhaus, Kindergarten, Schule.
Häufig gestellte Fragen zu "Jetzt male ich dir einen Brief": Eine Analyse der Literalitätserfahrungen türkischer Migrantenkinder
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Studie "Jetzt male ich dir einen Brief" von Reyhan Kuyumcu, welche die Literalitätserfahrungen türkischer Migrantenkinder im Vorschulalter untersucht. Der Fokus liegt auf den Unterschieden in der Literalitätsförderung zwischen Migrantenfamilien und der Mehrheitsgesellschaft und auf Möglichkeiten zur Förderung der Literalität bei diesen Kindern.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Begriff "Literalität", die Literalitätserfahrungen türkischer Migrantenkinder, Unterschiede in der Literalitätsförderung, Fördermöglichkeiten, die Rolle der Eltern und Institutionen, sowie den Zusammenhang zwischen Literalität und dem Erwerb einer Zweitsprache.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Begriff "Literalität", eine Beschreibung der Studie von Reyhan Kuyumcu, ein Kapitel zu Literalität in Migrantenfamilien, ein Kapitel zu Fördermöglichkeiten für Migrantenkinder und eine Schlussbemerkung. Sie enthält außerdem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was versteht die Arbeit unter "Literalität"?
Die Arbeit definiert Literalität basierend auf Apeltauers Werk als einen umfassenden Prozess, der weit über das reine Lesen und Schreiben hinausgeht und bereits frühe Erfahrungen mit Geschichten, Kritzeleien oder dem eigenen Namen einschließt. Sie betont die Bedeutung von Vorläuferfähigkeiten im Kleinkindalter und den Einfluss der Familie und des familiären Umfelds.
Welche Ergebnisse liefert die Studie von Reyhan Kuyumcu?
Die Studie von Kuyumcu zeigt Schwierigkeiten türkischer Migrantenkinder im Vorschulalter im Umgang mit formeller Schulsprache und einen Mangel an notwendigen Fertigkeiten auf. Sie untersucht die Voraussetzungen, die diese Kinder mitbringen, die Unterschiede zur Mehrheitsgesellschaft und Möglichkeiten der Förderung. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Eltern Bildung zwar wichtig finden, die Verantwortung jedoch oft eher bei Institutionen sehen. Ein Mangel an schriftlichem Material in den Haushalten und Unterschiede in Erzählpraktiken und Medienkonsum werden ebenfalls festgestellt.
Wie kann die Literalität von Migrantenkindern gefördert werden?
Die Arbeit betont die Bedeutung von interaktivem Vorlesen, dem Einbeziehen von Kindern in den schriftlichen Alltag und die Rolle der Eltern und Institutionen bei der Unterstützung des Literalitätserwerbs. Konkrete Fördermöglichkeiten werden zwar nicht detailliert dargestellt, aber die Notwendigkeit einer gezielten Förderung wird hervorgehoben.
Welche Rolle spielen die Eltern und Institutionen?
Die Arbeit hebt die wichtige Rolle der Eltern bei der frühkindlichen Literalitätsförderung hervor, besonders durch interaktives Vorlesen und den Umgang mit Büchern. Gleichzeitig wird der oft fehlende Zugang zu schriftlichem Material in den Haushalten und die Tendenz, die Verantwortung für die Förderung eher bei Institutionen zu sehen, kritisiert. Die Bedeutung der Zusammenarbeit von Elternhaus, Kindergarten und Schule wird implizit betont.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Literalität, Frühe Literalität, Zweisprachigkeit, Migrantenkinder, Migrantenfamilien, Spracherwerb, Schriftspracherwerb, Interkulturelle Bildung, Fördermöglichkeiten, Elternhaus, Kindergarten, Schule.
- Citar trabajo
- Lena Thies (Autor), 2010, Zweisprachigkeit und frühe Literalität. Ausarbeitung der Studie von Reyhan Kuyumcu, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/285795