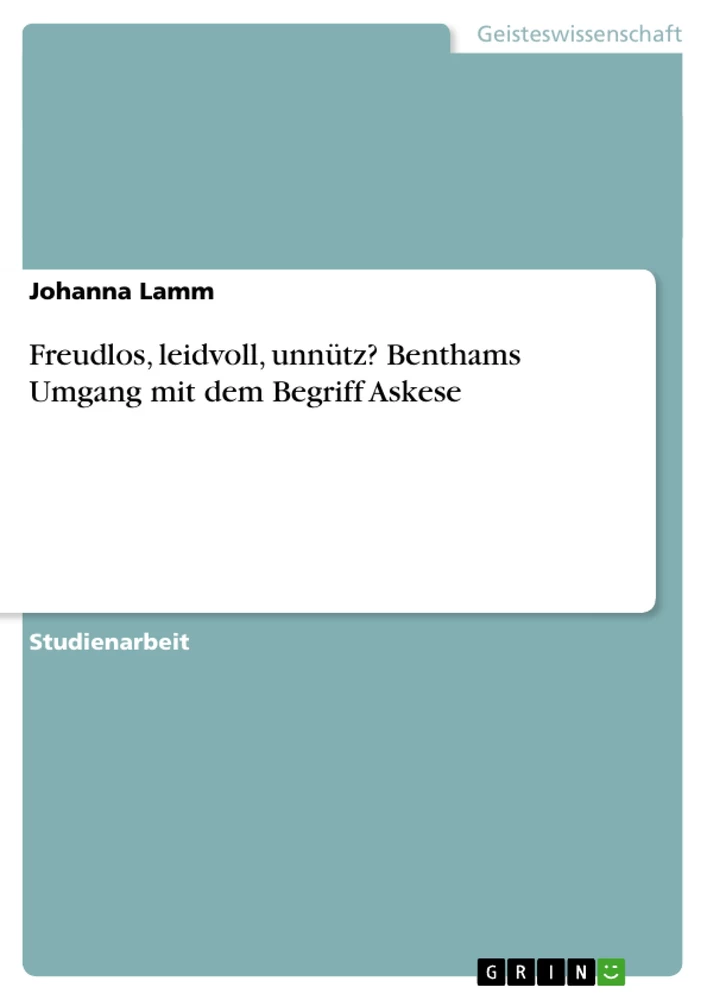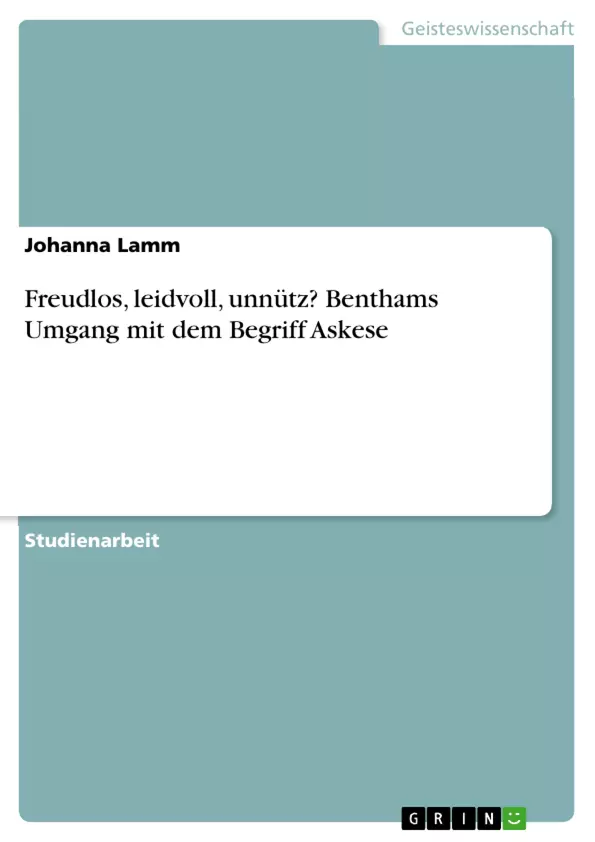Von der Antike bis in die Neuzeit zieht sich der philosophische Diskurs, welche Lebensform denn die richtige sei und das Miteiander und das Befinden des einzelnen Individuums optimiere: Jene der erhöhten Selbstkontrolle, der unterdrückten Gefühle, die die Faszination des Schmerzens und des Leidens zum Antrieb hat? Oder jene, die es als Befreiung und Tapferkeit ansieht, sich seiner Begierden und Lüste zu bekennen und sich der Scham zu entledigen, die das Nachgehen geballter Lust und Triebhaftigkeit aufgrund gesellschaftlicher Normen mit sich bringt?
Wählt nicht jedes Individuum jene Lebensweise für sich aus, die ihm am nützlichsten erscheint? Der Utilitarist Jeremy Bentham stellt in seinem Werk „Der klassische Utilitarismus- Eine Einführung in die Prinzipien der Moral und der Gesetzgebung“ sein „Prinzip der Nützlichkeit“ vor und verteidigt es gegenüber anderen bestehenden Prinzipien, so z.B der Askese. Nachdem ich kurz den Primärtext inhaltlich vorgestellt habe, möchte ich genauer untersuchen, wie Bentham den Begriff „Askese“ für seine Argumentation nutzt. Inwieweit ist sie tatsächlich ein Gegenprinzip zum Utilitarismus? Welche konkreten Vorstellungen von Askese und Einwände hat Bentham und wo zeigen sich Lücken in seinem argumentativen Vorgehen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Inhaltlicher Überblick und Aufbau des Primärtextes
- Untersuchung des Begriffs „Askese“ nach Bentham
- Askese als Prinzip, dass dem Prinzip der Nützlichkeit entgegen gesetzt ist
- Benthams konkreten Einwände gegen Askese und eigene Gedanken dazu
- Motive der Askese
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text „Eine Einführung in die Prinzipien der Moral und der Gesetzgebung“ von Jeremy Bentham (1789) stellt das „Prinzip der Nützlichkeit“ vor und verteidigt es gegenüber anderen Prinzipien, insbesondere der Askese. Die Arbeit untersucht, wie Bentham den Begriff „Askese“ für seine Argumentation nutzt und inwieweit sie tatsächlich ein Gegenprinzip zum Utilitarismus darstellt.
- Das Prinzip der Nützlichkeit als Grundlage für ethisches Handeln
- Die Kritik an der Askese als Gegenprinzip zum Utilitarismus
- Die Motive und Ziele der Askese aus Benthams Sicht
- Die Lücken in Benthams Argumentation und die Kritik an seiner einseitigen Darstellung der Askese
- Die Frage nach der Vereinbarkeit von Askese und dem Prinzip der Nützlichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das Buch „Einführung in die utilitaristische Ethik Klassische und zeitgenössische Texte“ enthält Jeremy Benthams Gedanken zum klassischen Utilitarismus aus dem Jahre 1789. In seinem ersten Kapitel „I. Über das Prinzip der Nützlichkeit“ definiert Bentham dieses Prinzip als jenes, welches „schlechthin jede Handlung billigt oder missbilligt“, die das Glück einer Gruppe zu vermehren oder vermindern sucht. Nützlichkeit bedeutet für ihn die Eigenschaft eines Objektes, „Gewinn, Vorteil, Freude, Gutes oder Glück hervorzubringen“. Das Interesse der Gemeinschaft definiert er als die Summe der Interessen der verschiedenen Mitglieder.
Im zweiten Kapitel „II. Über Prinzipien, die dem Prinzip der Nützlichkeit entgegen gesetzt sind“ stellt Bentham die Askese als ein dem Nützlichkeitsprinzip entgegengesetztes Prinzip dar. Er argumentiert, dass kein anderes Prinzip neben dem seinen argumentativ standhält. Als weitere Gegenströmung zum Prinzip der Nützlichkeit zeigt er jenes der „Sympathie“ und „Antipathie“ auf.
Im dritten Kapitel „III. Über die vier Sanktionen oder Ursprünge von Leid und Freude“ untersucht Bentham die Wirkung von Freude und Leid auf unsere Handlungen. Er identifiziert vier verschiedene Ursprünge, aus denen sich Freude und Leid als Handlungsmotiv und Ursache herleiten lassen: Der physische, der politische, der moralische und der religiöse Ursprung.
Im vierten Kapitel „IV. Wie der Wert einer Menge an Freude oder Leid gemessen werden kann“ stellt Bentham sechs Parameter vor, an denen Freude bzw. Leid eines Individuums gemessen werden kann: Intensität, Dauer, Gewissheit oder Ungewissheit, Nähe oder Ferne, Folgenträchtigkeit und Reinheit des Freide bzw. des Leids.
Im fünften Kapitel „V. Die Arten von Freude und Leid“ geht Bentham auf eine genaue Einteilung von verschiedenen, besonderen Versionen von Freude und Leid ein. Es gibt sowohl einfaches, als auch zusammengesetztes Leid. Gleiches gilt für sein Gegenteil.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Prinzip der Nützlichkeit, die Askese, das Glück, das Leid, die Moral, die Religion, die Sympathie, die Antipathie und die vier Sanktionen. Der Text beleuchtet die Argumentation von Jeremy Bentham, der das Prinzip der Nützlichkeit als Grundlage für ethisches Handeln betrachtet und die Askese als ein Gegenprinzip kritisiert.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Jeremy Bentham unter dem Prinzip der Nützlichkeit?
Es ist das Prinzip, das jede Handlung danach bewertet, ob sie das Glück der betroffenen Gruppe vermehrt oder vermindert.
Wie definiert Bentham den Begriff „Askese“?
Bentham betrachtet die Askese als ein Gegenprinzip zum Utilitarismus, das Freude ablehnt und Leid teilweise als erstrebenswert ansieht.
Was sind die vier Sanktionen nach Bentham?
Bentham nennt vier Ursprünge von Leid und Freude, die menschliches Handeln motivieren: physische, politische, moralische und religiöse Sanktionen.
An welchen Parametern misst Bentham den Wert von Freude?
Er nutzt sechs Parameter: Intensität, Dauer, Gewissheit, Nähe, Folgenträchtigkeit und Reinheit der Freude bzw. des Leids.
Welche Kritik äußert die Arbeit an Benthams Darstellung der Askese?
Die Arbeit untersucht Lücken in Benthams Argumentation und hinterfragt, ob er die Askese zu einseitig als bloßes Gegenprinzip darstellt.
Was ist das Ziel von Benthams Hauptwerk?
Ziel ist eine Einführung in die Prinzipien der Moral und Gesetzgebung, um eine wissenschaftliche Basis für ethisches und rechtliches Handeln zu schaffen.
- Quote paper
- Johanna Lamm (Author), 2013, Freudlos, leidvoll, unnütz? Benthams Umgang mit dem Begriff Askese, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/285851