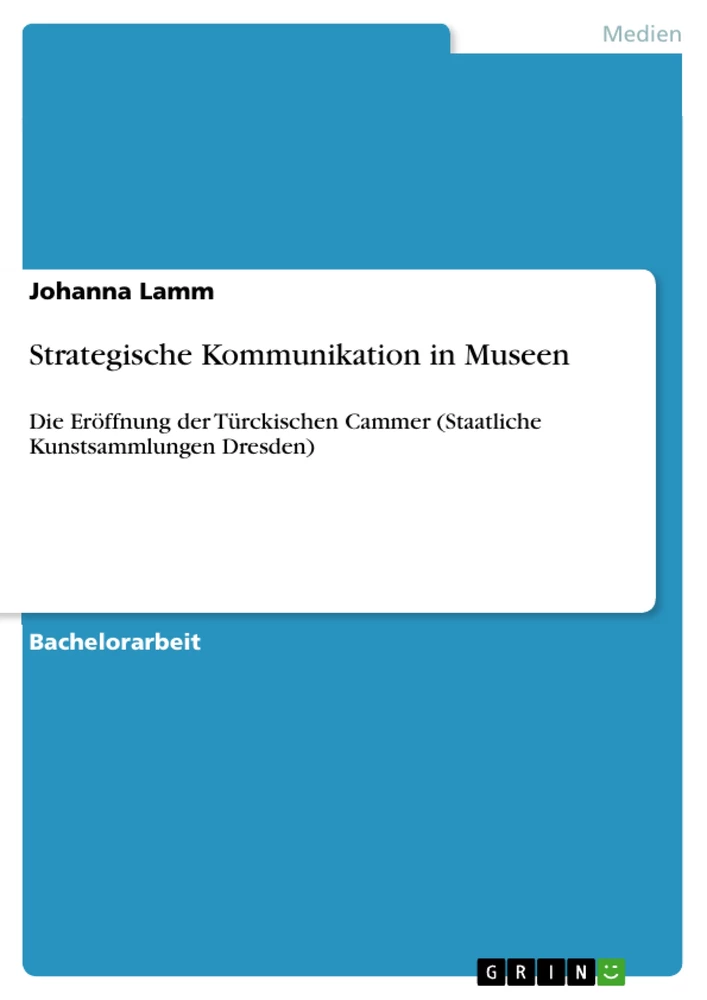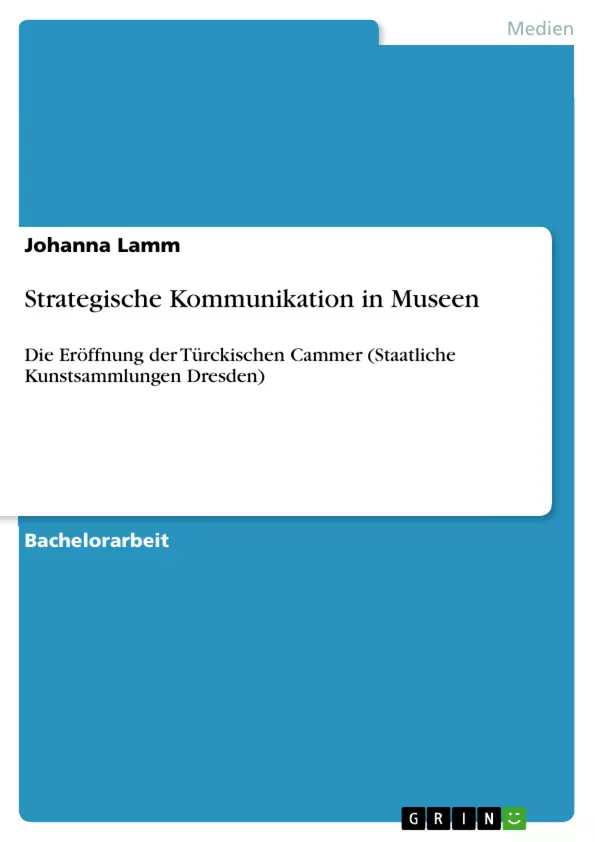Im März 2010 eröffnete die Türckische Cammer, ein Teil der Rüstkammer in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Hier sind osmanische Mode, exotische Kunst und prächtig glänzende Kriegswaffen zu bestaunen. Dies verspricht jedenfalls die Verpackungstüte der Döner, die es im Zeitraum von Februar bis März 2010 bundesweit an vielen Dönerständen zu kaufen gab. Die Ausstellung wurde aufwändig und kreativ umworben – eine kommunikative Strategie, um den Interessen der Organisation „Museum“ gerecht zu werden: Die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen und Besucher anzulocken. Doch lässt sich die Instrumentalisierung einer Dönertüte als Akt strategischer Kommunikation verstehen? In dieser Arbeit möchte ich den Begriff „strategische Kommunikation“ untersuchen und am Beispiel der Eröffnung der Türckischen Cammer dessen Anwendbarkeit für Museen erörtern. Meine Fragestellung lautet somit: Wie lässt sich das Konzept „Strategische Kommunikation“ auf die externe Kommunikation von Museen anwenden –am Beispiel der Eröffnung der Türckischen Cammer zu Dresden? Zunächst werde ich die Türckische Cammer vorstellen, um eine Einführung in den zu Untersuchenden Gegenstand zu geben. Danach erarbeite ich das betriebswirtschaftliche und kommunikationswissenschaftliche Verständnis von „Strategischer Kommunikation“. Da es um das externe strategische Kommunizieren geht, ist Öffentlichkeit eine wichtige Bezugsgröße in diesem Kontext. Im vierten Kapitel möchte ich das Phänomen Öffentlichkeit und dessen Unterscheidungsmöglichkeiten theoretisch hinterfragen und im weiteren Verlauf auf das Museumspublikum als Adressaten von externer musealer Kommunikation eingehen. Neben Öffentlichkeit ist das Museum als Organisation und somit als Akteur strategischer Kommunikation ein weiterer wichtiger Themenkomplex. Hier gebe ich einen Einblick in die Organisationstheorie und werde Aufgaben und Ziele der Dresdener Kunstsammlungen als Organisation und deren Öffentlichkeitsabteilung nennen. Den letzten großen Schwerpunkt bildet der Begriff Strategie. Ohne eine Vorstellung davon zu haben, was eine Strategie ist und welche Voraussetzungen eine Maßnahme erfüllen muss, um strategisch zu sein, kann meine Forschungsfrage nicht beantwortet werden. [...]
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Türckische Cammer
2.1 Staatliche Kunstsammlungen Dresden
2.2 Die Ausstellung
2.3 Die Eröffnung
3. Zum Begriff der Strategischen Kommunikation
3.1 Betriebswirtschaftliches Verständnis
3.2 Kommunikationswissenschaftliches Verständnis
4. Öffentlichkeit und Organisation als zentrale Begriffe strategischer Kommunikation
4.1 Öffentlichkeit und Museum
4.1.1 Kommunikationstheoretischer Ansatz
4.1.2 Publikumsorientierung und Museum
4.2 Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) als Organisation -Betrachtung der Mesoebene
4.2.1 Einblick in die Organisationstheorie
4.2.2 SKD als Museum: Gemeinsame Aufgabe, gemeinsames Ziel der Organisation ..
4.2.3 Museale Öffentlichkeitsarbeit der SKD
5. Strategie
5.1 Zum Begriff der Strategie
5.2 Strategische Konzeptionsplanung
5.3 Taktik und Anwendung im Fall Türckische Cammer
6. Fazit
Literaturverzeichnis
Anhang
A Kampagne zur Eröffnung der Türckischen Cammer
B Kommunikationsplan Türckische Cammer, Januar bis März
C Interview Martina Miesler
D Korrespondenz mit Dr. Stephan Adam
Häufig gestellte Fragen
Was ist die „Türckische Cammer“ in Dresden?
Es ist ein Teil der Rüstkammer der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, in dem osmanische Mode, exotische Kunst und Kriegswaffen ausgestellt werden.
Welche ungewöhnliche Werbeaktion gab es zur Eröffnung?
Die Ausstellung wurde unter anderem auf Dönertüten beworben, die bundesweit an Dönerständen ausgegeben wurden.
Wie wird „Strategische Kommunikation“ im musealen Kontext definiert?
Die Arbeit untersucht den Begriff sowohl aus betriebswirtschaftlicher als auch aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht und prüft die Anwendbarkeit auf die externe Kommunikation von Museen.
Wer ist die Zielgruppe der externen Museumskommunikation?
Die Zielgruppe ist die Öffentlichkeit bzw. das Museumspublikum, wobei die Arbeit die theoretische Unterscheidung von Öffentlichkeit hinterfragt.
Was ist der Unterschied zwischen Strategie und Taktik am Beispiel der SKD?
Die Arbeit analysiert die strategische Konzeptionsplanung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) und wie taktische Maßnahmen (wie die Dönertüten-Aktion) darin eingebettet sind.
- Citation du texte
- Johanna Lamm (Auteur), 2014, Strategische Kommunikation in Museen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/285882