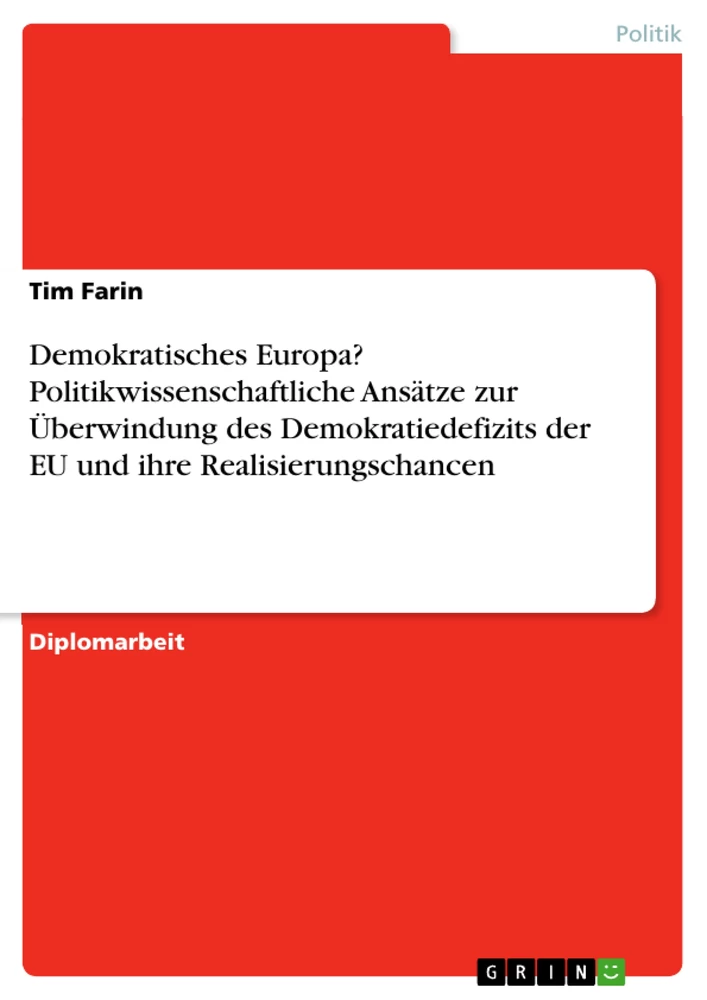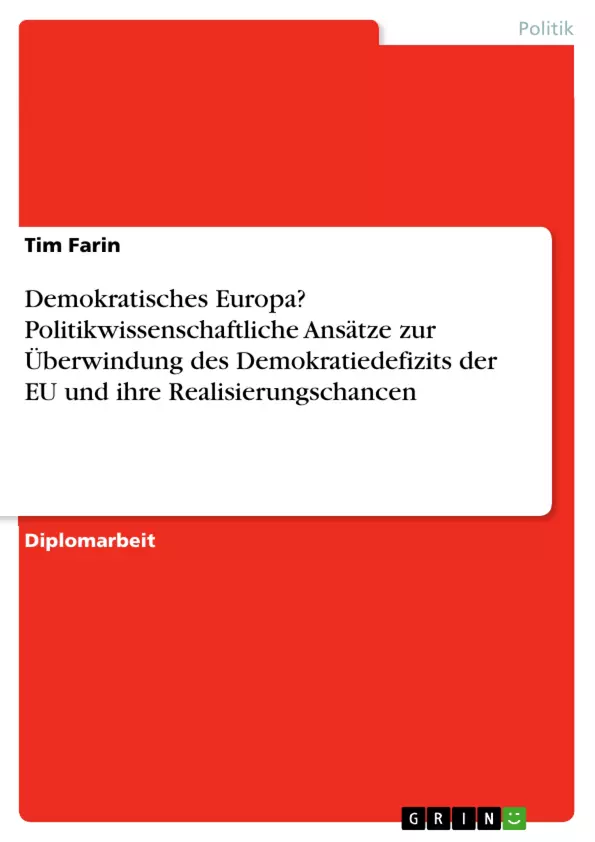Demokratie sei die Macht des Volkes über das Volk, so ist der einschlägigen Argumentation Giovanni Sartoris zu entnehmen (vgl. Sartori 1997: 40). Und Demokratie scheint nicht ersetzbar zu sein. Sie ist für die Machtausübung in unserer Zeit zum ersatzlosen Programm geworden. Fast könnte man den Fehler machen und sich im sicheren Reich der Volksherrschaft wähnen.
In der Bundesrepublik Deutschland wurden die politischen Entscheidungsträger demokratischen Prinzipien verpflichtet, nachdem die Episoden eines Kaisers von Gottes Gnaden oder eines Erlösers der krisengeschüttelten Volksmassen (Kershaw) durch den Tod von Millionen und allgemeines Elend zu einem gewissen „Sättigungsgrad“ bezüglich unkontrollierter autokratischer Herrschaft geführt hatten. Eine westliche Demokratie wurde etabliert, zunehmend zeichnete sie sich als repräsentative aus (vgl. Hesse/Ellwein 1997: 129ff.). Das Grundgesetz sah allgemeine, freie, gleiche und geheime Wahlen vor, begründete die Gewaltenteilung, ordnete Entscheidungskompetenzen, garantierte Grundrechte und Freiheiten, etc.
Herrschaft in diesem politischen System wurde auf der Basis des Grundgesetzes ausgeübt – so dass die Macht vom Volk delegiert und die Rechenschaft der Herrschaft stets mit Bezug auf das Volk dargelegt wurde. In einem solchen System am Volke vorbei zu regieren, hätte bedeutet, die errungene Macht spätestens in den nächsten Wahlen aufs Spiel zu setzen.
Die Bundesrepublik befindet sich jedoch in keinem Vakuum: Sie hat sich mit vielen der umliegenden Staaten zusammengetan, hat sich abgegrenzt von der anderen Seite des eisernen Vorhangs, der einst durch den europäischen Kontinent lief, und hat in diesem Geiste ein Projekt der Integration demokratischer Staaten mitbegründet. Heute ist eine fruchtbare Regierungslehre der Bundesrepublik ohne Berücksichtigung der Union zwecklos, denn die Autonomie der Mitgliedsstaaten schwindet durch wachsende Europäisierung zusehends.
Die vorliegende Arbeit setzt an diesem Punkte an: Der wachsende Einfluss „Brüssels“ auf jeden einzelnen Bürger von Cork, Schwedt, Palermo, Växjö oder Salamanca bedeutet für die Frage nach demokratischer Wahl und Kontrolle von Herrschaft ein Problem. Wenn immer mehr Entscheidungen außerhalb des nationalen Rahmens getroffen werden, in ihm jedoch trotzdem gültig sind, muss die Frage nach der demokratischen Legitimität der Entscheidungen fallen – wenn weiterhin gelten soll, dass die Demokratie als Herrschaftsmodus unersetzbar ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Europas unselbstverständliche Demokratie
- Politik, Europäisierung und Demokratie
- Die Demokratiedefizite der Europäischen Union - Ein Mehrebenensystem mit vielen Defiziten
- Ungenügende demokratische Legitimation durch Mitgliedsstaaten (Internationale Dimension)
- Direkte Legitimation der EU-Organe (Supranationale Dimension)
- Undurchsichtige Komitologie und Europäische Technokratie (Infrationale Dimension)
- Die strukturellen Defizite europäischer Demokratie
- Entwertung der nationalstaatlichen Demokratie
- Die neuartige Herausforderung der europäischen Demokratiedefizite
- EU als internationale Organisation?
- EU als Regimebündel?
- EU als Konföderation?
- EU als föderativer Staat?
- Die EU als Mehrebenen-Politiksystem sui generis
- Ablehnung eines europäischen Mehrheits-Parlamentarismus
- Ablehnung des Rückzugs auf nationale Autonomie
- Aktuelle Reformensätze der Politikwissenschaft
- Reformbeiträge im Rahmen repräsentativer Demokratie
- Ansatzpunkt gouvernementale Repräsentation
- Ansatzpunkt parlamentarische Repräsentation
- Ansatzpunkt assoziative Repräsentation
- Reformensätze im Rahmen direkter Demokratie
- Europaweite Volksentscheide
- Indirekte europäische Volksinitiative
- Freiwillige Referenden
- Zwingendes Referendum
- Direktdemokratische Vetos
- Direktwahl der Kommission
- Abwahlpetition
- Reformensätze im Bereich bürgerlicher Rechte
- Konstitutionalisierung zur Demokratisierung
- Reformbeiträge im Rahmen repräsentativer Demokratie
- Realisierungschancen demokratischer Reformensätze
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Demokratiedefizit der Europäischen Union. Sie analysiert verschiedene Ansätze der Politikwissenschaft, um dieses Defizit zu überwinden, und bewertet deren Realisierungschancen.
- Das Demokratiedefizit der EU
- Politiwissenschaftliche Ansätze zur Überwindung des Defizits
- Realisierungschancen der Ansätze
- Europäisierung und politische Integration
- Demokratische Legitimation und Kontrolle von Herrschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die wachsende Bedeutung der Europäischen Union für die demokratische Gestaltung des politischen Systems. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Europäisierung von Politik und den Auswirkungen auf nationale Demokratiekonzepte. Das dritte Kapitel untersucht die verschiedenen Dimensionen des Demokratiedefizits der EU, von der Legitimation der EU-Organe bis hin zur Transparenz und Kontrolle des Entscheidungsprozesses. Im vierten Kapitel werden verschiedene Konzepte der EU diskutiert und die spezifischen Herausforderungen des Mehrebenensystems in Bezug auf Demokratiedefizite hervorgehoben. Das fünfte Kapitel präsentiert aktuelle Reformensätze der Politikwissenschaft, die darauf abzielen, das Demokratiedefizit der EU zu überwinden. Diese Ansätze reichen von der Stärkung repräsentativer Demokratie bis hin zur Förderung direkter Demokratiemechanismen.
Schlüsselwörter
Europäische Union, Demokratiedefizit, Politiwissenschaft, Europäisierung, Politische Integration, Repräsentative Demokratie, Direkte Demokratie, Legitimation, Kontrolle, Mehrebenensystem, Reformansätze.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das "Demokratiedefizit" der Europäischen Union?
Es beschreibt die mangelnde direkte demokratische Legitimation und Kontrolle von Entscheidungen, die auf EU-Ebene getroffen werden, aber nationale Gesetze beeinflussen.
Welche Dimensionen des Defizits werden in der Arbeit genannt?
Die Arbeit unterscheidet internationale (Mitgliedsstaaten), supranationale (EU-Organe) und infranationale (Komitologie/Technokratie) Dimensionen.
Welche Reformansätze zur direkten Demokratie gibt es?
Diskutiert werden europaweite Volksentscheide, Volksinitiativen, Referenden und die Direktwahl der EU-Kommission.
Wie wird die EU als politisches System charakterisiert?
Die Arbeit beschreibt die EU als ein "Mehrebenen-Politiksystem sui generis", das weder eine reine internationale Organisation noch ein fertiger Bundesstaat ist.
Warum schwindet die Autonomie der Mitgliedsstaaten?
Durch die fortschreitende "Europäisierung" werden immer mehr Kompetenzen nach Brüssel verlagert, was die nationale Gestaltungsmacht einschränkt.
- Citar trabajo
- Tim Farin (Autor), 2000, Demokratisches Europa? Politikwissenschaftliche Ansätze zur Überwindung des Demokratiedefizits der EU und ihre Realisierungschancen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/2858