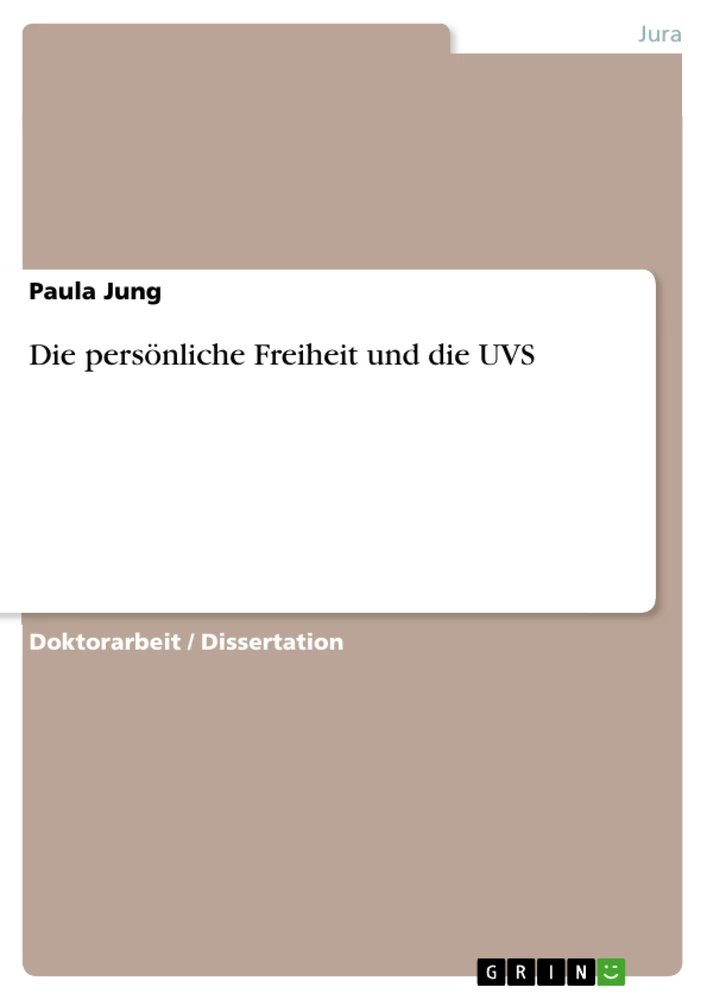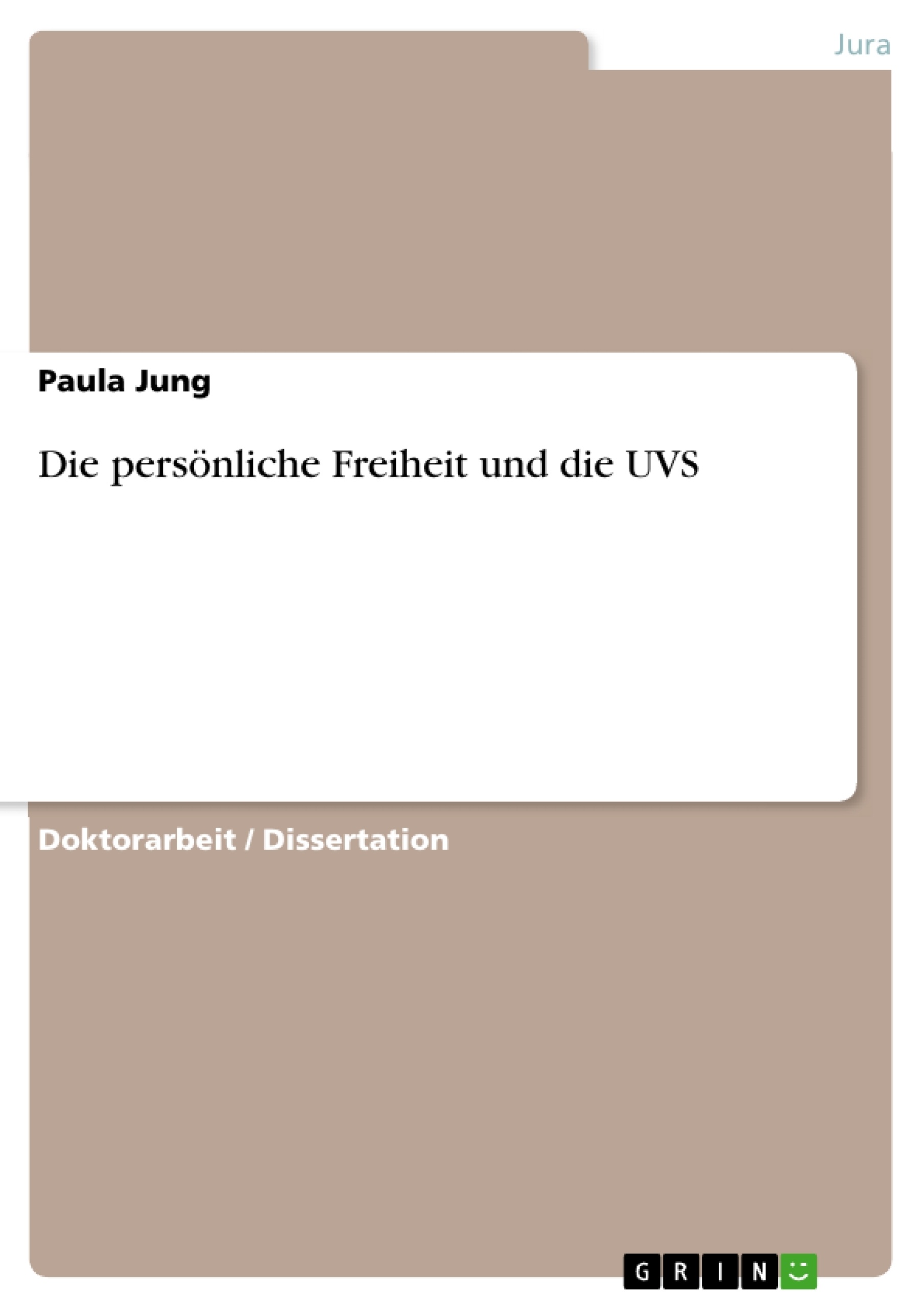E i n l e i t u n g
Ich schreibe meine Dissertation im Bereich des öffentlichen Rechts, da mir dieses Fach bereits in meinem Diplomstudium an mein Herz gewachsen ist. Erklären lässt sich die Liebe zu dieser Materie
damit, dass jeder Mensch unterschiedliche Interessen hat. Außerdem musste ich mich bei meiner früheren Tätigkeit in einem Gemeindeamt täglich mit den beinahe uferlosen Bereichen des öffentlichen Rechts auseinander setzen, was eine gewisse Nahebeziehung mit sich bringt.
Zudem bin ich der Meinung, dass gerade der grundrechtliche Bereich im täglichen Leben nicht immer in entsprechender Form gewürdigt, sondern manchmal sogar etwas stiefmütterlich behandelt
wird.
Im ersten Teil meiner Arbeit beschreibe ich die Grundbegriffe und stelle die Entstehung des Grundrechts auf persönliche Freiheit überblicksmäßig dar.
Der zweite Teil enthält die Regelungen betreffend das Grundrecht auf persönliche Freiheit und ihre Interpretation durch den Verfassungsgerichtshof und den Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte.
Der dritte Teil beinhaltet die Rechtsprechung betreffend das Grundrecht auf persönliche Freiheit.
Im vierten Teil befasse ich mich mit dem Rechtsschutz, der dem Einzelnen bei einer Verletzung des Grundrechts auf persönliche Freiheit zur Verfügung steht.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Erster Teil: Die Grundbegriffe und die Entstehung des Grundrechts auf persönliche Freiheit im Überblick
- 1. Das Grundrecht auf persönliche Freiheit als Grundrecht, Menschenrecht und verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht
- 2. Die Entwicklung der Grundrechte im Überblick
- 2.1. Allgemeines zur Entwicklung der Grundrechte
- 2.2. Der Beginn der positivrechtlichen Garantien
- 2.3. Die Entwicklung der Positivierung des Grundrechts auf persönliche Freiheit in Österreich
- 2.4. Die Entwicklung auf der internationalen Ebene
- Zweiter Teil: Die Regelungen betreffend das Grundrecht auf persönliche Freiheit und ihre Interpretation durch den Verfassungsgerichtshof und den EGMR
- 1. Zu den Rechtsquellen des Grundrechts auf persönliche Freiheit und ihrem Verhältnis
- 2. Der Schutzbereich des Grundrechts auf persönliche Freiheit
- 2.1. Der persönliche Schutzbereich
- 2.2. Der sachliche Schutzbereich
- 2.2.1. Die Einschränkung auf die körperliche Bewegungsfreiheit
- 2.2.2. Die Einschränkung auf den Freiheitsentzug
- 3. Der Gesetzesvorbehalt und das Verhältnismäßigkeitsprinzip
- 4. Die für die UVS relevanten Möglichkeiten eines Freiheitsentzuges
- 4.1. Allgemeines
- 4.2. Der Freiheitsentzug durch eine Verwaltungsbehörde auf Grund eines Straferkenntnisses
- 4.3. Der Freiheitsentzug bei Verdacht einer gerichtlichen oder finanzbehördlichen Straftat
- 4.3.1. Die Regelungen im BVG über den Schutz der persönlichen Freiheit
- 4.3.2. Die Regelungen in Art 5 EMRK
- 4.3.3. Die einfachgesetzlichen Regelungen
- 4.3.3.1. Die Verwahrungshaft nach § 177 Abs 1 StPO und die Fälle des § 175 StPO
- 4.3.3.2. Die Ermächtigungen nach dem Sicherheitspolizeigesetz
- 4.4. Der Freiheitsentzug bei Verdacht einer Verwaltungsübertretung
- 4.4.1. Die Regelungen im BVG über den Schutz der persönlichen Freiheit
- 4.4.2. Die einfachgesetzlichen Regelungen
- 4.4.2.1. Der Freiheitsentzug nach § 35 Verwaltungsstrafgesetz
- 4.4.2.2. Die Beispiele besonderer gesetzlicher Ermächtigung
- 4.5. Der Freiheitsentzug als Beugemittel
- 4.6. Der Freiheitsentzug auf Grund einer gefährlichen Krankheit
- 4.6.1. Die Regelungen im BVG über den Schutz der persönlichen Freiheit
- 4.6.2. Die Regelung in Art 5 EMRK
- 4.6.3. Die einfachgesetzlichen Regelungen zur Verhinderung einer Ansteckungsgefahr
- 4.6.4. Die einfachgesetzlichen Regelungen zur Verhinderung einer Selbst- oder Fremdgefährdung von psychisch kranken Menschen
- 4.6.4.1. Die Voraussetzungen für eine Unterbringung ohne Verlangen
- 4.6.4.2. Die Verfahrensschritte bei einer Unterbringung ohne Verlangen
- 4.6.4.3. Die Vorführung und Verbringung nach § 9 Abs 1 UbG
- 4.6.4.4. Die Vorführung nach § 46 Abs 1 SPG
- 4.6.4.5. Die Verbringung nach § 9 Abs 2 UbG und § 46 Abs 2 SPG
- 4.6.4.6. Die Zuständigkeit der UVS
- 4.7. Der Freiheitsentzug zur Sicherung einer Ausweisung oder einer Auslieferung
- 4.7.1. Die Regelungen im BVG über den Schutz der persönlichen Freiheit
- 4.7.2. Die Regelung in Art 5 EMRK
- 4.7.3. Die einfachgesetzlichen Regelungen des Fremdengesetzes
- 5. Die Informationsrechte des Festgenommenen oder Angehaltenen
- 6. Der Anspruch auf eine Haftentschädigung
- 7. Der Anspruch auf Achtung der Menschenwürde und Schonung der Person
- 7.1. Die verfassungsrechtlichen Regelungen
- 7.2. Die einfachgesetzlichen Regelungen
- Dritter Teil: Die Rechtsprechung betreffend das Grundrecht auf persönliche Freiheit
- 1. Behördenmaßnahmen, die nicht in das Grundrecht auf persönliche Freiheit eingreifen
- 2. Behördenmaßnahmen, die in das Grundrecht auf persönliche Freiheit eingreifen
- 2.1. Die Festnahme
- 2.2. Die Anhaltung
- 3. Der Freiheitsentzug und das Verhältnismäßigkeitsprinzip
- 3.1. Der alkoholisierte Beschwerdeführer
- 4. Die Verstöße gegen das Gebot der schonenden Behandlung und der Achtung der Menschenwürde
- 4.1. Die Überstellung eines halbnackten Beschwerdeführers auf das Kommissariat
- 4.2. Der Beschwerdeführer, der an den Haaren gezerrt und geschlagen wurde
- 5. Die Festnahmen im Dienste der Strafjustiz nach § 177 Abs 1 Z 1 iVm § 175 Abs 1 Z 1 StPO
- 5.1. Die handgreifliche Beschwerdeführerin
- 5.2. Der gefährliche Beruf eines Taxilenkers
- 5.3. Der „Tränengasfall“
- 5.4. Der vermutete Autodiebstahl
- 5.5. Die Sicherheitsorgane als „Kasperlen“ und die „Dachteln“
- 6. Die Festnahmen nach § 35 Verwaltungsstrafgesetz
- 6.1. Der „Schreier“ im Sozialamt
- 6.2. Die Festnahme, die die Sicherheitsorgane ihrer Meinung nach gar nicht durchführten
- 6.3. Der deutsche Staatsbürger mit einem italienischen Wohnsitz
- 6.4. Der deutsche Autoraser, der die Kaution nicht bezahlte
- 6.5. Die Sicherheitsorgane und ihr Misstrauen gegenüber der Visa-Karte
- 6.6. Die Kurdenversammlung
- 6.7. Der ausfällige Beschwerdeführer
- 6.8. Das unsportliche Sicherheitsorgan
- 7. Die Anhaltung nach einer rechtmäßigen Festnahme
- 7.1. Die handgreifliche Beschwerdeführerin
- 7.2. Der gefährliche Beruf eines Taxilenkers
- 7.3. Die gefährliche Verkehrskontrolle
- 7.4. Der vergessliche Beschwerdeführer
- 7.5. Die Kurdenversammlung
- 7.6. Der ausfällige Beschwerdeführer
- 7.7. Der Vorschlaghammer als „unverzichtbares“ Werkzeug der Sicherheitsorgane
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Dissertation untersucht das Grundrecht auf persönliche Freiheit im österreichischen Rechtssystem und dessen Interpretation durch den Verfassungsgerichtshof und den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR). Die Arbeit analysiert die Entwicklung dieses Grundrechts, seinen Schutzbereich und die zulässigen Einschränkungen im Kontext verschiedener behördlicher Maßnahmen, insbesondere im Hinblick auf den Freiheitsentzug.
- Entwicklung des Grundrechts auf persönliche Freiheit in Österreich und international
- Schutzbereich des Grundrechts auf persönliche Freiheit (persönlich und sachlich)
- Zulässige Einschränkungen des Grundrechts und das Verhältnismäßigkeitsprinzip
- Analyse der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs und des EGMR
- Untersuchung verschiedener Formen des Freiheitsentzugs durch Verwaltungsbehörden
Zusammenfassung der Kapitel
Erster Teil: Die Grundbegriffe und die Entstehung des Grundrechts auf persönliche Freiheit im Überblick: Dieser Teil legt die Grundlagen der Arbeit, indem er das Grundrecht auf persönliche Freiheit als Grundrecht, Menschenrecht und verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht definiert und seine historische Entwicklung in Österreich und auf internationaler Ebene nachzeichnet. Es werden die verschiedenen Stadien der Positivierung dieses Grundrechts beleuchtet, von den frühen Anfängen bis zur aktuellen Rechtslage. Die Kapitel analysieren die Schritte der rechtlichen Verankerung und die dabei gemachten Erfahrungen und Entwicklungen. Der erste Teil bildet damit die notwendige Basis für das Verständnis der folgenden Teile der Dissertation.
Zweiter Teil: Die Regelungen betreffend das Grundrecht auf persönliche Freiheit und ihre Interpretation durch den Verfassungsgerichtshof und den EGMR: Dieser Teil befasst sich eingehend mit den Rechtsquellen des Grundrechts auf persönliche Freiheit, ihrem Verhältnis zueinander und dem Schutzbereich. Er analysiert die verschiedenen Möglichkeiten eines Freiheitsentzugs im Detail, unterteilt nach den jeweiligen gesetzlichen Grundlagen und den beteiligten Behörden. Die Kapitel untersuchen die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Freiheitsentzüge im Kontext von Straftaten, Verwaltungsübertretungen und anderen gesetzlichen Ermächtigungen, einschließlich der Beugemittel, der Unterbringung wegen gefahren durch Krankheit und der Sicherung von Ausweisungen oder Auslieferungen. Dabei werden die relevanten Bestimmungen des Bundes-Verfassungsgesetzes (BVG) und der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) eingehend geprüft und mit der einschlägigen Rechtsprechung in Verbindung gesetzt. Die Bedeutung des Verhältnismäßigkeitsprinzips wird hierbei besonders hervorgehoben.
Dritter Teil: Die Rechtsprechung betreffend das Grundrecht auf persönliche Freiheit: Der dritte Teil analysiert die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes und des EGMR bezüglich des Grundrechts auf persönliche Freiheit. Hier werden konkrete Fälle und Entscheidungen untersucht, die das Verhältnis zwischen behördlichen Maßnahmen und dem Grundrecht auf persönliche Freiheit beleuchten. Die Analyse fokussiert auf Fälle, in denen die Rechtmäßigkeit von Festnahmen, Anhaltungen und Freiheitsentzügen geprüft wurde, und zeigt auf, unter welchen Bedingungen eingriffe in das Grundrecht als verhältnismäßig und damit zulässig angesehen werden. Die Kapitel beleuchten auch Verstöße gegen das Gebot der schonenden Behandlung und der Achtung der Menschenwürde und deren rechtlichen Konsequenzen. Durch die Auswertung von vielen Einzelentscheidungen wird ein umfassendes Bild der praktischen Anwendung des Grundrechts gezeichnet.
Schlüsselwörter
Grundrecht auf persönliche Freiheit, Österreich, Verfassungsgerichtshof, EGMR, Menschenrechte, Freiheitsentzug, Verhältnismäßigkeitsprinzip, Verwaltungsstrafgesetz, Sicherheitspolizeigesetz, Verwahrungshaft, Beugemittel, Unterbringung, Ausweisung, Auslieferung, Rechtsprechung, Behördenmaßnahmen, Festnahme, Anhaltung.
Häufig gestellte Fragen zur Dissertation: Das Grundrecht auf persönliche Freiheit im österreichischen Recht
Was ist der Gegenstand dieser Dissertation?
Die Dissertation untersucht das Grundrecht auf persönliche Freiheit im österreichischen Rechtssystem und dessen Interpretation durch den Verfassungsgerichtshof und den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR). Sie analysiert die Entwicklung dieses Grundrechts, seinen Schutzbereich und die zulässigen Einschränkungen im Kontext verschiedener behördlicher Maßnahmen, insbesondere im Hinblick auf den Freiheitsentzug.
Welche Themen werden in der Dissertation behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Grundrechts auf persönliche Freiheit in Österreich und international, den persönlichen und sachlichen Schutzbereich dieses Grundrechts, zulässige Einschränkungen und das Verhältnismäßigkeitsprinzip, die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs und des EGMR sowie verschiedene Formen des Freiheitsentzugs durch Verwaltungsbehörden.
Wie ist die Dissertation aufgebaut?
Die Dissertation gliedert sich in drei Teile: Der erste Teil befasst sich mit den Grundbegriffen und der Entstehung des Grundrechts auf persönliche Freiheit. Der zweite Teil analysiert die Regelungen zum Grundrecht und deren Interpretation durch den Verfassungsgerichtshof und den EGMR. Der dritte Teil untersucht die einschlägige Rechtsprechung anhand konkreter Fälle.
Welche Rechtsquellen werden untersucht?
Die Dissertation analysiert die relevanten Bestimmungen des Bundes-Verfassungsgesetzes (BVG) und der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) sowie einschlägige einfachgesetzliche Regelungen wie das Verwaltungsstrafgesetz und das Sicherheitspolizeigesetz.
Welche Arten von Freiheitsentzug werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht den Freiheitsentzug im Kontext von Straftaten, Verwaltungsübertretungen, Beugemitteln, Unterbringung wegen gefährlicher Krankheiten und Sicherung von Ausweisungen oder Auslieferungen.
Welche Rolle spielt das Verhältnismäßigkeitsprinzip?
Das Verhältnismäßigkeitsprinzip spielt eine zentrale Rolle in der Analyse der zulässigen Einschränkungen des Grundrechts auf persönliche Freiheit. Die Dissertation prüft, unter welchen Bedingungen Eingriffe in dieses Grundrecht als verhältnismäßig und damit zulässig angesehen werden.
Wie wird die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs und des EGMR behandelt?
Der dritte Teil der Dissertation analysiert die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs und des EGMR anhand konkreter Fälle, die das Verhältnis zwischen behördlichen Maßnahmen und dem Grundrecht auf persönliche Freiheit beleuchten. Die Analyse fokussiert auf die Rechtmäßigkeit von Festnahmen, Anhaltungen und Freiheitsentzügen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Dissertation?
Schlüsselwörter sind: Grundrecht auf persönliche Freiheit, Österreich, Verfassungsgerichtshof, EGMR, Menschenrechte, Freiheitsentzug, Verhältnismäßigkeitsprinzip, Verwaltungsstrafgesetz, Sicherheitspolizeigesetz, Verwahrungshaft, Beugemittel, Unterbringung, Ausweisung, Auslieferung, Rechtsprechung, Behördenmaßnahmen, Festnahme, Anhaltung.
- Quote paper
- Paula Jung (Author), 2001, Die persönliche Freiheit und die UVS, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/2861