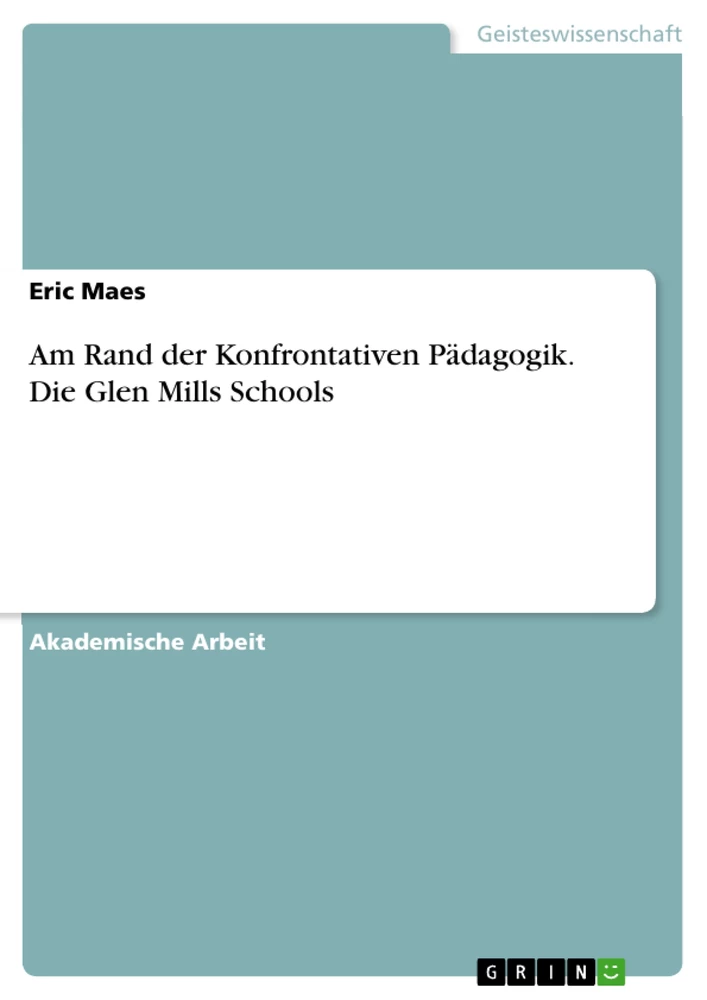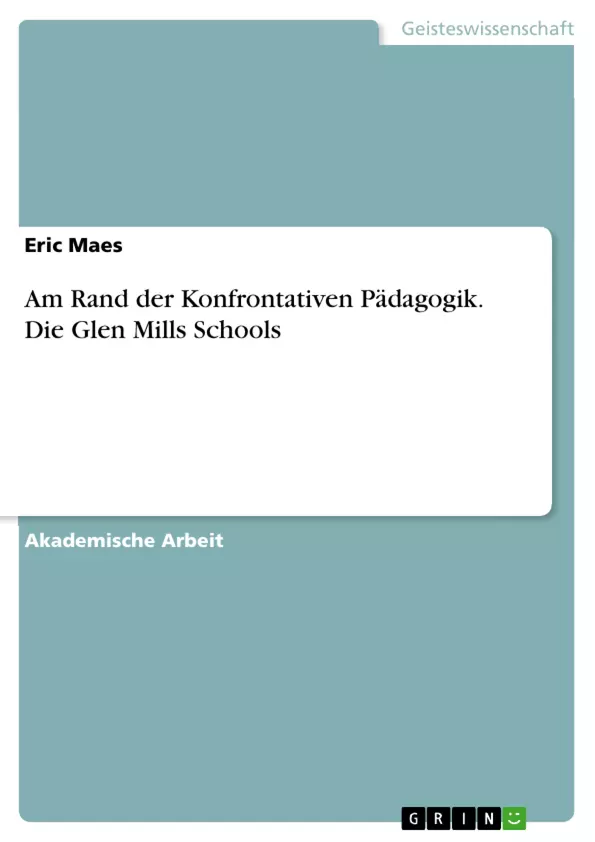Die Glen Mills Schools ist eine private, offene und stationäre Einrichtung in Philadelphia/ USA. Sie sind die älteste, heute noch bestehende ‚Jugend-Verbesserungs-Anstalt’ der Vereinigten Staaten. Sie ist unabhängig und eine gemeinnützige Stiftung in der Form eines Internates.
Sie beherbergt delinquente, gewalt- und gangorientierte jugendliche Wiederholungstäter aus New York, Washington, Baltimore und Philadelphia, die hier nicht negativ ‚gelabelt’ werden, sondern ‚normale’ ‚students’ sind. Diese Mehrfachtäter sind aggressiv-manipulativ und subkulturell engagiert.
Weidner beschreibt die Schools als eine Art Mischung „aus komfortablem, lern- und ausbildungsorientierten Universitäts-Campus und strukturiertem Alltag einer deutschen Sozialtherapie“. Die Schule versteht sich nach dem Motto „Service to the Youth since 1826“ als Dienstleistungsanbieter für über 980 Täter, die von den Gerichten zugewiesen wurden.
Ziel dieser Anstalt ist die „Transformation vorinstitutioneller Verhaltensstandards in den institutionellen Alltag“. Dies geschieht durch die Neuorganisation der Gang-Strukturen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Philosophie Ferrainolas'
- Die Voraussetzungen in der amerikanischen Gesellschaft
- Die Praxis in Glen-Mills und die Konfrontation
- Deutsche Bedenken an Glenn-Mills
- Literaturverzeichnis (inklusive weiterführender Literatur)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Glen Mills Schools, eine private, offene und stationäre Einrichtung in Philadelphia/USA, stehen im Zentrum dieser Arbeit. Die Studie analysiert die Geschichte und Praxis der Glen Mills Schools, die als älteste, heute noch bestehende Jugend-Verbesserungsanstalt der Vereinigten Staaten gilt. Der Fokus liegt auf der Konfrontativen Pädagogik, die in den 1980er Jahren in Glen Mills implementiert wurde und die Grundlage für die Transformation von delinquenten Jugendlichen bildet.
- Die Philosophie der Konfrontativen Pädagogik nach Dr. C. D. Ferrainola
- Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in den USA, die zur Entstehung der Glen Mills Schools führten
- Die Praxis der Konfrontativen Pädagogik in Glen Mills
- Die Kritik an der Konfrontativen Pädagogik aus deutscher Perspektive
- Die Entwicklung der Glen Mills Schools im Laufe der Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Glen Mills Schools ein und stellt die Institution sowie ihre Geschichte vor. Sie beleuchtet die Zielsetzung der Schule und die Besonderheiten der dort betreuten Jugendlichen.
Das Kapitel "Die Philosophie Ferrainolas'" stellt die Lebensmaxime und die pädagogischen Grundprinzipien von Dr. C. D. Ferrainola, dem Gründer der Glen Mills Schools, vor. Es werden die zentralen Elemente der Konfrontativen Pädagogik erläutert und in einem Vergleich mit traditionellen pädagogischen Modellen dargestellt.
Das Kapitel "Die Voraussetzungen in der amerikanischen Gesellschaft" beleuchtet die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in den USA, die zur Entstehung der Glen Mills Schools führten. Es werden die Ursachen für Jugenddelinquenz in den USA analysiert und die Rolle der Glen Mills Schools in diesem Kontext dargestellt.
Das Kapitel "Die Praxis in Glen Mills und die Konfrontation" beschreibt die konkrete Umsetzung der Konfrontativen Pädagogik in den Glen Mills Schools. Es werden die Methoden und Techniken der Konfrontation erläutert und die Auswirkungen auf die Jugendlichen dargestellt.
Das Kapitel "Deutsche Bedenken an Glenn-Mills" beleuchtet die Kritik an der Konfrontativen Pädagogik aus deutscher Perspektive. Es werden die ethischen und pädagogischen Bedenken gegen die Methoden der Konfrontation diskutiert und die Unterschiede zwischen dem amerikanischen und dem deutschen Jugendstrafrecht beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Glen Mills Schools, Konfrontative Pädagogik, Jugenddelinquenz, Jugendstrafrecht, USA, Deutschland, Dr. C. D. Ferrainola, Transformation, Verhaltensänderung, Sozialtherapie, Institution, Jugendhilfe, Kritik, ethische Aspekte, pädagogische Prinzipien, Vergleich, gesellschaftliche Rahmenbedingungen, Methoden, Techniken, Auswirkungen, Entwicklung, Differenzen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Glen Mills Schools?
Die Glen Mills Schools in Philadelphia sind eine private, offene Jugend-Verbesserungsanstalt für delinquente, gewaltbereite jugendliche Wiederholungstäter. Sie existiert seit 1826 als gemeinnützige Stiftung.
Was ist das Ziel der pädagogischen Arbeit in Glen Mills?
Ziel ist die Transformation antisozialer Verhaltensstandards in den institutionellen Alltag, vor allem durch die Neuorganisation von Gang-Strukturen und die Förderung eines positiven sozialen Klimas.
Wer begründete die Philosophie der Konfrontativen Pädagogik dort?
Die Implementierung der Konfrontativen Pädagogik in den 1980er Jahren geht maßgeblich auf Dr. C. D. Ferrainola zurück.
Warum werden die Jugendlichen dort als „students“ bezeichnet?
Um negatives „Labeling“ zu vermeiden, werden die Täter nicht als Kriminelle, sondern als normale Studenten betrachtet, was Teil des therapeutischen Konzepts ist.
Welche Kritik gibt es aus deutscher Sicht an diesem Modell?
Deutsche Experten äußern oft ethische und pädagogische Bedenken gegen die harten Methoden der Konfrontation und verweisen auf die Unterschiede zwischen dem amerikanischen und deutschen Jugendstrafrecht.
- Arbeit zitieren
- Eric Maes (Autor:in), 2004, Am Rand der Konfrontativen Pädagogik. Die Glen Mills Schools, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/286212