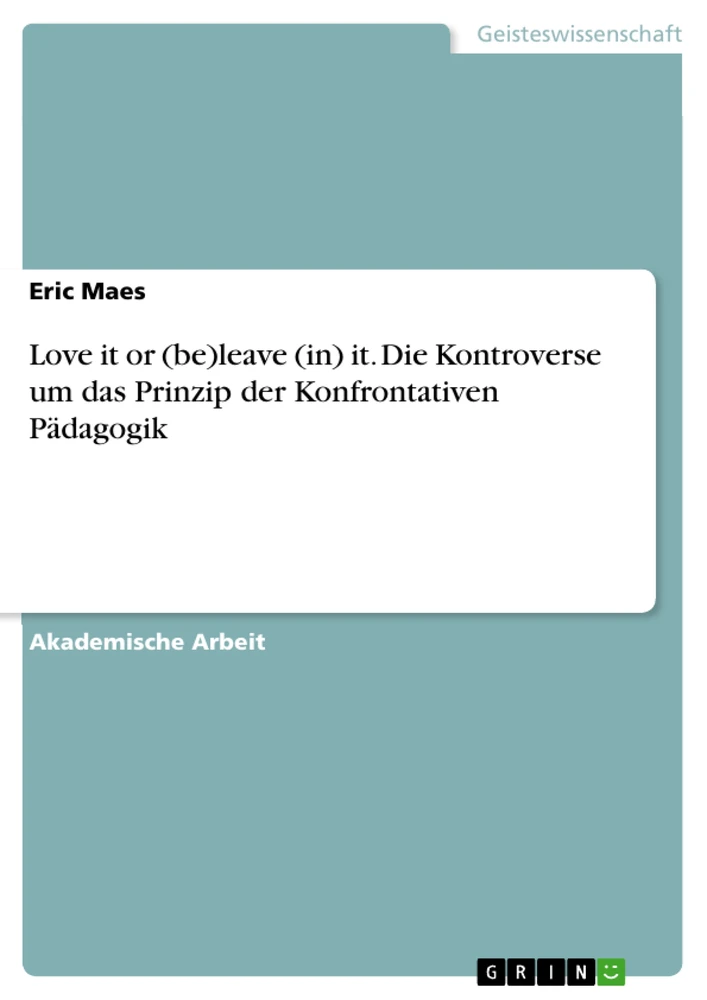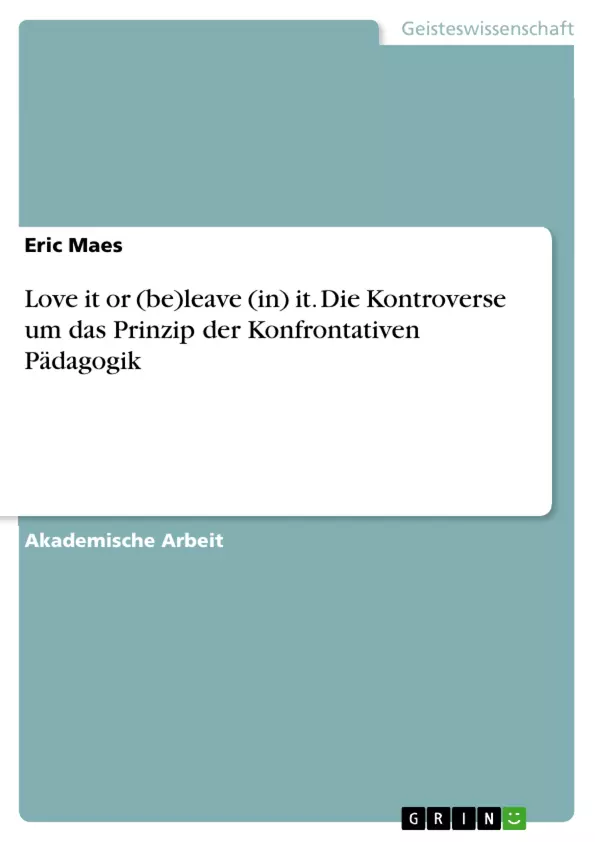Auch aufgrund der Tatsache, dass Gewalt zum gesellschaftspolitischen Thema avanciert ist, nimmt die „... Angst vor Gewalttaten ... nach Umfrageergebnissen alarmierend zu und behindert schon die Bewegungsfreiheit der Menschen“ (ebd.). [...] Anzumerken ist dabei jedoch, dass die objektive Kriminalitätslage in den Medien oft nur (absichtlich) verkannt wird und solche ‚events’ überproportional zu anderen Themenkomplexen dargestellt werden. [...]
Die Jugendkriminalität im unteren Schwerebereich liegt laut dem Ersten Periodischen Sicherheitsbericht im ‚normalen’ Bereich und ist eine ‚entwicklungsbedingte Auffälligkeit’. „Schwere, die körperliche Integrität des einzelnen Bürgers beeinträchtigende Straftaten sind – quantitativ vergleichend betrachtet – seltene Ereignisse.“ und „Mehrfachtäter oder gar Intensivtäter bilden eine kleine Minderheit.“
Nebenbei sei angemerkt, dass junge Menschen sogar häufiger Gewaltopfer als Gewalttäter sind und wohl auch gerade deshalb besonders die Aufmerksamkeit und den Schutz (Opfer wie Täter) der Gesellschaft verdienen. Es ist auch nicht gerade unbekannt, das fast jeder Täter schon einmal selber Opfer war. Deshalb scheint eine rein repressive Antwort oder gar eine Verschärfung der Strafen pädagogisch nicht nachvollziehbar. Vielmehr werden in letzter Zeit nicht nur immer mehr präventive und prophylaktische Maßnahmen für die Opfer und die Gesellschaft sondern auch für die Täter gefordert und auch „... wenn Schlussfolgerungen von Wissenschaftlern so ziemlich alles über den Haufen (werfen), was in der Öffentlichkeit an ‚Legenden’ über Jugendgewalt kursiert, so sind dennoch Sozialpolitik und Sozialarbeit gefordert.“ [...]
Und hier ist es die Soziale Arbeit, „... die hochtrabende Konzeptideen in die Praxis transferiert und sich nicht mit einer gelungenen individuellen und/ oder gesellschaftsorientierten Ursachenanalyse zufrieden gibt. ... “.
In diesem Rahmen entwickelt Weidner auch den erziehungswissenschaftlichen Begriff der Konfrontativen Pädagogik und versucht unter diesen die Methode des Anti-Aggressivitäts-Trainings sowie des Coolness-Trainings zu subsumieren.
Auch auf dieses Konzept erfolgte ein Echo in der Wissenschaft und den Medien, auf welches im Folgenden näher eingegangen werden soll. Außerdem sollte diskutiert werden, inwiefern der Pädagoge selber als Verkäufer seines Produkts in Erscheinung treten sollte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kritiken am Phänomen aus wissenschaftlicher Sicht
- Kilb und Weidner – keine Wiederbelebung autoritärer Strukturen
- Titus Simon - Wo Zuwendung nicht hilft, hilft Konfrontation?!?!
- Timm Kunstreich – Der Kaiser ist ja nackt! – Ein heroisch anmutendes Bekenntnis!!
- Albert Scherr - Das richtige Rezept für harte Jungs?
- Michael Winkler - Verliebt in das eigene Programm!
- Das Medien-Echo..
- Der Pädagoge als Verkäufer seines Produkts..
- Literaturverzeichnis (inklusive weiterführender Literatur).
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der kontroversen Debatte um die Konfrontative Pädagogik, insbesondere im Kontext von Anti-Aggressivitäts- und Coolness-Trainings. Ziel ist es, die Kritikpunkte an diesem Konzept aus wissenschaftlicher Sicht aufzuzeigen und die Diskussion um die Rolle des Pädagogen als „Verkäufer seines Produkts“ zu beleuchten.
- Die Kritik an der Konfrontativen Pädagogik aus verschiedenen Perspektiven
- Die Abgrenzung von autoritären und permissiven Erziehungsstilen
- Die Bedeutung von individuellen Lern- und Entwicklungsprozessen
- Die Rolle von Vertrauen und Beziehungsaufbau in der Konfrontativen Pädagogik
- Die Erfolgsbilanz von Anti-Aggressivitäts- und Coolness-Trainings
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer Einleitung, die die gesellschaftliche Debatte um Gewalt und die Notwendigkeit präventiver Maßnahmen beleuchtet. Kapitel 1 befasst sich mit der Kritik an der Konfrontativen Pädagogik aus wissenschaftlicher Sicht. Die Artikel von Kilb und Weidner, sowie die kritischen Stellungnahmen von Simon, Kunstreich, Scherr und Winkler werden vorgestellt und analysiert. Im Fokus stehen die Argumentationslinien der Autoren und ihre unterschiedlichen Perspektiven auf die Konfrontative Pädagogik.
Kapitel 2 beleuchtet das Medien-Echo auf die Konfrontative Pädagogik. Es wird untersucht, wie dieses Konzept in der Öffentlichkeit dargestellt wird und welche Auswirkungen dies auf die Wahrnehmung der Methode hat. Kapitel 3 widmet sich schließlich dem Thema des Pädagogen als „Verkäufer seines Produkts“. Die Frage, inwieweit sich der Pädagoge als Unternehmer verhalten sollte, wird diskutiert.
Schlüsselwörter
Konfrontative Pädagogik, Anti-Aggressivitäts-Training, Coolness-Training, Jugendgewalt, Prävention, Soziale Arbeit, Medienrezeption, Erziehungsstil, Autorität, Vertrauen, Beziehungsaufbau, Kritik, wissenschaftliche Debatte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Konfrontative Pädagogik?
Es ist ein erziehungswissenschaftliches Konzept, das Methoden wie Anti-Aggressivitäts-Training (AAT) und Coolness-Training (CT) nutzt, um aggressives Verhalten direkt zu spiegeln und zu korrigieren.
Warum ist dieses pädagogische Prinzip umstritten?
Kritiker werfen der Methode vor, autoritäre Strukturen wiederzubeleben oder lediglich repressive Antworten auf komplexe soziale Probleme zu geben.
Welche Rolle spielen Medien in der Debatte um Jugendgewalt?
Die Arbeit stellt fest, dass Medien Gewalttaten oft überproportional darstellen, was die öffentliche Angst schürt, obwohl schwere Straftaten statistisch seltener sind.
Was bedeutet der Begriff „Pädagoge als Verkäufer“?
Es wird diskutiert, inwieweit Pädagogen ihre Konzepte wie Produkte vermarkten („verliebt in das eigene Programm“) und ob dies die professionelle Distanz gefährdet.
Sind jugendliche Gewalttäter oft auch selbst Opfer?
Ja, die Arbeit weist darauf hin, dass fast jeder Täter zuvor selbst Opfererfahrungen gemacht hat, was rein repressive Strafen pädagogisch fragwürdig macht.
- Citation du texte
- Eric Maes (Auteur), 2004, Love it or (be)leave (in) it. Die Kontroverse um das Prinzip der Konfrontativen Pädagogik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/286213