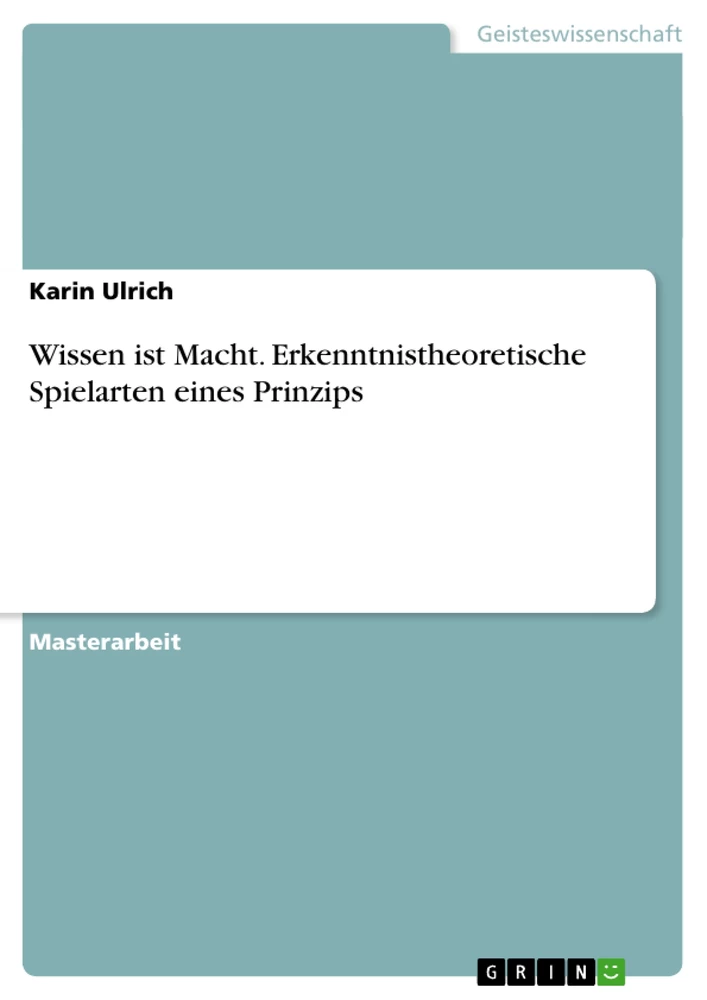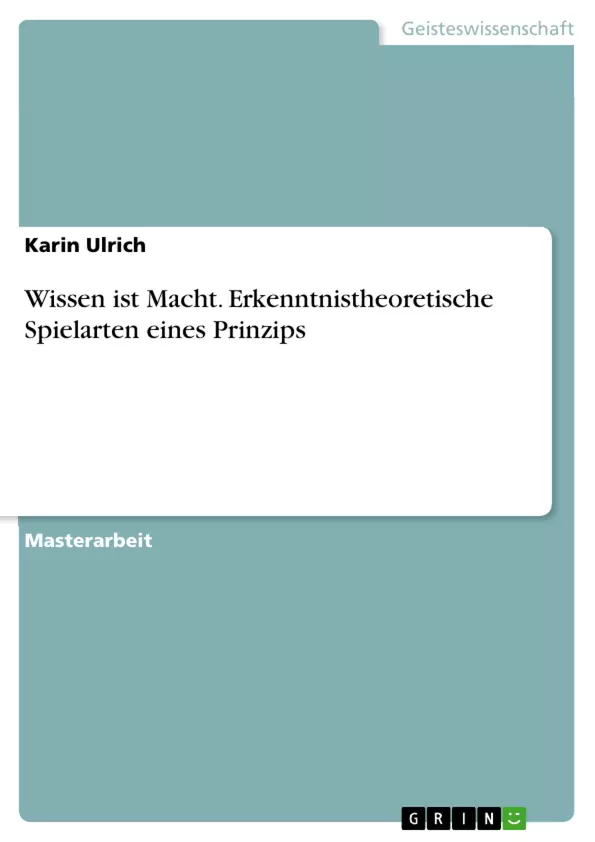Aus der altbekannten Volksweisheit "Es kommt oft anders als man denkt" lässt sich ein ganz bestimmtes wissenschaftsphilosophisches Motiv oder eine Denkfigur ableiten, die der amerikanische Physiker und Nobelpreisträger Richard Feynman (1918-1988) seinerzeit wie folgt ausdrückte: „What I cannot create, I do not understand.“ Dieses Diktum, das ein ganzes philosophisches Projekt rahmt, und das heute, im Kontext der synthetischen Biologie in neuem Glanz erscheint, geht auf Namen wie Thomas von Aquin, Francis Bacon, Giambattista Vico oder auch Jaques Loeb zurück. Die Frage, die ich in Anlehnung daran stellen möchte ist, was es nun rein faktisch mit dem „Herstellen“ (create) und dem „Verstehen“ (understand) im dargebotenen wissenschaftsphilosophischen Kontext auf sich hat. Offenkundig ist, dass es hier zum einen um eine ganz spezifische Art von Wissen geht und zum anderen um das Verstehen oder Erkennen was selbst entworfen oder erschaffen wurde. Streng methodologisch betrachtet akzentuiert das Postulat eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung etwas zu verstehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundgedanken zu Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit
- 2.1. Fundamente der klassischen Wissenschaft
- 2.1.1. Über wissenschaftliches Wissen
- 2.2. Über technowissenschaftliches Wissen und den Kontext von Konstruktivismus und Realismus
- 2.1. Fundamente der klassischen Wissenschaft
- 3. Creating Understanding – Eine epistemische Verlagerung
- 3.1. Thomas von Aquin – Über göttliches Wissen
- 3.1.1. Leben und Werk des Aquinaten (1225-1274)
- 3.1.2. Über Thomas' Verhältnis zu Philosophie und Theologie
- 3.1.2.1. Einblicke in seine Schrift De veritate
- 3.1.3. Die Offenbarungswahrheit als Erkenntnisgegenstand
- 3.2. Francis Bacon - Wissen ist Macht
- 3.2.1. Leben und Werk des Francis Bacon (1561-1626)
- 3.2.1.1. Die große Erneuerung – Das Novum Organum
- 3.2.2. Die Theorie des Erkennens
- 3.2.2.1. Methode und Wissensgenese
- 3.2.2.2. Wissen und Macht
- 3.2.1. Leben und Werk des Francis Bacon (1561-1626)
- 3.3. Giambattista Vico - Das verum-factum-Prinzip
- 3.3.1. Leben und Werk des Giambattista Vico (1668-1744)
- 3.3.1.1. Kurzer Einblick in Vicos Rezeptionsgeschichte
- 3.3.2. Grundpfeiler der vichianischen Philosophie
- 3.3.2.1. Das verum-factum-Theorem
- 3.3.1. Leben und Werk des Giambattista Vico (1668-1744)
- 3.1. Thomas von Aquin – Über göttliches Wissen
- 4. Erkenntnistheoretische Spielarten eines Prinzips – Eine kritische Reflexion
- 4.1. Über Realkonstruktivismus und Werkwahrheit
- 4.2. Bacons Methode der Forschung - Ein abschließender kritischer (Aus-)Blick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht erkenntnistheoretische Aspekte des Prinzips „Wissen ist Macht“, indem sie verschiedene philosophische Positionen und deren Verständnis von Wissen und Erkenntnis analysiert. Die Arbeit beleuchtet, wie das Herstellen von etwas ("creating") mit dem Verstehen ("understanding") verbunden ist und welche methodologischen Implikationen sich daraus ergeben. Der Fokus liegt auf der kritischen Reflexion der zugrundeliegenden epistemologischen Annahmen.
- Die Beziehung zwischen Herstellung und Verständnis von Wissen
- Die Rolle von Methoden in der Wissensgenerierung
- Eine kritische Auseinandersetzung mit dem "Wissen ist Macht"-Prinzip
- Vergleichende Analyse verschiedener philosophischer Positionen (Aquin, Bacon, Vico)
- Bedeutung des Konstruktivismus und Realismus im technowissenschaftlichen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Zusammenhang zwischen „Herstellen“ und „Verstehen“ im Kontext des Prinzips „Wissen ist Macht“ vor. Sie verweist auf die vieldeutige Interpretation des Sprichworts „Es kommt oft anders als man denkt“ und knüpft an Feynmans Diktum „What I cannot create, I do not understand“ an. Die Einleitung legt die methodologische Grundlage der Arbeit fest und skizziert den weiteren Verlauf der Argumentation.
2. Grundgedanken zu Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit: Dieses Kapitel erörtert fundamentale Aspekte der klassischen Wissenschaft und erweitert den Diskurs auf den Bereich technowissenschaftlichen Wissens. Es analysiert die epistemologischen Grundlagen der klassischen Wissenschaft und setzt diese in Beziehung zu den Herausforderungen und Möglichkeiten der Technowissenschaft im Kontext von Konstruktivismus und Realismus. Der Abschnitt legt einen wichtigen Grundstein für das Verständnis des Verhältnisses zwischen Theorie und Praxis in der Wissensgenerierung.
3. Creating Understanding – Eine epistemische Verlagerung: Dieses Kapitel analysiert die epistemologischen Positionen von Thomas von Aquin, Francis Bacon und Giambattista Vico. Es beleuchtet deren jeweilige Konzepte von Wissen, Erkenntnis und die Verbindung zur Handlung und Praxis. Aquin's Konzept von göttlichem Wissen steht im Kontrast zu Bacons empirisch-induktivem Ansatz und Vicos verum-factum-Prinzip, das die wechselseitige Beziehung zwischen Wissen und Handlung betont. Die Kapitel veranschaulicht die Entwicklung und Vielfalt epistemologischer Ansätze über die Jahrhunderte hinweg.
4. Erkenntnistheoretische Spielarten eines Prinzips – Eine kritische Reflexion: Dieses Kapitel widmet sich einer kritischen Auseinandersetzung mit dem "Wissen ist Macht"-Prinzip im Lichte der vorherigen Kapitel. Es reflektiert die Implikationen von Realkonstruktivismus und Werkwahrheit, unterzieht Bacons Forschungsmethode einer kritischen Analyse und fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen, ohne dabei konkrete Schlussfolgerungen vorwegzunehmen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: "Creating Understanding – Eine epistemische Verlagerung"
Was ist der Gegenstand der Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht erkenntnistheoretische Aspekte des Prinzips „Wissen ist Macht“. Sie analysiert verschiedene philosophische Positionen und deren Verständnis von Wissen und Erkenntnis, insbesondere den Zusammenhang zwischen dem Herstellen von etwas ("creating") und dem Verstehen ("understanding"). Ein Schwerpunkt liegt auf der kritischen Reflexion der zugrundeliegenden epistemologischen Annahmen im Kontext von Konstruktivismus und Realismus, besonders im technowissenschaftlichen Bereich.
Welche Philosophen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert die epistemologischen Positionen von Thomas von Aquin, Francis Bacon und Giambattista Vico. Ihre Konzepte von Wissen, Erkenntnis und deren Verbindung zu Handlung und Praxis werden verglichen und kontrastiert.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Die Beziehung zwischen Herstellung und Verständnis von Wissen, die Rolle von Methoden in der Wissensgenerierung, eine kritische Auseinandersetzung mit dem "Wissen ist Macht"-Prinzip, eine vergleichende Analyse der philosophischen Positionen von Aquin, Bacon und Vico sowie die Bedeutung des Konstruktivismus und Realismus im technowissenschaftlichen Kontext. Die klassische Wissenschaft und deren Fundamente werden ebenso beleuchtet wie die Herausforderungen der Technowissenschaft.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 ist eine Einleitung, die die Forschungsfrage und die methodologische Grundlage der Arbeit darstellt. Kapitel 2 erörtert grundlegende Aspekte der klassischen und technowissenschaftlichen Wissensproduktion. Kapitel 3 analysiert die epistemologischen Positionen von Aquin, Bacon und Vico. Kapitel 4 bietet eine kritische Reflexion des "Wissen ist Macht"-Prinzips und der verschiedenen erkenntnistheoretischen Ansätze.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage untersucht den Zusammenhang zwischen „Herstellen“ und „Verstehen“ im Kontext des Prinzips „Wissen ist Macht“. Die Arbeit befasst sich mit der vieldeutigen Interpretation des Sprichworts „Es kommt oft anders als man denkt“ und knüpft an Feynmans Diktum „What I cannot create, I do not understand“ an.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine methodologische Herangehensweise, die eine kritische Analyse der verschiedenen philosophischen Positionen beinhaltet und deren epistemologische Annahmen im Kontext des „Wissen ist Macht“-Prinzips beleuchtet. Ein genauerer Überblick über die verwendete Methodik findet sich in der Einleitung.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Konkrete Schlussfolgerungen werden in der Arbeit nicht vorweggenommen, sondern im letzten Kapitel (Kapitel 4) auf der Basis der vorherigen Analysen präsentiert. Die Arbeit zielt auf eine kritische Reflexion und bietet keine einfachen Antworten, sondern fördert ein tieferes Verständnis der komplexen Zusammenhänge zwischen Wissen, Handlung und Macht.
- Citation du texte
- Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtschaftsing. Karin Ulrich (Auteur), 2014, Wissen ist Macht. Erkenntnistheoretische Spielarten eines Prinzips, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/286333