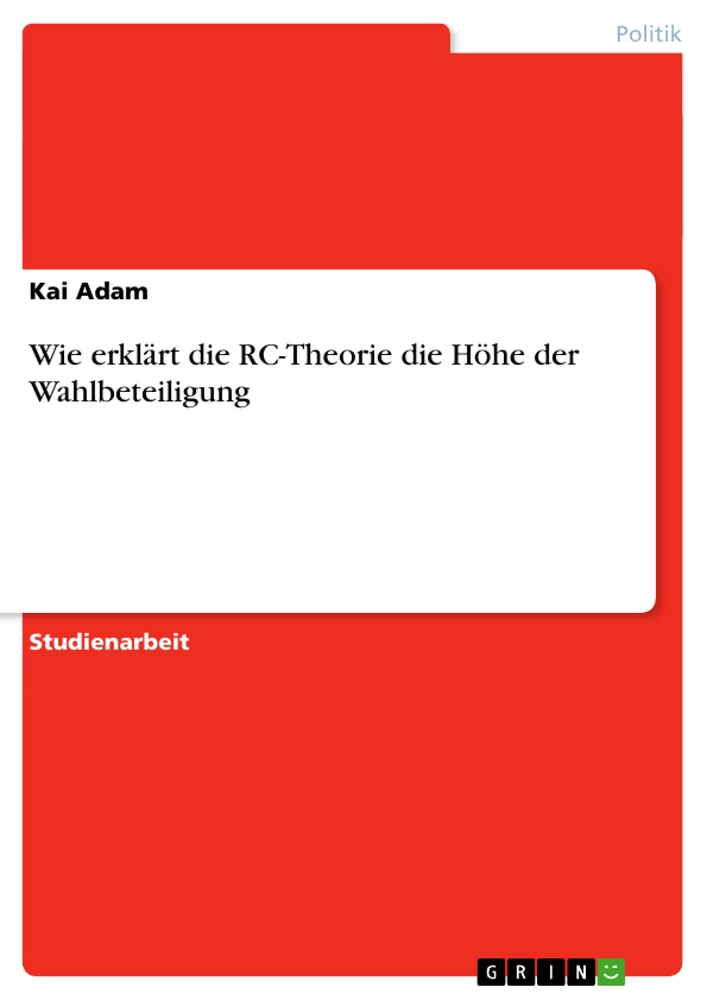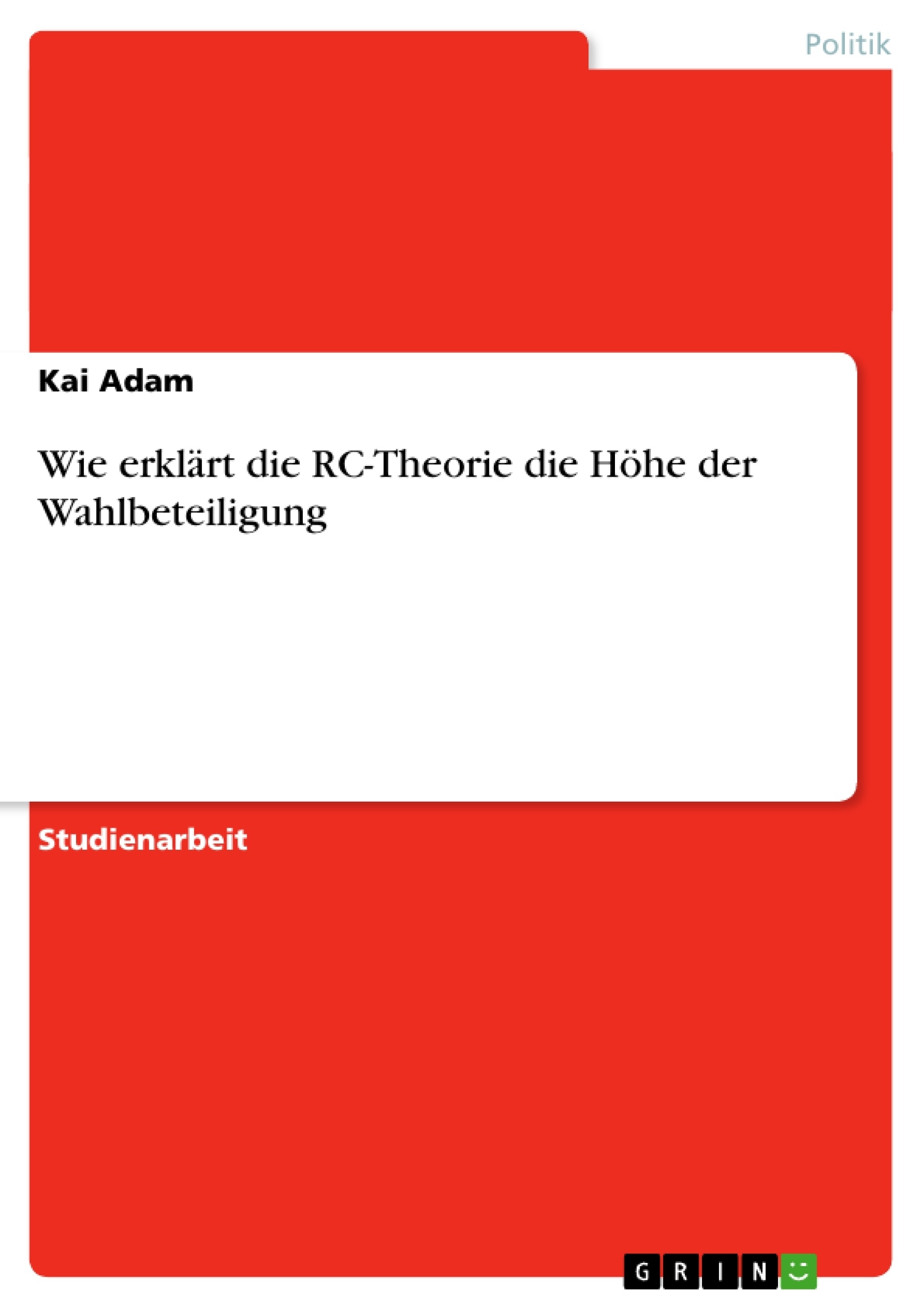Immer wieder wird behauptet, auf eine einzige Wahlstimme käme es nicht an. Bei der Bezirksverordnetenversammlung in Friedrichshain 1999 hatten die Republikaner nach dem vorläufigen Ergebnis 1360 Stimmen und damit die 3%- Sperrklausel überwunden und einen Sitz erhalten. Nach dem endgültigen Ergebnis blieb die Hürde zwar gleich hoch, aber die Republikaner hatten nur noch 1359 Stimmen, fielen damit wieder unter die 3%- Hürde und waren damit ihren Sitz wieder los. (vgl. http://www.statistik-berlin/wahlen/aghbvvwahl-1999/ergebniss/bvv-sitze/bvv-sitze1.asp). Dies ist ein Horrorszenario für jeden rationalen Nichtwähler, der deswegen nicht zur Wahlurne gegangen ist, weil er den Beitrag seiner eigenen Wahlstimme zur Wahlentscheidung aufgrund der großen Anzahl von Wählern sehr gering einschätzte. Warum gehen Wähler überhaupt zur Wahl, obwohl dies mit Kosten verbunden ist, und der Einfluss einer einzelnen Stimme auf den Ausgang der Wahl verschwindend gering ist, „Nichtwählen“ also unter Umständen die im Sinne der rationalen Theorie bessere Alternative sein kann. Die empirisch beobachtbare Tatsache, dass dennoch ein großer Teil der Bevölkerung an Wahlen teilnimmt, ist als das „Paradox des Wählens“ in die Literatur eingegangen. Herausgearbeitet wurde dieses Paradox von Anthony Downs, in seiner 1957 erschienen Pionierstudie „An economic theory of democracy“, in welcher das Verhalten von Wählern und Partein erklärt werden soll. In der vorliegenden Arbeit will ich nun näher darauf eingehen, wie die rationalistische Theorie des Wählerverhaltens von Downs die Höhe der Wahlbeteiligung erklärt, bzw. ob sie von ihr überhaupt erklärt werden kann.
Daher will ich zunächst einen theoretischen Rahmen schaffen und im 2. Kapitel das Grundgerüst des Downschen Modells des rationalen Wählens vorstellen, dessen Rationalitätsbegriff und Menschenbild, anschließend tiefergehend auf den rationalen Wähler eingehen. Kurz befassen werde ich mich damit, welche Rolle die Parteien in dem Modell innehaben, da sie bei der Erklärung des „Wahlparadox“ eine geringere Rolle spielen. Im 3. Kapitel werde ich mich dann dem „Wahlparadox“ widmen: Was versteht man darunter, wie entsteht es, warum wählt der rationale Wähler überhaupt ? Den Erklärungsversuch von Anthony Downs zum „Wahlparadox“ werde ich im 4. Kapitel darstellen und bewerten. Außerdem gehe ich auf andere Lösungsversuche von verschiedenen Autoren zum „Wahlparadox“ ein. Im 5. Kapitel wird dann ein Fazit gezogen
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Downs Modell des rationalen Wählens
- Der Rationalitätsbegriff und das Menschenbild bei Downs
- Das rationale Wählermodell
- Die Rolle der Parteien
- Das Wahlparadox
- Erklärungsversuche
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Paradox des Wählens und untersucht, ob und wie das rationalistische Modell von Anthony Downs die Höhe der Wahlbeteiligung erklären kann. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse des Downschen Modells des rationalen Wählens, seinen Annahmen über Rationalität und das Menschenbild sowie der Rolle der Parteien.
- Das "Wahlparadox": Die empirische Tatsache hoher Wahlbeteiligung trotz geringen individuellen Einflusses auf das Wahlergebnis.
- Das Downsche Modell des rationalen Wählens: Annahmen über Rationalität, Präferenzen und das Menschenbild.
- Die Rolle der Parteien im Modell: Bedeutung für die Erklärung des Wahlparadox.
- Erklärungsversuche für das Wahlparadox: Analyse des Downschen Ansatzes und anderer Theorien.
- Zusammenhang zwischen rationalem Verhalten und Wahlbeteiligung: Untersuchung der Widerspruchsfreiheit des Modells.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das "Wahlparadox" vor und führt die These ein, dass sich die Arbeit mit der Frage beschäftigt, ob und wie das rationalistische Modell von Anthony Downs die Höhe der Wahlbeteiligung erklären kann.
- Downs Modell des rationalen Wählers: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Grundgerüst des Downschen Modells, insbesondere mit dem Rationalitätsbegriff und dem Menschenbild, das Downs verwendet. Es werden die Annahmen des Modells zum Verhalten des rationalen Wählers beleuchtet, wobei die Rolle der Parteien in diesem Zusammenhang kurz erwähnt wird.
- Das Wahlparadox: Dieses Kapitel erläutert das "Wahlparadox", seine Entstehung und die Frage, warum der rationale Wähler überhaupt zur Wahl geht.
- Erklärungsversuche: Dieses Kapitel präsentiert und bewertet den Erklärungsversuch von Anthony Downs zum "Wahlparadox" und geht auf andere Lösungsversuche von verschiedenen Autoren ein.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die folgenden Schlüsselbegriffe: Wahlbeteiligung, rationales Handeln, Downsches Modell, Wahlparadox, ökonomische Theorie der Demokratie, Homo politicus, Nutzenmaximierung, Parteien, Wahlentscheidung, Wahlsystem.
Häufig gestellte Fragen zum Paradox des Wählens
Was versteht man unter dem „Paradox des Wählens“?
Das Paradox beschreibt die Tatsache, dass viele Menschen wählen gehen, obwohl der Einfluss einer einzelnen Stimme auf das Gesamtergebnis rational gesehen verschwindend gering ist.
Wie erklärt Anthony Downs das Wählerverhalten?
Downs nutzt ein ökonomisches Modell, in dem Wähler als rationale Nutzenmaximierer handeln. Die Arbeit prüft, ob dieses Modell die Wahlbeteiligung schlüssig erklären kann.
Warum gehen Menschen laut RC-Theorie trotzdem wählen?
Erklärungsversuche beinhalten das Vermeiden des Zusammenbruchs der Demokratie oder den Erhalt eines langfristigen Nutzens aus dem Wahlsystem an sich.
Welches Menschenbild liegt dem Modell von Downs zugrunde?
Es basiert auf dem Konzept des „Homo politicus“, der seine Entscheidungen auf Basis von Kosten-Nutzen-Abwägungen und persönlichen Präferenzen trifft.
Welche Rolle spielen Parteien im rationalen Wählermodell?
Parteien fungieren als Anbieter von Programmen, zwischen denen der rationale Wähler wählt, um seinen persönlichen Vorteil (Nutzen) zu maximieren.
- Citar trabajo
- Kai Adam (Autor), 2004, Wie erklärt die RC-Theorie die Höhe der Wahlbeteiligung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28649