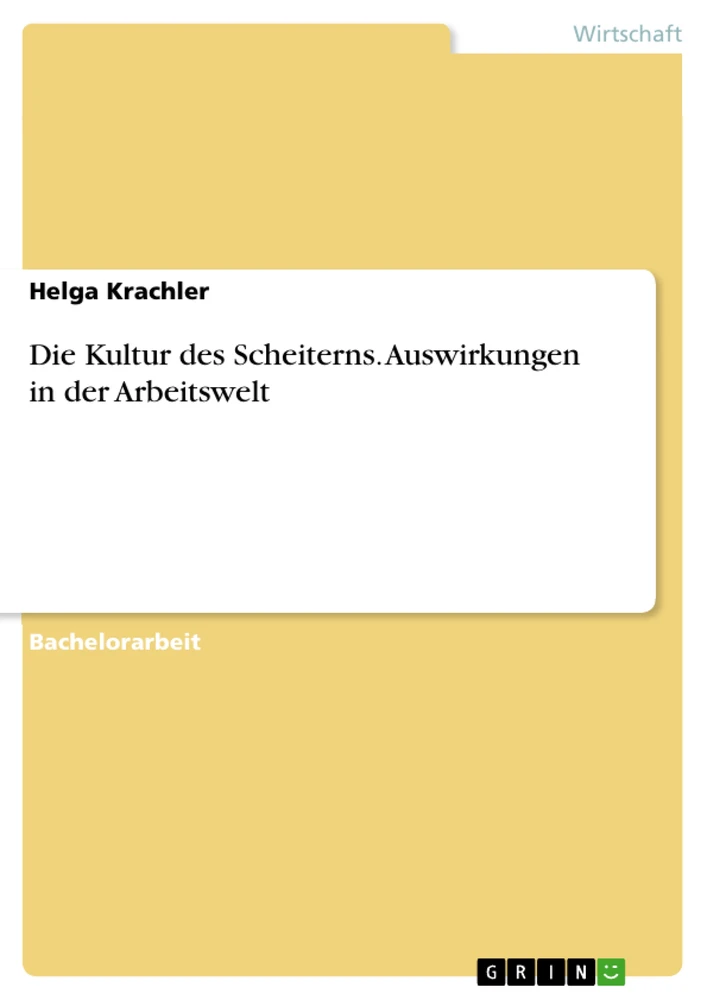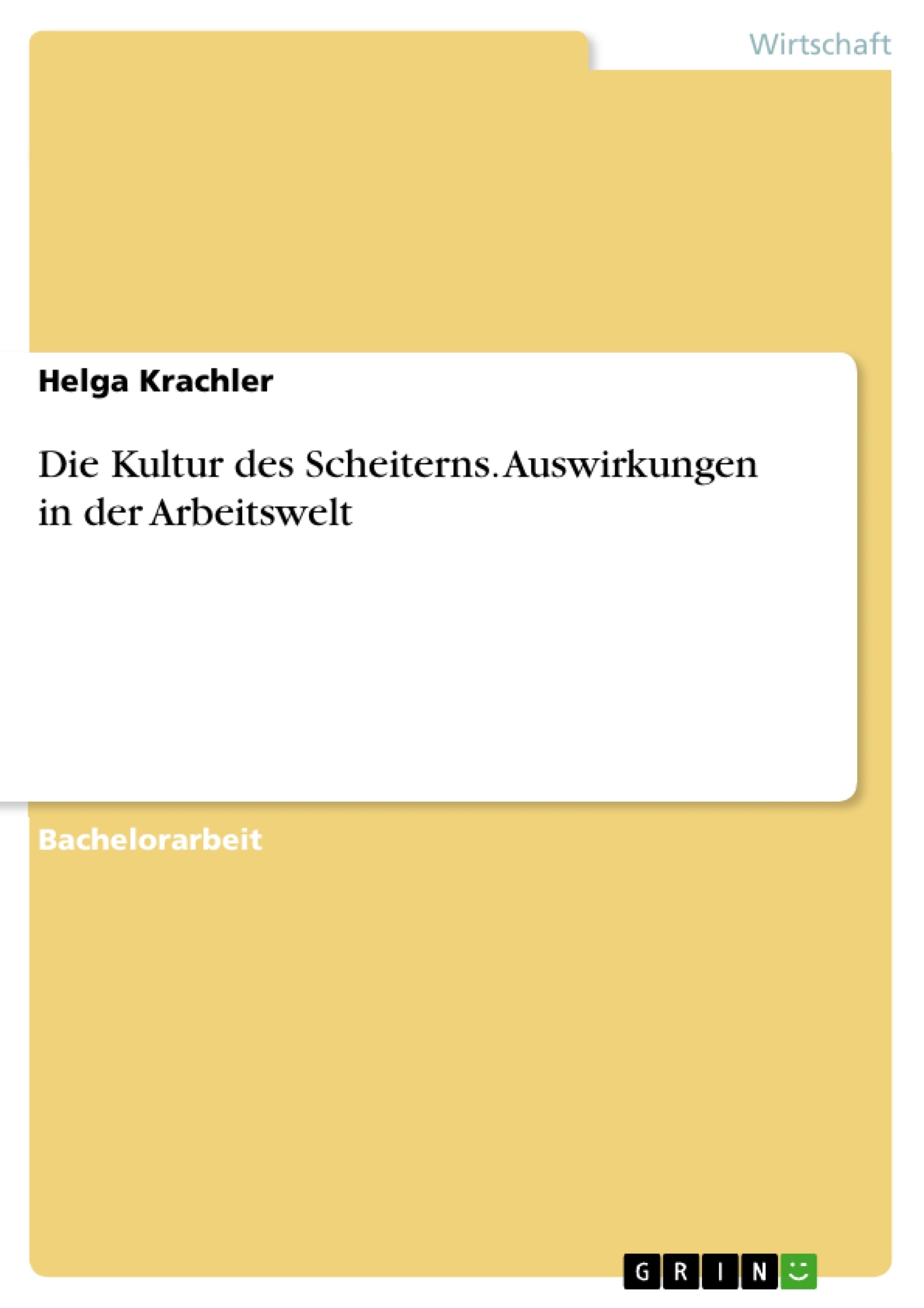Im Rahmen der Beschäftigung mit unternehmerischen Krisen und Insolvenzen ließ sich feststellen, dass das Scheitern an sich selten bis nie thematisiert wird. In jeder Krise und jeder Insolvenz finden sich Gründe im Außen, in den Umständen oder der unmittelbaren Umwelt für einen Rückschlag oder gar den unternehmerischen Untergang. Bedeutet dies, dass es in Österreich eine kaum bis nicht existierende Kultur des Scheiterns gibt? Dennoch wird in letzter Zeit immer häufiger in den Medien, vor allem in Karrieremagazinen und auf Wirtschaftsseiten das Thema aufgegriffen. In einer Zeit hoher Arbeitslosigkeit bei gleichzeitig zunehmenden Bemühungen zur Mitarbeiterbindung findet sich immer wieder die Forderung nach einer Kultur des Scheiterns. Logischerweise muss sich daher eine wenig ausgeprägte Kultur bzw. hauptsächlich negative Begriffsbesetzung des Scheiterns auf die und in der Arbeitswelt auswirken. Was genau versteht man unter Scheitern? Handelt es sich dabei bloß um Fehler, Misserfolge, Erfolglosigkeit oder Fehlschläge? Wie wird Scheitern vom Einzelnen, von Unternehmen und Organisationen verarbeitet? Gibt es Strategien zur Bewältigung? Und ist Scheitern möglicherweise ein Ausgangspunkt für Neues, für Weiterentwicklung und persönliches wie organisationales Lernen?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Forschungsinteresse und Vorgehensweise
- 2.1 Problemstellung
- 2.2 Forschungsfragen
- 2.3 Geplantes methodisches Vorgehen
- 3. Zielsetzung
- 4. Begriffe
- 4.1 Kultur
- 4.2 Misserfolg, Versagen und Scheitern
- 4.2.1 Misserfolg
- 4.2.2 Versagen
- 4.2.3 Scheitern
- 4.3 Arbeitswelt
- 5. Entwicklung - Geschichte und Fachbereiche des Scheiterns
- 6. Auswirkungen in der Arbeitswelt
- 6.1 Organisation
- 6.2 Rollen und Hierarchien
- 6.3 Mitarbeiter
- 6.4 Teams
- 6.5 Management
- 7. Ansätze zur Bewältigung
- 7.1 Resignation
- 7.2 Bewältigung
- 7.2.1 Coaching
- 7.2.2 Supervision
- 7.2.3 Psychotherapie
- 7.2.4 Mentoring
- 7.2.5 Peer Groups
- 7.3 Resilienz
- 7.4 Antifragilität
- 7.5 Ein Blick über die Grenze
- 8. Zwischenresümee
- 9. Forschungsprojekt
- 9.1 Datenerhebung
- 9.2 Interviewpartner
- 9.3 Entwicklung des Interviewleitfadens
- 9.4 Datenauswertung
- 10. Forschungsergebnisse
- 10.1 Definition des Scheiterns
- 10.2 Misserfolg, Fehler und Versagen
- 10.3 Persönliches Scheitern
- 10.4 Unterstützung im Scheitern
- 10.5 Scheitern der Anderen
- 10.5.1 Mitarbeiter
- 10.5.2 Vorgesetzte
- 10.6 Konsequenzen
- 10.7 Bewältigungsstrategien
- 10.8 Gedanken zum Scheitern
- 10.8.1 Kultur des Scheiterns
- 10.8.2 Wahrnehmung des Scheiterns
- 10.8.3 Tabu
- 10.8.4 Lernen aus dem Scheitern
- 11. Schlussfolgerungen und Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die "Kultur des Scheiterns" in der Arbeitswelt. Ziel ist es, die Auswirkungen von Scheitern auf Individuen, Teams und Organisationen zu analysieren und Bewältigungsstrategien zu beleuchten. Die Arbeit basiert auf empirischen Daten und untersucht, wie Scheitern wahrgenommen, verarbeitet und im Kontext von Organisationskultur und individuellem Lernen verstanden wird.
- Definition und Wahrnehmung von Scheitern in der Arbeitswelt
- Auswirkungen von Scheitern auf Individuen, Teams und Organisationen
- Bewältigungsstrategien und -ansätze im Umgang mit Scheitern
- Der Einfluss der Organisationskultur auf die Verarbeitung von Scheitern
- Lernen aus Fehlern und Scheitern als Grundlage für zukünftige Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der "Kultur des Scheiterns" ein und beschreibt das persönliche Forschungsinteresse der Autorin, welches durch eigene Erfahrungen im Arbeitskontext und Beobachtungen zu unternehmerischen Krisen und Insolvenzen entstanden ist. Es wird die Frage aufgeworfen, ob in Österreich eine ausgeprägte Kultur des Scheiterns existiert und wie sich die (möglicherweise negative) Begriffsbesetzung auf die Arbeitswelt auswirkt. Die Einleitung formuliert zentrale Fragen, die im Laufe der Arbeit beantwortet werden sollen, wie z.B. die Definition von Scheitern, dessen Verarbeitung und die Existenz von Bewältigungsstrategien.
2. Forschungsinteresse und Vorgehensweise: Dieses Kapitel beschreibt die Problemstellung der Arbeit, welche darin besteht, dass das Thema "Scheitern" in der Arbeitswelt bislang wenig erforscht wurde. Es werden die Forschungsfragen formuliert und die geplante Methodik der Untersuchung erläutert. Hier wird der methodische Ansatz der Arbeit begründet und die Herangehensweise an die Forschungsfragen dargelegt.
4. Begriffe: Dieses Kapitel liefert präzise Definitionen von zentralen Begriffen wie "Kultur", "Misserfolg", "Versagen" und "Scheitern", um eine klare Grundlage für die weitere Analyse zu schaffen. Es differenziert zwischen diesen Begriffen und schafft ein gemeinsames Verständnis der verwendeten Terminologie. Die Definitionen bilden die Grundlage für die spätere empirische Untersuchung und Interpretation der Ergebnisse.
5. Entwicklung - Geschichte und Fachbereiche des Scheiterns: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Verständnisses von Scheitern und dessen Behandlung in verschiedenen Fachbereichen. Es wird ein umfassender Überblick über die Entwicklung des Denkens und Handelns in Bezug auf Scheitern gegeben, und zwar über verschiedene Zeiträume und Disziplinen hinweg. Es werden verschiedene Perspektiven auf Scheitern präsentiert, um ein ganzheitliches Bild zu liefern.
6. Auswirkungen in der Arbeitswelt: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen des Scheiterns auf verschiedene Ebenen der Arbeitswelt: Organisation, Rollen und Hierarchien, Mitarbeiter, Teams und Management. Es untersucht, wie Scheitern in den jeweiligen Kontexten wahrgenommen, gehandhabt und bewertet wird. Der Fokus liegt auf den konkreten Auswirkungen auf die verschiedenen Akteure im Arbeitskontext.
7. Ansätze zur Bewältigung: Das Kapitel beschreibt verschiedene Ansätze zur Bewältigung von Scheitern, einschließlich Resignation, Coaching, Supervision, Psychotherapie, Mentoring und Peer Groups. Es werden die Vor- und Nachteile der einzelnen Ansätze diskutiert und deren Eignung für verschiedene Situationen und Personen beleuchtet. Die verschiedenen Strategien werden hinsichtlich ihrer Effektivität und Anwendbarkeit im Kontext des Scheiterns in der Arbeitswelt bewertet.
9. Forschungsprojekt: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der durchgeführten empirischen Untersuchung. Es detailliert die Datenerhebung, die Auswahl der Interviewpartner, die Entwicklung des Interviewleitfadens und die Methode der Datenauswertung. Der Abschnitt liefert eine detaillierte Beschreibung der Vorgehensweise, um die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.
Schlüsselwörter
Kultur des Scheiterns, Arbeitswelt, Misserfolg, Versagen, Resilienz, Bewältigungsstrategien, Organisationskultur, Lernen aus Fehlern, empirische Forschung, Interviewstudie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: "Kultur des Scheiterns" in der Arbeitswelt
Was ist der Gegenstand der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die "Kultur des Scheiterns" in der Arbeitswelt. Sie analysiert die Auswirkungen von Scheitern auf Individuen, Teams und Organisationen und beleuchtet verschiedene Bewältigungsstrategien. Die Arbeit basiert auf empirischen Daten und untersucht die Wahrnehmung, Verarbeitung und das Verständnis von Scheitern im Kontext von Organisationskultur und individuellem Lernen.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel ist die Analyse der Auswirkungen von Scheitern auf verschiedene Ebenen der Arbeitswelt (Individuen, Teams, Organisationen). Zusätzlich werden Bewältigungsstrategien im Umgang mit Scheitern untersucht und der Einfluss der Organisationskultur auf die Verarbeitung von Scheitern beleuchtet. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Lernen aus Fehlern und Scheitern als Grundlage für zukünftige Entwicklung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und Wahrnehmung von Scheitern, Auswirkungen auf Individuen, Teams und Organisationen, Bewältigungsstrategien und -ansätze, Einfluss der Organisationskultur und Lernen aus Fehlern und Scheitern.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Arbeit verwendet eine empirische Forschungsmethode. Es wurden Interviews durchgeführt, ein Interviewleitfaden entwickelt und die Daten anschließend ausgewertet. Die genaue Methodik wird im Kapitel "Forschungsprojekt" detailliert beschrieben.
Wie sind die Kapitel der Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, Forschungsinteresse und Vorgehensweise, Zielsetzung, Begriffsbestimmungen (Kultur, Misserfolg, Versagen, Scheitern, Arbeitswelt), historische Entwicklung des Scheiterns, Auswirkungen in der Arbeitswelt (Organisation, Rollen, Mitarbeiter, Teams, Management), Bewältigungsansätze (Resignation, Coaching, Supervision, Psychotherapie, Mentoring, Peer Groups, Resilienz, Antifragilität), Zwischenresümee, Forschungsprojekt (Datenerhebung, Interviewpartner, Interviewleitfaden, Datenauswertung), Forschungsergebnisse (Definition des Scheiterns, Misserfolg, Fehler und Versagen, persönliches Scheitern, Unterstützung, Scheitern anderer, Konsequenzen, Bewältigungsstrategien, Gedanken zum Scheitern – Kultur, Wahrnehmung, Tabu, Lernen), Schlussfolgerungen und Reflexion.
Welche zentralen Begriffe werden definiert?
Zentrale Begriffe wie "Kultur", "Misserfolg", "Versagen" und "Scheitern" werden präzise definiert, um ein gemeinsames Verständnis der verwendeten Terminologie zu schaffen. Die Definitionen bilden die Grundlage für die empirische Untersuchung und Interpretation der Ergebnisse.
Welche Bewältigungsstrategien werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Bewältigungsstrategien, darunter Resignation, Coaching, Supervision, Psychotherapie, Mentoring und Peer Groups. Die Vor- und Nachteile der einzelnen Ansätze werden diskutiert und deren Eignung für verschiedene Situationen und Personen beleuchtet.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung werden im Kapitel "Forschungsergebnisse" präsentiert. Sie umfassen unter anderem eine Definition von Scheitern, die Analyse von Misserfolg, Fehler und Versagen, die Betrachtung von persönlichem Scheitern und Unterstützung im Scheitern, sowie die Untersuchung von Bewältigungsstrategien und Gedanken zum Scheitern (Kultur, Wahrnehmung, Tabu, Lernen).
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen und Reflexionen der Autorin werden im letzten Kapitel der Arbeit dargelegt. Diese fassen die wichtigsten Ergebnisse zusammen und diskutieren mögliche Limitationen der Studie sowie Implikationen für die Praxis.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kultur des Scheiterns, Arbeitswelt, Misserfolg, Versagen, Resilienz, Bewältigungsstrategien, Organisationskultur, Lernen aus Fehlern, empirische Forschung, Interviewstudie.
- Quote paper
- Helga Krachler (Author), 2014, Die Kultur des Scheiterns. Auswirkungen in der Arbeitswelt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/286871