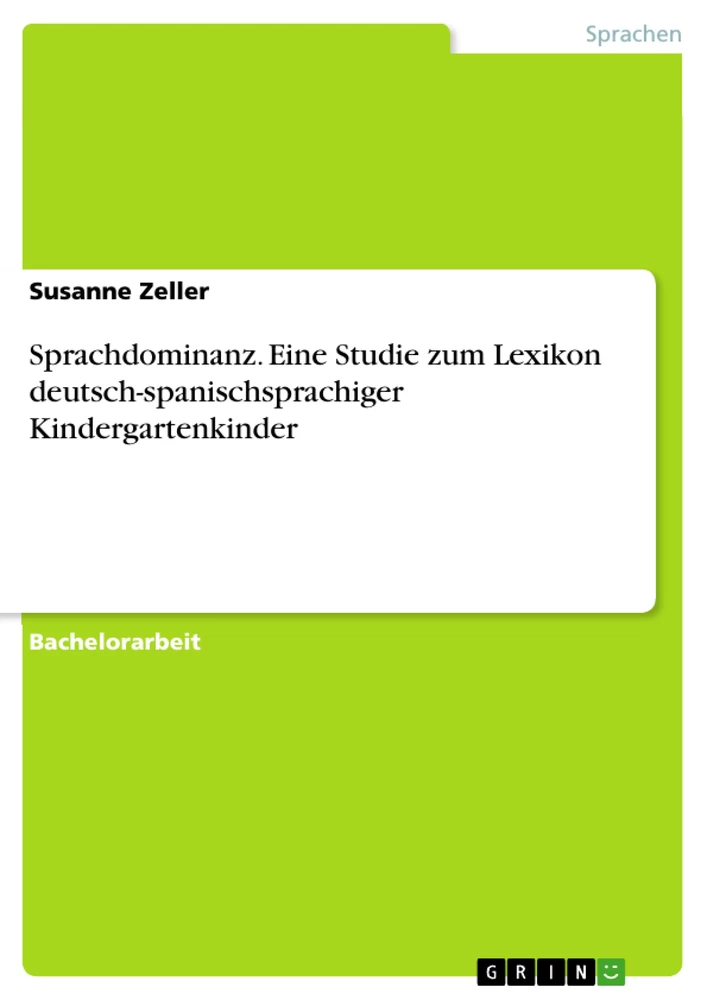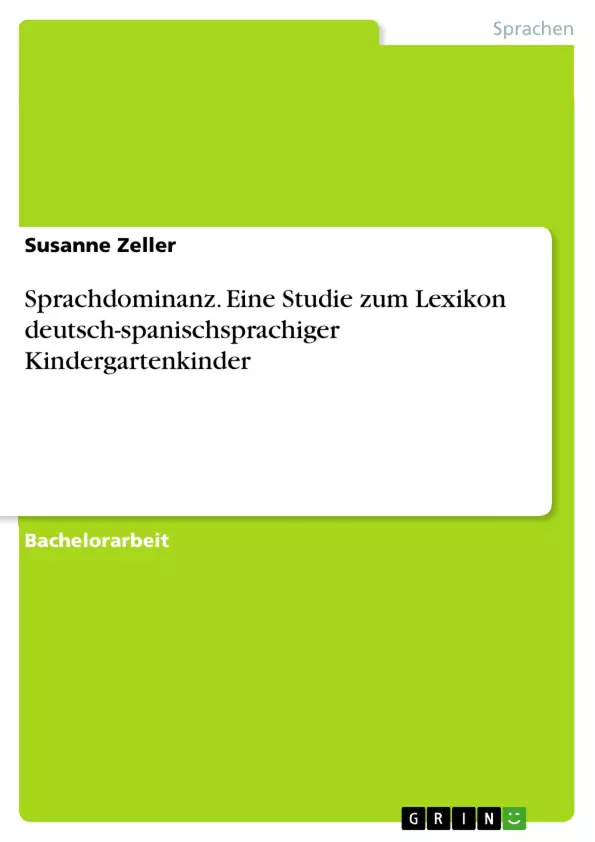Diese Arbeit ist in zwei Teile untergliedert. Einen ersten theoretischen Teil, welcher durch
die Auswertung einschlägiger Literatur unter anderem der Autoren Müller u.a. (2011),
Meisel (1994) und González-Vilbazo u.a. (2013) einen Überblick über den Stand der
Forschung zum bilingualen Spracherwerb mit seinen externen und internen Phänomenen
geben soll. Der Fokus des ersten Teils liegt jedoch auf dem Phänomen der Sprachdominanz selbst.
Im zweiten praktischen Teil werden die Ergebnisse der eigens erhobenen Eltern-
Fragebögen zum sprachlichen Umfeld und die Sprachaufnahmen zwölf
ausgewählter bilingualer Kinder im Kindergartenalter im Hinblick auf ihre
Sprachdominanz analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bilingualer Spracherwerb
- Externe Phänomene
- Erwerbsformen
- Erwerbsstand
- Interne Phänomene
- Transfer und Interferenz
- Code-switching
- Theorien
- Externe Phänomene
- Sprachdominanz
- Charakterisierung
- Starke Sprache
- Schwache Sprache
- Einflussfaktoren
- Familie
- Kindergarten
- Spezifische Kultur
- Interne Phänomene
- Kriterien zur Messung von Sprachdominanz
- Quantitative Kriterien
- Qualitative Kriterien
- Charakterisierung
- Methode
- Hypothesen und Zielsetzungen
- Design der Studie
- Auswahl der Stimuli
- Fragebogen an die Eltern
- Vorstudie
- Durchführung der Studie
- Ergebnisse
- Quantitative Analyse
- Qualitative Analyse
- Deutsch-dominante Kinder
- Spanische-dominante Kinder
- Balanciert-bilinguale Kinder
- Diskussion
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Sprachdominanz bei bilingualen Kindern, die Deutsch und Spanisch sprechen. Ziel ist es, neue Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie sich Sprachdominanz erklären lässt, insbesondere im Hinblick auf den Einfluss kultureller Erfahrungen auf das Lexikon dieser Kinder. Die Arbeit untersucht, ob diese Erfahrungen zur Konstituierung einer Sprachdominanz beitragen können.
- Bilingualer Spracherwerb und seine externen und internen Phänomene
- Theorien zum Sprachsystem und Spracherwerb bilingualer Kinder
- Das Phänomen der Sprachdominanz und seine Charakterisierung
- Einflussfaktoren auf die Sprachentwicklung bilingualer Kinder, insbesondere Familie, Kindergarten und spezifische Kulturen
- Kriterien zur Messung von Sprachdominanz
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 behandelt den bilingualen Spracherwerb und beleuchtet verschiedene Erwerbsformen und -stände sowie interne Phänomene wie Transfer, Interferenz und Code-switching. Es werden auch Theorien zum Sprachsystem und Spracherwerb bilingualer Kinder diskutiert.
Kapitel 3 widmet sich dem Phänomen der Sprachdominanz. Es werden die Charakterisierung von starker und schwacher Sprache sowie Einflussfaktoren wie Familie, Kindergarten und spezifische Kulturen vorgestellt. Weiterhin werden interne Phänomene im Zusammenhang mit Sprachdominanz und Kriterien zur Messung dieser betrachtet.
Kapitel 4 beschreibt die Methode der Studie, einschließlich Hypothesen, Design, Auswahl der Stimuli, Elternfragebogen, Vorstudie und Durchführung.
Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse der Studie, sowohl quantitative als auch qualitative Analysen. Es werden die Ergebnisse für deutsch-dominante, spanisch-dominante und balanciert-bilinguale Kinder getrennt betrachtet.
Schlüsselwörter
Bilingualer Spracherwerb, Sprachdominanz, Deutsch, Spanisch, Kultur, Familie, Kindergarten, Lexikon, quantitative und qualitative Analyse, interkulturelle Kommunikation.
- Citation du texte
- Susanne Zeller (Auteur), 2014, Sprachdominanz. Eine Studie zum Lexikon deutsch-spanischsprachiger Kindergartenkinder, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/286896