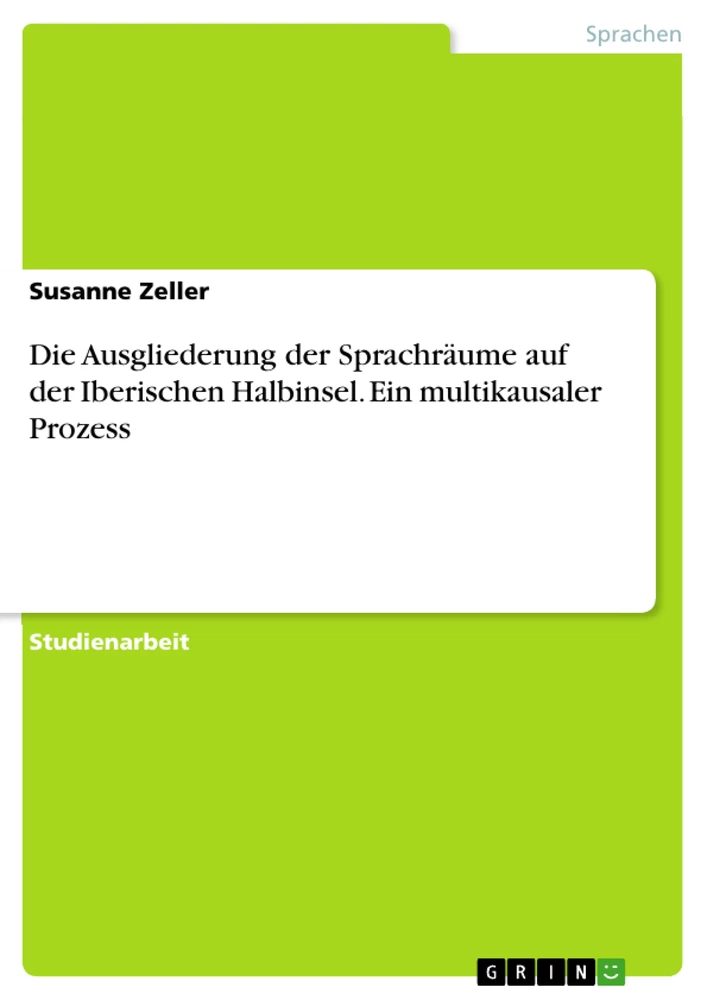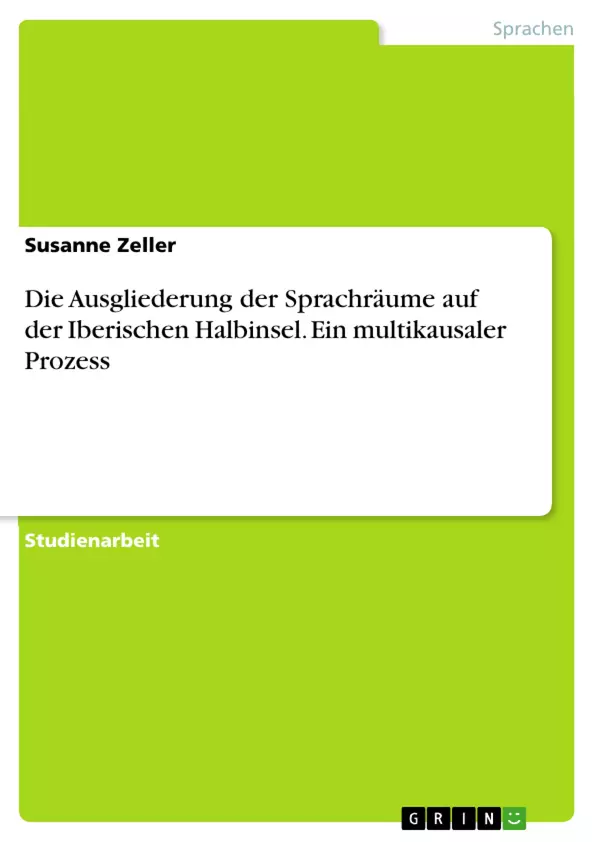Der Linguistik war es schon seit langer Zeit bekannt, dass eine Sprache kein genaues Geburtsdatum hat und sich unaufhörlich weiterentwickelt. Es wird vom sogenannten „Evolutionsprinzip“ gesprochen; der Tatsache, dass alles Menschliche veränderlich ist und deshalb auch die Sprache – als Teil des Menschen - sich konstant verändert. Wie genau dieser Prozess von statten geht und vor allem ab wann man sagen kann, dass eine Sprache „geboren“ wurde, ist ein äußerst komplexer Prozess. Der Vorgang der Ausgliederung von Sprachräumen mit Fokus auf die Iberische Halbinsel soll in vorliegender Arbeit erörtert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist Ausgliederung?
- Vertikale Kommunikation und Diglossie
- Multikausalität
- Hauptteil
- Thesen zur Ausgliederung der romanischen Sprachen
- Substrat-, Superstrat-, Adstrattheorie
- Substrateinflüsse
- Superstrateinflüsse
- Adstrateinflüsse
- Die Rolle der Kontaktverhältnisse und Verkehrsbedingungen
- Kontaktverhältnisse
- Verkehrsbedingungen
- Chronologie und Intensität der Romanisierung
- Gröbertheorie
- Kritik
- Substrat-, Superstrat-, Adstrattheorie
- Soziale und regionale Herkunft der Romanisierungsträger
- Westen vs. Osten
- Sprachbeispiel
- Situation auf der Iberischen Halbinsel
- Kritik
- Kräfteverhältniss zwischen Sprachneuerung und Sprachtradition
- Sprachtradition vs. Sprachneuerung
- Sprachbeispiel
- Soziale Herkunft der Romanisierungsträger als Grundlage für spätere Sprachpolitik/Sprachtradition?
- Versuch eines Vergleiches
- Restauration (Karolingische Reform)
- Konzil von Tours
- Thesen zur Ausgliederung der romanischen Sprachen
- Schluss
- Ende der Vertikalen Kommunikation
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Ausgliederung der Sprachräume auf der Iberischen Halbinsel, insbesondere mit der Entstehung der romanischen Sprachen aus dem Lateinischen. Ziel ist es, diesen komplexen Prozess aus multikausaler Perspektive zu beleuchten und die verschiedenen Theorien und Argumente der Sprachwissenschaft zu analysieren.
- Die Rolle von Substrat-, Superstrat- und Adstrattheorien bei der Ausgliederung der romanischen Sprachen
- Der Einfluss von Kontaktverhältnissen und Verkehrsbedingungen auf die Sprachentwicklung
- Die Bedeutung der sozialen und regionalen Herkunft der Romanisierungsträger
- Das Spannungsverhältnis zwischen Sprachtradition und Sprachneuerung
- Die Auswirkung der Romanisierung auf spätere Sprachpolitik und Sprachtradition
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Ausgliederung von Sprachräumen ein und erläutert die Begriffe „Vertikale Kommunikation“ und „Diglossie“. Sie betont die Multikausalität des Prozesses und die Notwendigkeit, verschiedene Theorien zu berücksichtigen.
Der Hauptteil befasst sich mit verschiedenen Thesen zur Ausgliederung der romanischen Sprachen, darunter die Substrat-, Superstrat- und Adstrattheorie, die Rolle von Kontaktverhältnissen und Verkehrsbedingungen sowie die Bedeutung der sozialen und regionalen Herkunft der Romanisierungsträger. Es wird auch auf das Kräfteverhältnis zwischen Sprachtradition und Sprachneuerung eingegangen und die Frage nach der Auswirkung der Romanisierung auf spätere Sprachpolitik und Sprachtradition behandelt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter des Textes sind: Ausgliederung, Sprachräume, Iberische Halbinsel, romanische Sprachen, Latein, Vertikale Kommunikation, Diglossie, Multikausalität, Substrattheorie, Superstrattheorie, Adstrattheorie, Kontaktverhältnisse, Verkehrsbedingungen, soziale Herkunft, Sprachneuerung, Sprachtradition, Sprachpolitik.
- Quote paper
- Susanne Zeller (Author), 2012, Die Ausgliederung der Sprachräume auf der Iberischen Halbinsel. Ein multikausaler Prozess, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/286900