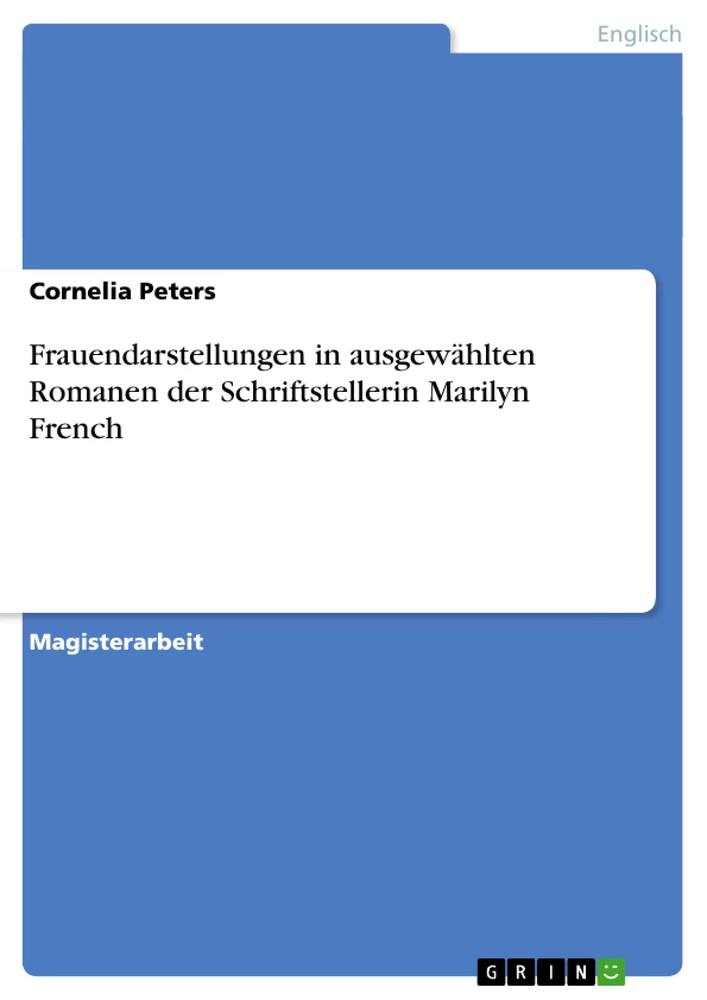Gegenstand und Problemstellung der Arbeit
Ein „monströses Frauenbuch“1 über „die Komplexe der Amerikanerin,“2 „ein üppiger Saftschinken nach amerikanischem Rezept,“3 „ein Buch, das Leben verändert,“4 „das die Männer von den Frauen trennt“5 und das „...in die komfortablen Konzentrationslager der amerikanischen Vorstädte wie eine Bombe einschlug“6 - selten wurde ein Roman mit so viel Häme und Lob überhäuft wie Marilyn French′s Roman The Women′s Room. Das belletristische Erstlingswerk der Autorin eroberte 1977 in kürzester Zeit die Bestsellerlisten in den USA. Als erste Veröffentlichung des damals neu gegründeten Verlages Summit Books, einer Abteilung des renommierten Verlagshauses Simon & Schuster Inc., erreichte allein die gebundene Ausgabe des Buches in wenigen Monaten enorme Verkaufszahlen, so daß die Rechte für die Taschenbuchausgabe daraufhin für die Summe von $ 750.000 verkauft wurden.7 In über 20 Sprachen übersetzt, wurde der Roman auch international zu einem Erfolg und 1997 von Virago Press, London, neu aufgelegt. Dieser beeindruckende kommerzielle Erfolg rief natürlich nationale und internationale Literaturkritiker auf den Plan. In den USA beschäftigten sich Rezensent/Innen der bedeutendsten Zeitungen und Zeitschriften mit dem Roman, wie zum Beispiel Harper′s, Newsweek, People, The New York Times und The Washington Post. Im deutschsprachigen Raum griffen ihn die Neue Züricher Zeitung, die Frankfurter Allgemeine Zeitung und Die Zeit als erste in ausführlichen Rezensionen auf.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Gegenstand und Problemstellung der Arbeit
- 2. Die Suche nach der Frau in Philosophie und Wissenschaft
- 2.1. Anatomy is Destiny? Positionen der Frau in Gesellschaft, Familie und Kultur bis ins 19. Jahrhundert
- 2.2. „Mind Management“ als gesellschaftliches Kontrollmittel
- 2.3. „The Feminine Mystique“ - Rückschritt statt Fortschritt im 20. Jahrhundert?
- 3. Der Mythos Frau – eine Frage der Identität?
- 3.1. „A person's consistent sense of self" - Psychoanalyse und Identität
- 3.2. Sozialpsychologische Ansätze zur Identitätstheorie
- 3.2.1. Die Verknüpfung persönlicher Identität mit kritischen Lebenssituationen
- 3.2.2. Selbstkonzept und Selbstwertgefühl als Aspekte der Identität
- 3.2.3. Soziale Rolle und Identität
- 3.3. Sex und Gender als kulturdefinierte Rahmen der Geschlechterforschung
- 3.3.1. Geschlecht als Definitionsraum für Identität
- 3.3.2. Gender Identity und Genderismus als ideologisiertes System der Relevanz von Geschlecht
- 3.3.3. Judith Butlers Dekonstruktivismus
- 4. Lebensentwürfe weiblicher Figuren in Marilyn Frenchs Romanen
- 4.1. „Mira was an independent baby.“ Geschlechtsrollenspezifische Erziehung und Bildung
- 4.1.1. „But Mira had a private life.“ Flucht in die Innenwelt
- 4.1.2. „...the first appearence of my bad character.“ Selbstbewertung im Konflikt zwischen Rollenerwartung und Rollendistanz
- 4.1.3. „She was being undermined.“ Pubertät als sozialer Scheideweg
- 4.1.4. „He's getting a virgin, that I know.“ Defloration als Inbesitznahme
- 4.2. „And they lived happily ever after.“ Die Institution der Ehe als Manifestierung sozialer Geschlechtsrollen
- 4.2.1. „Armed by the title of Mrs...“ Gender-Rollen in der Ehe
- 4.2.2. Sexualität in der Ehe als Ausdruck sozialer Machtverhältnisse
- 4.2.3. „Children are the center of a woman's life.“ Die Mutterrolle als Wertmaßstab und Herausforderung
- 4.3. Gewalt gegen Frauen
- 4.3.1. Finanzielle Unterdrückung und Entmündigung als subtile Formen der Gewalt
- 4.3.2. „I'm a woman hater“ Ambivalente Signale aus Angst vor Kontrollverlust
- 4.3.3. Verweigerung als Gewaltform und Psychoterror
- 4.3.4. „The mad woman“ Totale physische und psychische Gewalt an Frauen
- 4.3.5. Scheidung als Ausweg? Institutionelle Gewalt an Frauen
- 4.4. Die allegorische Figur „Norm“ – Täter und Produkt zugleich?
- 4.5. Die weibliche Subkultur - Frauen in Solidaritätsgruppen
- 4.5.1. „She laughed with them at the absurdities of the big world.“ - Systemerhaltende Mechanismen in Solidaritätsgruppen
- 4.5.2. Frauengruppen als Artikulationsforum
- 4.5.3. Alternative Lebensentwürfe für Frauen
- 4.1. „Mira was an independent baby.“ Geschlechtsrollenspezifische Erziehung und Bildung
- 5. Literarische Darstellungsmittel der Identitätsproblematik
- 5.1. „Writing beyond the ending“ als Schritt aus narrativen und sozialen Restriktionen weiblicher Identität
- 5.2. „I guess I should get back to the story,“ - Identitätsentwürfe im Verhältnis von Erzählinstanz und Figurenebene
- 5.3. „[...]because, you see, it's all true, it happened.“ Authentizitätsanspruch als appellatives Element der Erzählinstanz
- 5.4. „But only the tide rolls in.“ Zeitdarstellung im Roman als Inszenierung von Identitätsentwicklung
- 5.5. „The Women's Room“ - Raumdarstellung als Gestaltungsmittel der Identitätserweiterung
- 6. „Behind the Bestsellers“ – eine journalistische Rezeptionsanalyse von The Women's Room
- 6.1. Literaturkritik als Forum feministischer Publikation
- 6.2. „Sexual Bias in Reviewing“ - Journalistische Literaturkritik auf dem Prüfstand
- 6.3. „Separating the Men from the Women“ - Tradition und Klischee in Rezensionen zu The Women's Room
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Darstellung von Frauen in ausgewählten Romanen der Autorin Marilyn French. Ziel ist es, die Herausforderungen und Möglichkeiten weiblicher Identitätsfindung im Kontext gesellschaftlicher Geschlechterrollen und -erwartungen zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die literarischen Mittel, mit denen French diese Thematik darstellt und setzt diese in den Kontext philosophischer und sozialwissenschaftlicher Diskurse.
- Weibliche Identität und ihre Konstruktion
- Gesellschaftliche Geschlechterrollen und ihre Auswirkungen auf Frauen
- Gewalt gegen Frauen in verschiedenen Formen
- Feministische Perspektiven in Literatur und Literaturkritik
- Literarische Darstellungsmittel und ihre Funktion im Kontext der weiblichen Identität
Zusammenfassung der Kapitel
1. Gegenstand und Problemstellung der Arbeit: Die Arbeit skizziert die Fragestellung und den methodischen Ansatz. Es wird die Relevanz der Untersuchung weiblicher Identitätsfindung in Marilyn Frenchs Romanen im Kontext gesellschaftlicher Machtstrukturen begründet und der Forschungsrahmen abgesteckt. Der Fokus liegt auf der Analyse der literarischen Gestaltungsmittel und deren Funktion in der Darstellung weiblicher Lebensentwürfe.
2. Die Suche nach der Frau in Philosophie und Wissenschaft: Dieses Kapitel untersucht den historischen Diskurs über die Frau in Philosophie und Wissenschaft, beginnend mit traditionellen Rollenbildern bis hin zu feministischen Perspektiven des 20. Jahrhunderts. Es werden verschiedene Theorien und Konzepte zur Konstruktion weiblicher Identität vorgestellt, wie etwa die „Anatomy is Destiny“-These und die Rolle des „Mind Managements“ in der Unterdrückung von Frauen. Der Einfluss von Theorien wie der „Feminine Mystique“ wird kritisch beleuchtet.
3. Der Mythos Frau – eine Frage der Identität?: Dieses Kapitel beleuchtet den komplexen Zusammenhang zwischen Identität, Geschlecht und gesellschaftlichen Erwartungen. Es werden psychoanalytische und sozialpsychologische Ansätze zur Identitätstheorie diskutiert, die Rolle von Selbstkonzept und Selbstwertgefühl erörtert, und die Bedeutung von sozialen Rollen und der Unterscheidung zwischen Sex und Gender herausgestellt. Die Dekonstruktionsansätze von Judith Butler werden eingeordnet und in Bezug zu den Romanen gesetzt.
4. Lebensentwürfe weiblicher Figuren in Marilyn Frenchs Romanen: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung weiblicher Lebensentwürfe in Frenchs Romanen. Es untersucht die geschlechtsspezifischen Erziehungs- und Bildungsprozesse, die Flucht in die Innenwelt, die Herausforderungen der Pubertät, die Erfahrung der Defloration und die Institution der Ehe als manifestierte soziale Geschlechterrolle. Ein besonderer Fokus liegt auf der Darstellung von Gewalt gegen Frauen in verschiedenen Formen, der Bedeutung der Mutterrolle und der Rolle weiblicher Solidaritätsgruppen.
5. Literarische Darstellungsmittel der Identitätsproblematik: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die literarischen Mittel, die French verwendet, um die Identitätsproblematik ihrer weiblichen Figuren darzustellen. Untersucht werden Erzählstrukturen, die Darstellung von Zeit und Raum, und der Authentizitätsanspruch der Erzählinstanz. Der Fokus liegt auf der Frage, wie die literarische Gestaltung die Herausforderungen und Möglichkeiten weiblicher Identitätsfindung widerspiegelt.
6. „Behind the Bestsellers“ – eine journalistische Rezeptionsanalyse von The Women’s Room: Dieses Kapitel analysiert die Rezeption von „The Women’s Room“ in der Literaturkritik. Es untersucht die Rolle der feministischen Literaturkritik, den Einfluss von geschlechtsspezifischen Vorurteilen in Rezensionen und die Auseinandersetzung mit traditionellen Klischees über Frauen und Literatur. Der Fokus liegt auf der Frage, wie die Rezeption die Bedeutung des Romans beeinflusst hat.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Magisterarbeit über weibliche Identität in Marilyn Frenchs Romanen
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit analysiert die Darstellung von Frauen und weiblicher Identitätsfindung in ausgewählten Romanen der Autorin Marilyn French. Im Fokus stehen die Herausforderungen und Möglichkeiten weiblicher Identitätsfindung im Kontext gesellschaftlicher Geschlechterrollen und -erwartungen. Die Arbeit untersucht, wie French diese Thematik literarisch darstellt und setzt dies in Beziehung zu philosophischen und sozialwissenschaftlichen Diskursen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet folgende Themenschwerpunkte: Weibliche Identität und ihre Konstruktion, gesellschaftliche Geschlechterrollen und deren Auswirkungen auf Frauen, Gewalt gegen Frauen in verschiedenen Formen, feministische Perspektiven in Literatur und Literaturkritik sowie literarische Darstellungsmittel und deren Funktion im Kontext der weiblichen Identität.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit besteht aus sechs Kapiteln: Kapitel 1 skizziert die Fragestellung und den methodischen Ansatz. Kapitel 2 untersucht den historischen Diskurs über die Frau in Philosophie und Wissenschaft. Kapitel 3 beleuchtet den Zusammenhang zwischen Identität, Geschlecht und gesellschaftlichen Erwartungen. Kapitel 4 analysiert die Darstellung weiblicher Lebensentwürfe in Frenchs Romanen. Kapitel 5 konzentriert sich auf die literarischen Mittel, die French zur Darstellung der Identitätsproblematik einsetzt. Kapitel 6 analysiert die Rezeption von Frenchs Romanen, insbesondere "The Women's Room", in der Literaturkritik.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine literaturwissenschaftliche Analyse der ausgewählten Romane von Marilyn French. Sie bezieht dabei philosophische und sozialwissenschaftliche Theorien und Konzepte zur weiblichen Identität und Geschlechterrollen mit ein. Die Rezeptionsanalyse von "The Women's Room" stützt sich auf eine Auswertung journalistischer Literaturkritik.
Welche Rolle spielt die Literaturkritik in der Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Rezeption von Marilyn Frenchs Romanen, insbesondere "The Women's Room", in der Literaturkritik. Dabei wird untersucht, wie geschlechtsspezifische Vorurteile und traditionelle Klischees die Rezensionen beeinflusst haben und wie die feministische Literaturkritik den Roman rezipiert hat.
Welche konkreten Aspekte weiblicher Identität werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Aspekte weiblicher Identität, darunter die Konstruktion weiblicher Identität im Kontext gesellschaftlicher Erwartungen, die Auswirkungen von Geschlechterrollen auf das Selbstverständnis von Frauen, die Erfahrung von Gewalt (physisch, psychisch, finanziell), die Rolle der Mutter, die Bedeutung weiblicher Solidarität und die Möglichkeiten, aus traditionellen Rollenmustern auszubrechen.
Welche Rolle spielt Judith Butlers Dekonstruktivismus in der Arbeit?
Die Arbeit ordnet die Dekonstruktionsansätze von Judith Butler in den Kontext der Untersuchung ein und setzt sie in Bezug zu den in den Romanen dargestellten Konzepten von Geschlecht und Identität.
Welche Bedeutung haben die literarischen Darstellungsmittel in der Analyse?
Die literarischen Darstellungsmittel in Marilyn Frenchs Romanen (z.B. Erzählstrukturen, Zeit- und Raumdarstellung, Authentizitätsanspruch der Erzählinstanz) spielen eine zentrale Rolle in der Analyse. Die Arbeit untersucht, wie diese Mittel die Herausforderungen und Möglichkeiten weiblicher Identitätsfindung widerspiegeln.
- Quote paper
- Cornelia Peters (Author), 2003, Frauendarstellungen in ausgewählten Romanen der Schriftstellerin Marilyn French, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28699