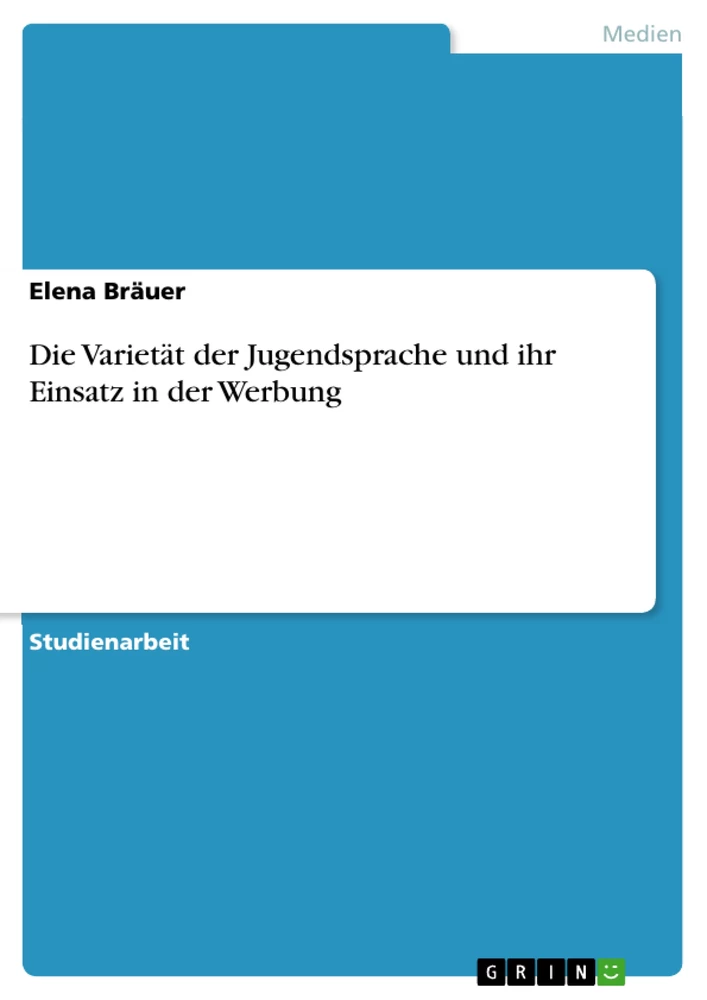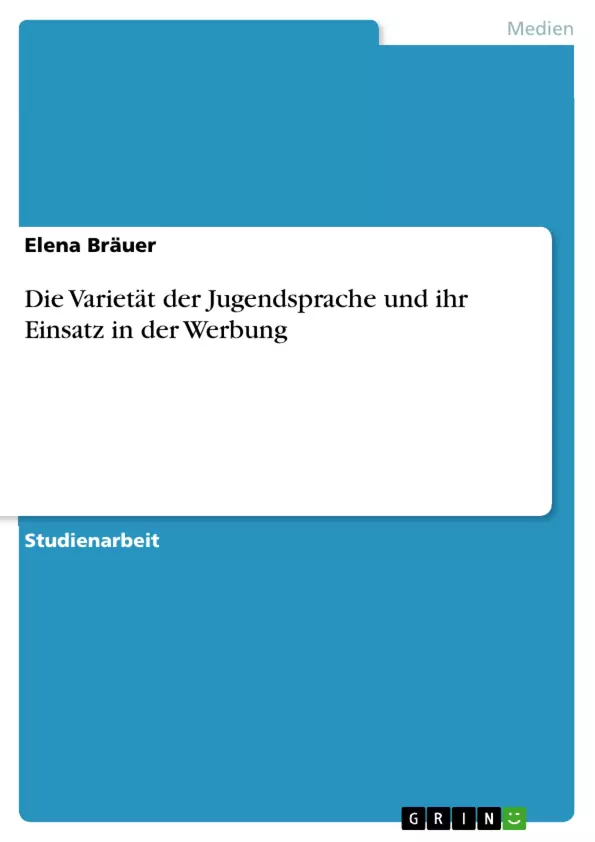In der Ihnen vorliegenden Hausarbeit gehe ich der Frage nach, ob es einen Zusammenhang zwischen Jugendsprache und Werbung gibt.
Im ersten Abschnitt werde ich näher auf die Jugend und die Jugendsprache eingehen und zeigen, dass die Begriffe sehr dehnbar sind und keinen enggesteckten Rahmen haben. Ich zeige auf, dass gerade die Jugendsprache nicht „die“ ist, sondern dass sie u.a. regional und sozial abhängig und einer enormen sprachlichen Fluktuation unterworfen ist. In Kapitel 2.1 werden die Merkmale der Jugendsprache dargestellt, die wie Henne sagt, relativ konstant sind und sich lediglich im Wortmaterial verändern. Absatz 3 gibt einen Überblick über verschiedene Ansätze der Jugendsprachforschung. In Kapitel 4 Jugendsprache und Werbung findet eine Einordnung der Jugendsprache in den Bereich der Werbung statt. Um einen anschließend besseren Vergleich zwischen der Werbe- und der Jugendsprache ziehen zu können, gehe ich in 4.1 kurz auf die Werbesprache ein (an sich würde das Thema der Werbesprache eine ganze Hausarbeit füllen). Im Folgenden greife ich in Abschnitt 5. einzelne Beispiele aus der Werbung, in denen Jugendsprache verwendet wurde, auf und erläutere diese näher. Es folgen zwei Beispiele der Plakatwerbung und zwei Beispiele der TV-Werbung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Jugend und Jugendsprache
- Merkmale der Jugendsprache
- Forschungsübersicht
- Jugendsprache und Werbung
- Exkurs: Werbesprache
- Gemeinsamkeiten
- Unterschiede
- Eigene Untersuchungen
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Jugendsprache und Werbung. Sie analysiert, wie Jugendsprache in Werbesprache verwendet wird und welche Auswirkungen dies auf die Zielgruppe hat.
- Definition und Charakteristika der Jugendsprache
- Entwicklung und Wandel der Jugendsprache
- Die Rolle der Werbung in der Jugendkultur
- Strategien der Verwendung von Jugendsprache in der Werbung
- Die Wirkung von Jugendsprache auf die Rezeption von Werbung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt die Thematik der Jugendsprache in der Werbung vor und erläutert die Relevanz des Themas. Sie führt in die Forschungsfrage und die Struktur der Hausarbeit ein.
2. Jugend und Jugendsprache
Dieses Kapitel beleuchtet die Vielseitigkeit des Begriffs „Jugend“ und die verschiedenen Definitionen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven. Es wird auf die Merkmale der Jugendsprache eingegangen, die sich in ihrer lexikalischen, syntaktischen, phonologischen, morphologischen und pragmatischen Ebene manifestieren.
3. Forschungsübersicht
Kapitel 3 gibt einen Überblick über verschiedene Ansätze der Jugendsprachforschung und beleuchtet die Relevanz der Jugendsprache in der Forschung.
4. Jugendsprache und Werbung
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Verwendung von Jugendsprache in der Werbung. Es wird ein Exkurs zur Werbesprache unternommen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der Werbe- und der Jugendsprache herauszuarbeiten.
5. Eigene Untersuchungen
In diesem Kapitel werden konkrete Beispiele aus der Werbung analysiert, in denen Jugendsprache verwendet wird. Es werden zwei Beispiele der Plakatwerbung und zwei Beispiele der TV-Werbung vorgestellt und analysiert.
Schlüsselwörter
Jugendsprache, Werbung, Werbesprache, Sprachwandel, Jugendkultur, Kommunikation, Zielgruppe, Rezeption, Sprachliche Mittel, Marketing.
- Citar trabajo
- Elena Bräuer (Autor), 2014, Die Varietät der Jugendsprache und ihr Einsatz in der Werbung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/286998