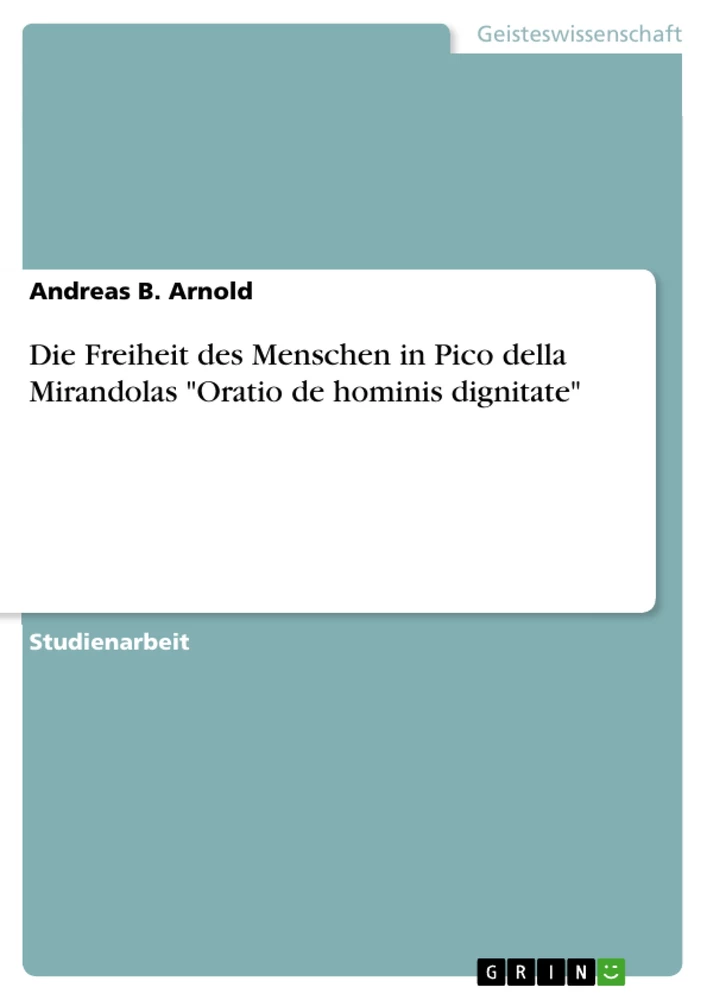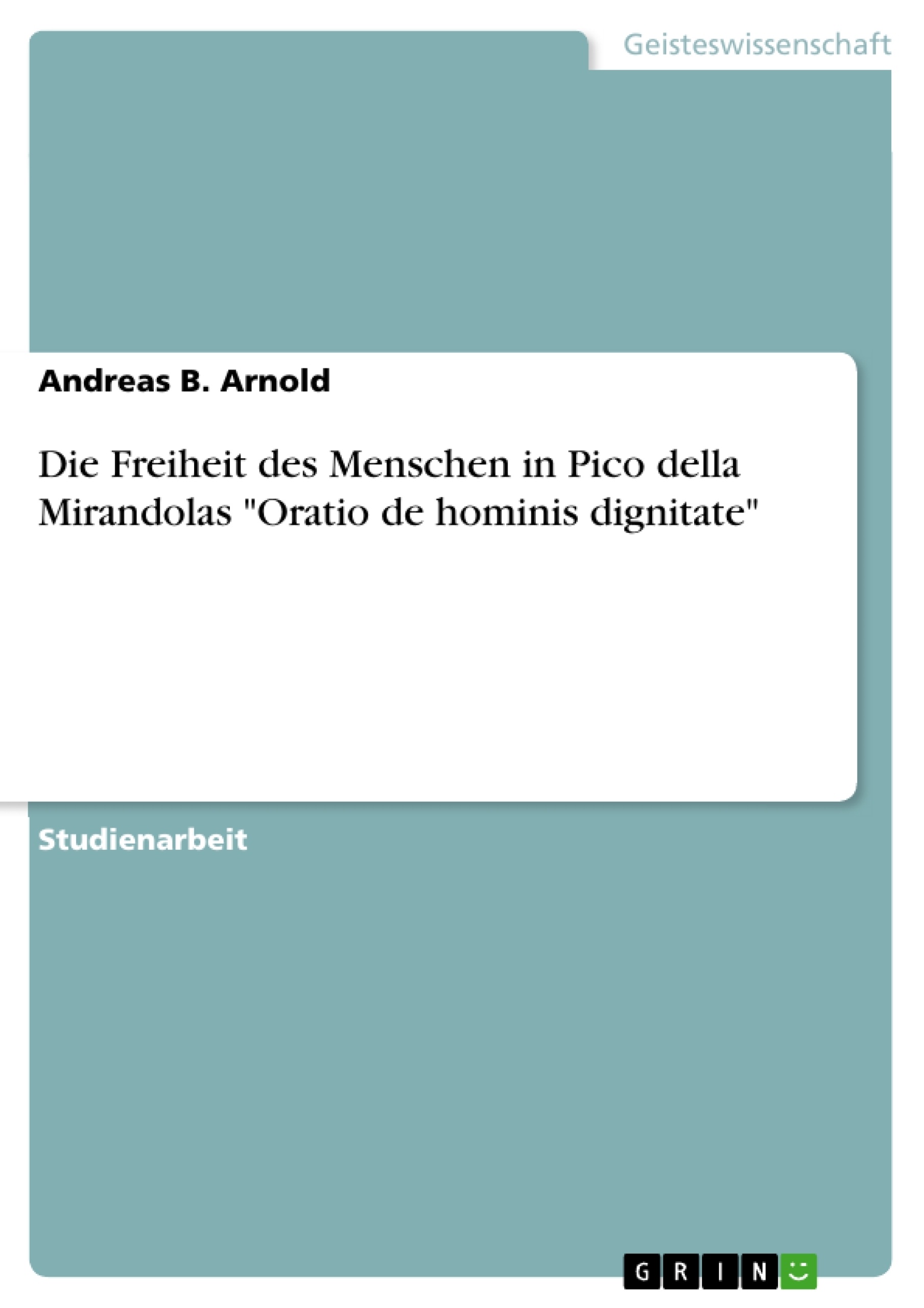In Pico della Mirandolas „Oratio de hominis dignitate“, einem herausragenden, humanistischen Werk der Neuzeit, wird der Begriff der Würde des Menschen neu definiert. Zu Picos Würdebegriff gehört, dass der Mensch sich selbst entscheiden darf, was und wie er sein will. Jeder Einzelne wird vor die Wahl gestellt, wie er diese ihm von Gott geschenkte Freiheit nutzt. Ob er wollüstig, einem vernunftlosen Tier gleich, am Boden kriecht, oder ob er Verstand zeigt und seine Möglichkeiten und sich damit selbst erkennt. Gott bestimmt nicht mehr über das menschliche Leben - wie dies noch in der Scholastik vorherrschende Denkweise war - sondern der Mensch tut dies nun für sich alleine.
Diese besondere Stellung im Kosmos verpflichtet. Um der ihm verliehenen Würde gerecht zu werden, hat der Mensch von Geburt an einen Auftrag, nämlich den, sich seiner Freiheit bewusst zu werden und diese im positiven Sinne zu benutzen, um Gott näher treten zu können.
Weil aber der Mensch Zwietracht in sich trägt, ist die Überwindung der Leiblichkeit und dadurch Gottähnlichkeit bereits im irdischen Dasein kein leichtes Unterfangen. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es das Philosophieren. Hierzu läutert sich der Mensch und setzt sich in die Lage, innere Kämpfe gegen den „Löwen“ und dem „vielgestaltigen Tier“ in sich zu bestehen und schließlich ein Friedensbündnis zwischen Fleisch und Geist einzugehen.
Am Beispiel einer Himmelsleiter zeigt Pico, wie an die „hochheilige Theologie“, mit gereinigten Händen und Füßen heran getreten werden soll. Denn die Grenzen der verstandesmäßig begreifbaren Natur- und Moralphilosophie sind erreicht, wenn über das Erkennen hinaus eine persönliche Begegnung mit Gott ermöglicht werden soll. Hierzu braucht es die höhere und heiligere Form der Magie und die Vermittlung durch die Erzengel, Cherubim, Seraphim und Throne.
Der Mensch ist von Geburt an also gänzlich frei. Er ist ausgestattet mit einem freien Willen und hat Entscheidungsfreiheit in allen Belangen. Darum trägt er für sein Leben die volle Verantwortung und darum soll nach Pico die geschenkte Freiheit auch dazu benutzt werden, Leiblichkeit zu überwinden und zu Gott zu streben. Pico selbst hat dies vorgelebt, indem er in seinen wenigen Lebensjahren sämtliche zugänglichen Philosophie-Schulen studierte und Erkenntnisse aus diesen, der Kabbala und anderen Glaubensbüchern, zusammenführte zu einem Ganzen, das in wesentlichen Fragen Gemeinsamkeiten aufweist und zu dem einen großen Ziel der Freiheit führt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was macht den Menschen aus?
- Welche besondere Stellung nimmt der Mensch in der Welt ein?
- Was ist die Würde des Menschen?
- Was ist Freiheit?
- Welche Freiheiten hat der Mensch?
- Wozu soll der Mensch seine Freiheit nutzen?
- Die Rolle der Philosophie und der Magie für den Menschen
- Die Philosophie
- Die Magie
- Die Bedeutung der Theologie, der Engel und Gott für den Menschen
- Die Theologie
- Gott
- Seele
- Engel
- Wonach strebt der Mensch?
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die „Oratio de hominis dignitate“ von Giovanni Pico della Mirandola und untersucht die philosophischen und theologischen Überlegungen zur menschlichen Freiheit und Würde in der Renaissance. Die Arbeit beleuchtet Picos synkretistische Herangehensweise, die Elemente der antiken Philosophie, des Humanismus und der christlichen Theologie vereint.
- Die einzigartige Stellung des Menschen in der Schöpfung
- Die Freiheit des Menschen als wesentliche Eigenschaft
- Die Bedeutung der Selbstbestimmung und der Wahlfreiheit
- Die Rolle der Philosophie und der Magie für die menschliche Entwicklung
- Der Einfluss der Theologie und des Gottesbildes auf das menschliche Streben
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in Picos Lebenswerk und die „Oratio de hominis dignitate“ ein, die als eine der wichtigsten anthropologischen Schriften der Renaissance gilt.
Kapitel 2 beleuchtet Picos Schöpfungsmythos, der dem Menschen eine einzigartige Position in der Schöpfung zuschreibt. Der Mensch wird ohne vorgegebene Eigenschaften geboren und hat die Freiheit, seine eigene Natur zu bestimmen.
Kapitel 3 befasst sich mit der besonderen Stellung des Menschen in der Welt. Pico argumentiert, dass der Mensch aufgrund seiner Fähigkeit zur Vernunft und Selbstreflexion eine besondere Stellung in der Weltordnung einnimmt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen der menschlichen Freiheit, der Würde, der Selbstbestimmung und der Wahlfreiheit. Weitere wichtige Themen sind die Rolle der Philosophie und der Magie in der Renaissance, sowie die Bedeutung der Theologie und des Gottesbildes für das menschliche Streben.
- Quote paper
- Andreas B. Arnold (Author), 2014, Die Freiheit des Menschen in Pico della Mirandolas "Oratio de hominis dignitate", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/287002