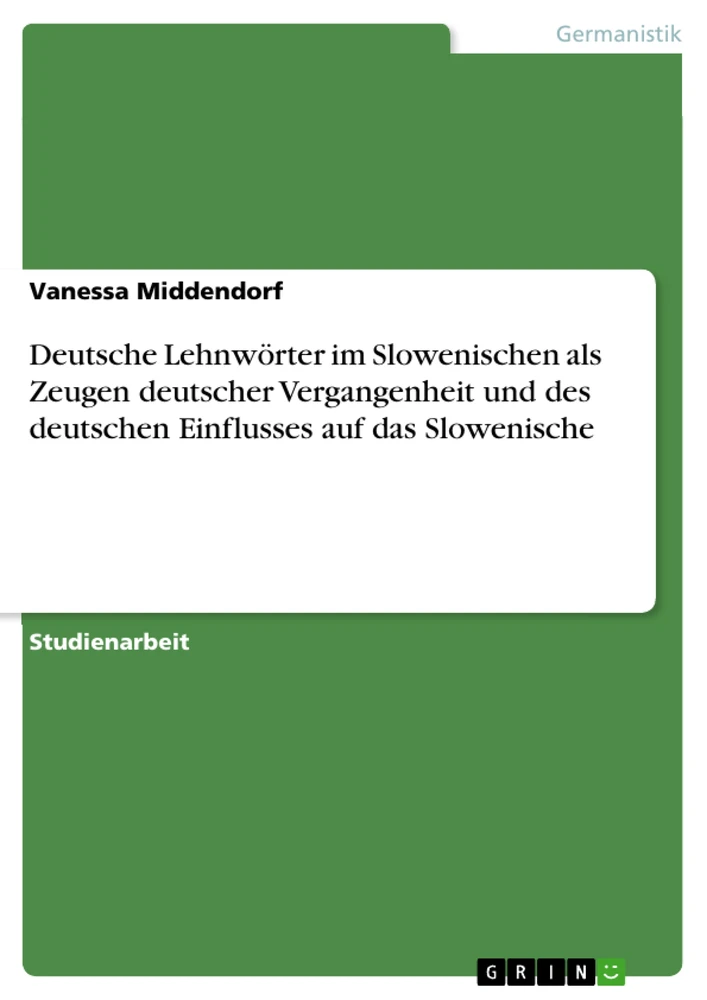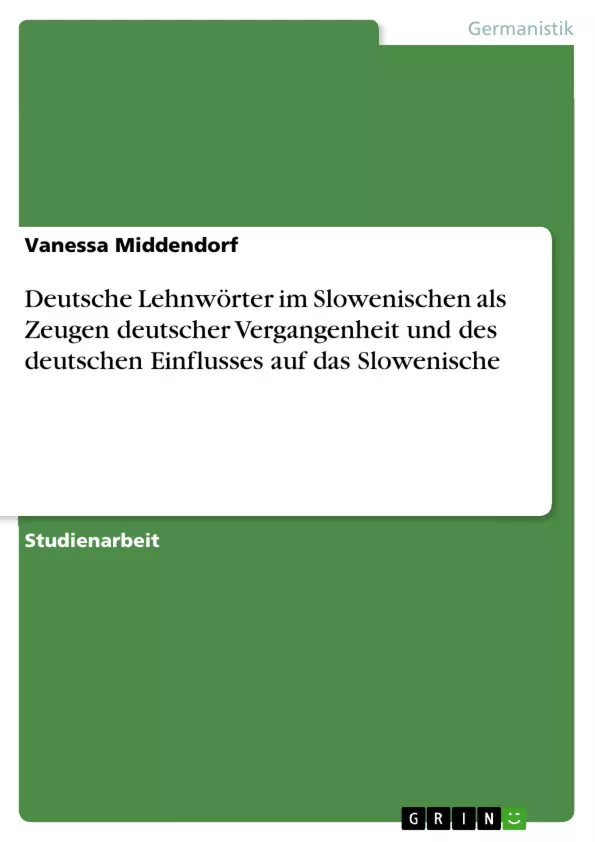Deutsche Entlehnungen finden sich in Sprachen wie dem Polnischen, dem Russischen, dem Ukrainischen, dem Serbischen und vielen mehr. Grenzen mögen zwar geschaffen werden, um einzelne Länder voneinander zu trennen. Den Kontakt und die Verständigung zwischen den Völkern verhindern sie aber nicht - vor allem in sprachlicher Hinsicht.
Die deutschen Lehnwörter im Slowenischen bezeugen den regen Kontakt beider Länder untereinander.
Eine wichtige Rolle spielte hierbei der hochmittelalterliche und neuzeitliche Adel, der in der jeweiligen Zeit zu einem Großteil oder zumindest „teilweise deutsch“ und in den meisten osteuropäischen Gebieten vertreten war. Mit jeder kulturellen Neuerung gelangt somit auch der entsprechende deutsche Wortschatz in die Länder Osteuropas. Wie groß der deutsche Einfluss tatsächlich war und ist wird nicht zuletzt daran deutlich, dass nicht nur vereinzelt Wortschatz entlehnt wird, sondern auch „deutsche Redensarten, […] Vergleiche, […] Bilder und […] Umschreibungen“ in die slowenische Sprache übertragen wurden.Normierungsversuche, die in der Schriftsprache funktioniert haben mögen, schlugen in den Mundarten größtenteils fehl.
Inhaltsverzeichnis
- A) Deutsche Lehnwörter im Slowenischen als Zeugen deutscher Vergangenheit und des deutschen Einflusses auf das Slowenische
- B) Hauptteil
- I. Windisch, Slowenisch, Deutsch
- II. Geschichte als Wegbereiterin für den starken deutschen Einfluss
- III. Lautlehre
- III.1 Vokalismus: a) Kurzvokale
- III.1 Vokalismus: b) Langvokale
- III.1. Konsonantismus: a) Dentale
- III.1. Konsonantismus: b) Labiale
- IV. Die slowenische Sprachreinigung
- C) Fazit: Mundarten als entscheidender Maßstab für die Lehnwortforschung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss des Deutschen auf die slowenische Sprache anhand der deutschen Lehnwörter. Ziel ist es, die Geschichte des Kontakts zwischen beiden Sprachen nachzuvollziehen und die Bedeutung der Lehnwörter als Indikatoren für den kulturellen Austausch zu beleuchten. Dabei wird auch der Einfluss historischer Ereignisse und die Rolle der slowenischen Sprachreinigung berücksichtigt.
- Die Abgrenzung zwischen „Windisch“ und „Slowenisch“
- Der Einfluss historischer Ereignisse auf den deutschen Einfluss auf das Slowenische
- Analyse der lautlichen Veränderungen deutscher Lehnwörter im Slowenischen
- Die Rolle der slowenischen Sprachreinigung im 19. Jahrhundert
- Die Bedeutung von Mundarten für die Lehnwortforschung
Zusammenfassung der Kapitel
A) Deutsche Lehnwörter im Slowenischen als Zeugen deutscher Vergangenheit und des deutschen Einflusses auf das Slowenische: Dieses Kapitel legt die Grundlage der Arbeit, indem es die Bedeutung deutscher Lehnwörter im Slowenischen als Spiegelbild der deutsch-slowenischen Beziehungen hervorhebt. Es wird betont, dass das Slowenische eine besonders hohe Anzahl an Germanismen aufweist und dass die Lehnwörter nicht nur einzelne Wörter, sondern auch Redewendungen und sprachliche Bilder umfassen, was auf einen tiefgreifenden Einfluss des Deutschen hindeutet. Die Arbeit kündigt die weitere Untersuchung der sprachlichen und historischen Aspekte an.
B) Hauptteil: Der Hauptteil der Arbeit gliedert sich in mehrere Unterkapitel, die verschiedene Aspekte des deutschen Einflusses auf das Slowenischen untersuchen. Er dient als umfassende Analyse der Thematik.
I. Windisch, Slowenisch, Deutsch: Dieses Kapitel klärt die terminologische Unterscheidung zwischen „Windisch“ und „Slowenisch“, wobei die unterschiedlichen Bedeutungen und historischen Kontexte der beiden Begriffe im Kontext der Kärntner Slowenen beleuchtet werden. Es wird die Verwendung des Begriffs „Windisch“ in historischen Kontexten und seine heutige Bedeutung in Kärnten erläutert, mit Verweis auf die Arbeiten von Kranzmayer und Striedter-Temps.
II. Geschichte als Wegbereiterin für den starken deutschen Einfluss: Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen historischen Ereignissen und dem deutschen Einfluss auf die slowenische Sprache. Es zeigt auf, wie verschiedene historische Epochen, vom Einfluss der Germanen bis zum Hochmittelalter und der Bedeutung des Adels, zum Eingang deutscher Lehnwörter führten. Es werden konkrete Beispiele für Lehnwörter aus verschiedenen Bereichen (Recht, Krieg, Kirche, etc.) genannt und ihre historische Einordnung erläutert. Der Einfluss der Bibelübersetzungen im 16. Jahrhundert wird ebenfalls thematisiert.
Schlüsselwörter
Deutsche Lehnwörter, Slowenisch, Windisch, Sprachkontakt, Sprachgeschichte, Lautlehre, Vokalismus, Konsonantismus, Sprachreinigung, Kärntner Slowenen, historischer Einfluss, Germanismen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Deutsche Lehnwörter im Slowenischen
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss des Deutschen auf die slowenische Sprache, insbesondere anhand der deutschen Lehnwörter. Sie beleuchtet die Geschichte des Sprachkontakts und die Bedeutung der Lehnwörter als Indikatoren für kulturellen Austausch.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Sprachkontakts zwischen Deutsch und Slowenisch, die lautlichen Veränderungen deutscher Lehnwörter im Slowenischen (Vokalismus und Konsonantismus), die Rolle der slowenischen Sprachreinigung und die Bedeutung von Mundarten für die Lehnwortforschung. Ein besonderer Fokus liegt auf der Unterscheidung zwischen den Begriffen "Windisch" und "Slowenisch" im Kontext der Kärntner Slowenen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in einen einleitenden Teil (A), einen Hauptteil (B) und ein Fazit (C). Der Hauptteil unterteilt sich in Unterkapitel, die sich mit der terminologischen Klärung von "Windisch" und "Slowenisch", dem historischen Kontext des deutschen Einflusses, der Lautlehre der Lehnwörter und der slowenischen Sprachreinigung befassen.
Welche historischen Ereignisse werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht den Einfluss verschiedener historischer Epochen auf den Sprachkontakt, vom Einfluss der Germanen bis zum Hochmittelalter, die Bedeutung des Adels und den Einfluss von Bibelübersetzungen im 16. Jahrhundert. Konkrete Beispiele für Lehnwörter aus verschiedenen Bereichen (Recht, Krieg, Kirche etc.) werden genannt und historisch eingeordnet.
Welche Rolle spielt die Lautlehre?
Die Lautlehre, genauer der Vokalismus und Konsonantismus, wird analysiert, um die lautlichen Veränderungen deutscher Lehnwörter im Slowenischen zu untersuchen. Dabei wird auf die Unterscheidung zwischen Kurz- und Langvokalen und dentale und labiale Konsonanten eingegangen.
Welche Bedeutung haben Mundarten?
Mundarten werden als entscheidender Maßstab für die Lehnwortforschung angesehen. Das Fazit der Arbeit betont deren Bedeutung für eine umfassende Analyse.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Geschichte des Kontakts zwischen Deutsch und Slowenisch nachzuvollziehen und die Bedeutung der deutschen Lehnwörter als Indikatoren für den kulturellen Austausch zu beleuchten. Dabei wird der Einfluss historischer Ereignisse und die Rolle der slowenischen Sprachreinigung berücksichtigt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Deutsche Lehnwörter, Slowenisch, Windisch, Sprachkontakt, Sprachgeschichte, Lautlehre, Vokalismus, Konsonantismus, Sprachreinigung, Kärntner Slowenen, historischer Einfluss, Germanismen.
- Arbeit zitieren
- Vanessa Middendorf (Autor:in), 2012, Deutsche Lehnwörter im Slowenischen als Zeugen deutscher Vergangenheit und des deutschen Einflusses auf das Slowenische, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/287165