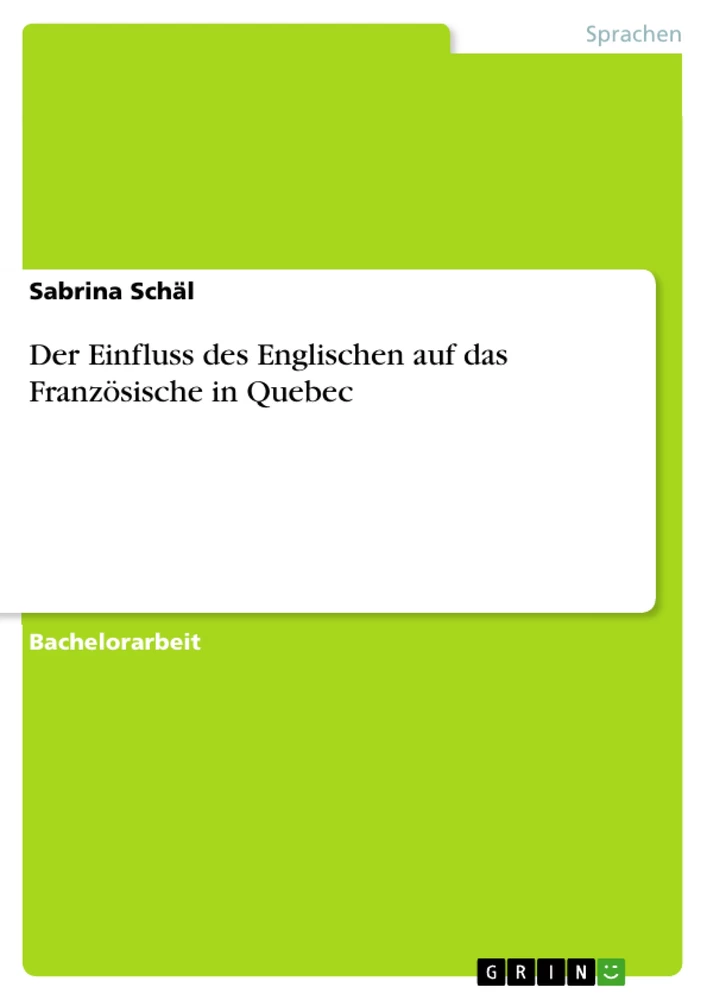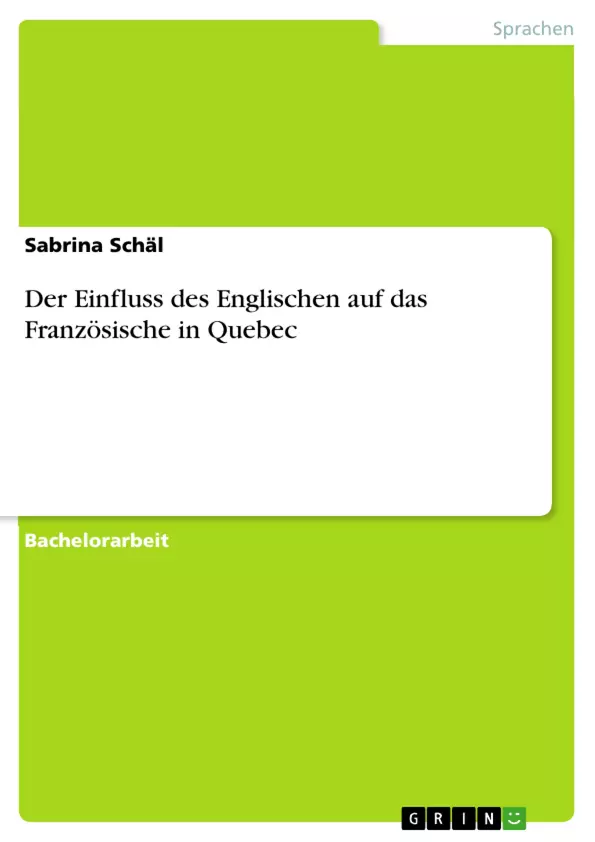Kanada ist das zweitgrößte Land der Erde und hauptsächlich durch die englische Sprache geprägt. Nur in der Provinz Quebec ist das Französische seit fast 40 Jahren offizielle Sprache und seit 35 Jahren sogar alleinige Amtssprache. Rund 79% der Bevölkerung sind frankophone, nur knapp 8% englische Muttersprachler (Boberg 2010, 5). Zu 95% wird in der Provinz französisch gesprochen (ebd., 22). Die französische Sprache hatte es nicht immer leicht, sich durchzusetzen, da Quebec ausschließlich von mehrheitlich anglophonen Gebieten umgeben ist. Doch inwieweit hat das Englische das français québécois beeinflusst? Welche Aussagen kann man über Sprachqualität und Sprachnorm treffen und welchen Beitrag leisteten die geschichtliche Entwicklung Quebecs und die Sprachpolitik?
Im ersten Teil meiner Bachelorarbeit werden die historischen Hintergründe in Kanada thematisiert, die grundlegenden Einfluss auf die Entwicklung des français québécois hatten und die Kultur und Sprache der Menschen prägten. Im Anschluss folgt ein Überblick über die sprachpolitischen Hintergründe: Besonders die Charte de la langue française und das Office québécois de la langue française spielen hier eine zentrale Rolle. Im zweiten Teil geht es um das français québécois, seine Sprachnorm und Sprachqualität. Anschließend wird die Rolle des Englischen in Quebec dargelegt. Wie auch viele andere Sprachen blieb das français québécois nicht von dem englischen Einfluss verschont. Welche Rolle spielt die englische Sprache in der Provinz, in welchen Bereichen kommt sie vor? Desweiteren sind die verschiedenen Typen von Anglizismen Gegenstand dieser Arbeit; sowohl ihre Frequenz als auch die Eingliederung in das quebecer Sprachsystem werden behandelt. Abschließend wird das Bildungssystem Quebecs vorgestellt, um einen Überblick darüber zu bekommen, welchen Beitrag dieses zur Sprachentwicklung leistete.
Mit dieser Bachelorarbeit möchte ich einen Überblick über die einzigartige sprachliche Situation in Quebec geben und unter Berücksichtigung historischer und sprachpolitischer Hintergründe klären, welchen Einfluss das Englische bzw. Anglizismen auf das français québécois ausgeübt haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichtliche Hintergründe
- Besiedlung bis zum 20. Jahrhundert
- Geographische Herkunft der Siedler
- Soziale Herkunft der Siedler und Bildung
- Sprachpolitische Hintergründe
- Révolution tranquille
- Loi 63
- Loi sur la langue officielle
- Charte de la langue française
- Office québécois de la langue française
- Das français québécois
- Erste Aussagen über die Sprachqualität
- Sprachliches Normbewusstsein
- Die Rolle des Englischen
- Definition Anglizismus
- Verschiedene Typen
- Lexikalische Anglizismen
- Semantische Anglizismen
- Calques
- Frequenz
- Aussprache
- Akzeptanz von Anglizismen
- aus Sicht des Dictionnaire québécois d'aujourd'hui
- von den Sprechern
- aus Sicht des Office québécois de la langue française
- Bewertung
- Schulbildung in Quebec
- Von der Grundschule bis zur Sekundarstufe
- Gesetzlich geregelte Unterrichtssprache
- Zusammenhang zwischen Konfession und Schulbildung
- Zusammenfassung
- Literaturangaben
- Primärliteratur
- Sekundärliteratur
- Anhang
- Geographische Herkunft der Siedler
- Die fünf häufigsten Anglizismen im Dictionnaire de fréquence
- Frequenzbereiche der Anglizismen im Dictionnaire de fréquence
- Vergleich der Integration von Anglizismen im français de France und français québécois
- Graphophonematische Relationen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit dem Einfluss des Englischen auf das Französische in Quebec. Sie analysiert die sprachliche Situation in Quebec unter Berücksichtigung der historischen und sprachpolitischen Hintergründe. Ziel ist es, einen Überblick über die Entwicklung des français québécois zu geben und die Rolle des Englischen in der Provinz zu beleuchten.
- Geschichtliche Entwicklung Quebecs und ihre Auswirkungen auf die Sprache
- Sprachpolitik in Quebec und ihre Rolle bei der Sprachentwicklung
- Sprachqualität und Sprachnorm des français québécois
- Verschiedene Typen von Anglizismen und ihre Integration in das quebecer Sprachsystem
- Der Beitrag des Bildungssystems zur Sprachentwicklung in Quebec
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Bachelorarbeit ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss des Englischen auf das français québécois. Sie gibt einen Überblick über die sprachliche Situation in Quebec und die Ziele der Arbeit.
Das Kapitel "Geschichtliche Hintergründe" beleuchtet die Besiedlung Kanadas bis zum 20. Jahrhundert, die geographische Herkunft der Siedler und die soziale Herkunft der Siedler und Bildung. Es zeigt, wie die Geschichte Quebecs die Entwicklung des français québécois beeinflusst hat.
Das Kapitel "Sprachpolitische Hintergründe" befasst sich mit der Sprachpolitik in Quebec, insbesondere mit der "Révolution tranquille", dem "Loi 63", dem "Loi sur la langue officielle", der "Charte de la langue française" und dem "Office québécois de la langue française". Es zeigt, wie die Sprachpolitik die Entwicklung des français québécois beeinflusst hat.
Das Kapitel "Das français québécois" behandelt die Sprachqualität und das sprachliche Normbewusstsein des français québécois. Es zeigt, wie sich die Sprache in Quebec im Vergleich zum französischen Standard entwickelt hat.
Das Kapitel "Die Rolle des Englischen" beleuchtet die verschiedenen Typen von Anglizismen, ihre Frequenz und ihre Integration in das quebecer Sprachsystem. Es zeigt, wie der englische Einfluss die Sprache in Quebec beeinflusst hat.
Das Kapitel "Schulbildung in Quebec" gibt einen Überblick über das Bildungssystem in Quebec und zeigt, welchen Beitrag es zur Sprachentwicklung geleistet hat.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Einfluss des Englischen auf das Französische in Quebec, die sprachliche Situation in Quebec, die historische Entwicklung Quebecs, die Sprachpolitik in Quebec, die Sprachqualität und Sprachnorm des français québécois, verschiedene Typen von Anglizismen, die Integration von Anglizismen in das quebecer Sprachsystem und den Beitrag des Bildungssystems zur Sprachentwicklung in Quebec.
Häufig gestellte Fragen
Wie stark ist der Einfluss des Englischen auf das Französische in Quebec?
Die Arbeit untersucht die sprachliche Situation in Quebec, wo das Französische trotz der Umzingelung durch anglophone Gebiete Amtssprache ist, aber dennoch stark von Anglizismen beeinflusst wird.
Was ist die „Charte de la langue française“?
Es handelt sich um ein zentrales Sprachgesetz in Quebec, das das Französische als alleinige Amtssprache festigt und den Gebrauch in der Öffentlichkeit und Arbeitswelt regelt.
Welche Arten von Anglizismen werden im „français québécois“ unterschieden?
Die Arbeit differenziert zwischen lexikalischen Anglizismen, semantischen Anglizismen und Lehnübersetzungen (Calques).
Wie werden Anglizismen in Quebec gesellschaftlich akzeptiert?
Die Akzeptanz wird aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet: der Sprecher selbst, offizieller Wörterbücher und des „Office québécois de la langue française“.
Welche Rolle spielt die Geschichte für die Sprachentwicklung in Quebec?
Die historische Besiedlung, die soziale Herkunft der Siedler und politische Bewegungen wie die „Révolution tranquille“ waren entscheidend für die heutige Sprachidentität.
- Citation du texte
- Sabrina Schäl (Auteur), 2012, Der Einfluss des Englischen auf das Französische in Quebec, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/287172