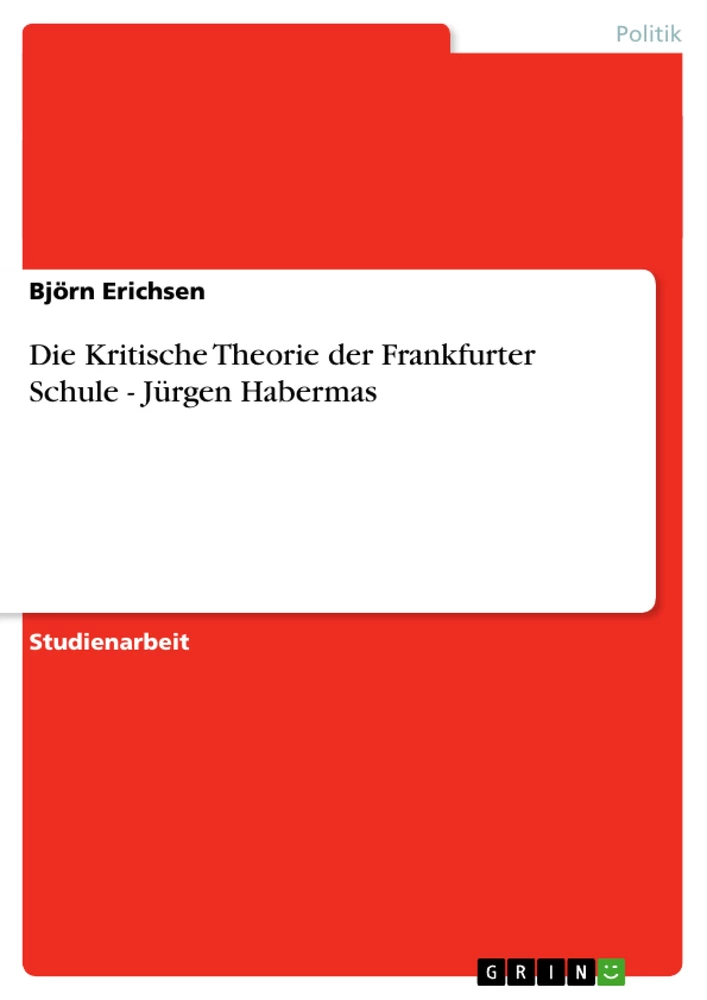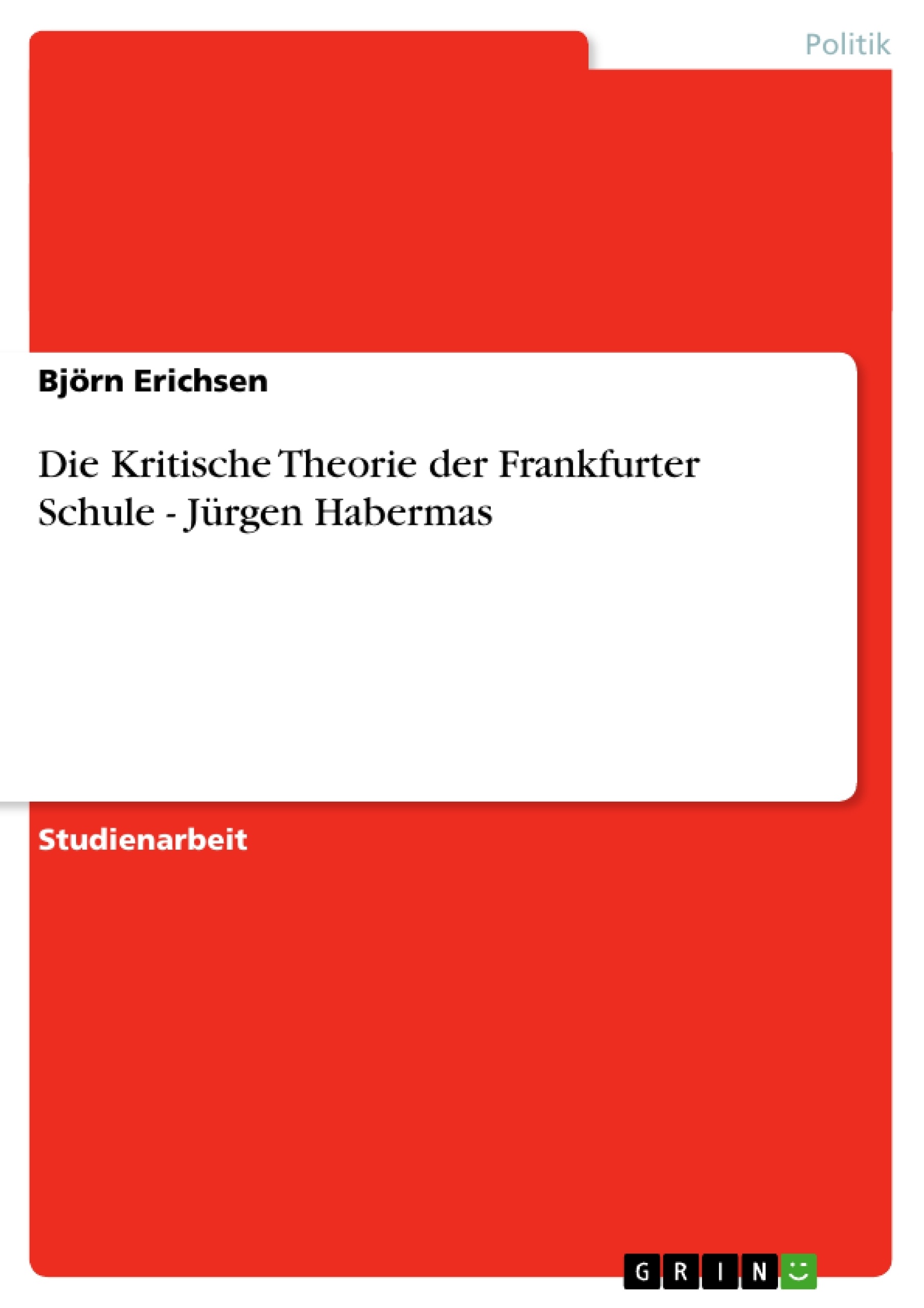Jürgen Habermas, geboren 1929 in Gummersbach, steht in der Tradition der Kritischen Theorie, die vor allem auf Max Horkheimer und Theodor W. Adorno zurückgeht. Ihr Beginn wird in der Regel mit der Antrittsvorlesung Max Horkheimers als Direktor des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt angesetzt. Als Ziel einer kritischen Sozialphilosophie nennt er hierbei die philosophische Deutung des Schicksals der Menschen, insofern sie nicht bloß Individuen, sondern Glieder einer Gemeinschaft sind. Sie hat sich daher vor allem solche Phänomene zu bekümmern, die nur im Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen Leben der Menschen verstanden werden können: um Staat, Recht, Wirtschaft, Religion, kurz um die gesamte materielle und geistige Kultur der Menschen überhaupt.1
Habermas schließt an die Tradition der ’klassischen’ Kritischen Theorie besonders in der Hinsicht an, dass er ebenfalls das normative Ziel seiner Wissenschaft offen legen will. Anders als Horkheimer und Adorno, denen es aufgrund ihrer marxistischen Wurzeln in erster Linie um eine Emanzipation des Proletariats ging, zielt Habermas vielmehr auf eine wachsende Mündigkeit des Menschen innerhalb des demokratischen Verfassungsstaates ab, der nach seiner Ansicht, die Freiheit der Menschen herzustellen bzw. zu steigern habe.2 Habermas, über den Horkheimer einst schrieb, dass es ihm „bei aller Gescheitheit... an bon sens und geistigem Takt gebricht“3 ist, mit seiner langjährigen wissenschaftlichen Arbeit längst aus dem Schatten der ’frühen’ Frankfurter hervorgetreten. Er gilt heute relativ unbestritten als einer der bedeutendsten Sozialwissenschaftler und Philosophen der Bundesrepublik Deutschland. Im Feuilleton der Zeit etwa wurde er anlässlich seiner Ehrung mit dem Friedenspreises des deutschen Buchhandels 2001 als „Hegel der Bundesrepublik“4 bezeichnet.[...]
1 M. Horkheimer: Gesammelte Schriften, Bd. 3, Frankfurt am Main 1988, S. 20.
2 Vgl.: D. Horster: Jürgen Habermas, Neufassung, Hamburg 1999, S. 13ff, (im folgenden zitiert als D. Horster, „1999“, a.a. O.).
3 M. Horkheimer: Gesammelte Schriften, Bd. 18, „Briefwechsel 1949-1973“, Frankfurt am Main 1996, S. 437-449.
4 J. Ross: Hegel der Bundesrepublik, in: Die Zeit, Ausgabe 42, 2001, im Internet, URL: http://www.zeit.de/2001/42/Kultur/print_200142_habermas.html
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Strukturwandel der Öffentlichkeit
- Bürgerliche Öffentlichkeit
- Erosion der Öffentlichkeit und Refeudalisierungsthese
- Die Theorie des kommunikativen Handelns
- Kommunikative Rationalität
- Lebenswelt und System
- Die Lebenswelt
- Entkopplung von System und Lebenswelt
- Die Kolonialisierung der Lebenswelt
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Kritischen Theorie der Frankfurter Schule und konzentriert sich insbesondere auf das Werk von Jürgen Habermas. Sie verfolgt das Ziel, die zentralen Konzepte von Habermas, wie die „Öffentlichkeit“ und das „kommunikative Handeln“, zu erläutern und in ihren historischen und theoretischen Kontext einzubinden.
- Entwicklung und Wandel der bürgerlichen Öffentlichkeit
- Erosion der Öffentlichkeit in modernen Massendemokratien
- Die Theorie des kommunikativen Handelns als Grundlage für eine kritische Gesellschaftstheorie
- Das Verhältnis von Lebenswelt und System in Habermas' Denken
- Die Bedeutung der Kommunikation und Rationalität für die Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt Jürgen Habermas als wichtigen Vertreter der Kritischen Theorie vor und erläutert seine zentralen Anliegen. Es wird deutlich, dass sich Habermas von den Ansätzen der „klassischen“ Kritischen Theorie durch sein Ziel einer wachsenden Mündigkeit des Menschen innerhalb des demokratischen Verfassungsstaates abhebt.
Strukturwandel der Öffentlichkeit
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Habermas' Habilitationsschrift „Strukturwandel der Öffentlichkeit“. Darin analysiert Habermas die Entstehung und Entwicklung der bürgerlichen Öffentlichkeit sowie deren Erosion in modernen Gesellschaften. Er beschreibt die idealtypische bürgerliche Öffentlichkeit als Raum für eine freie und kritische Diskussion und zeigt auf, wie diese durch die Ausweitung des Warenverkehrs und die Dominanz des Massenmediens zunehmend an Bedeutung verliert.
Die Theorie des kommunikativen Handelns
In diesem Kapitel wird Habermas' Hauptwerk „Die Theorie des kommunikativen Handelns“ vorgestellt. Er entwickelt darin eine Theorie des kommunikativen Handelns, die auf der Annahme basiert, dass menschliches Handeln durch Verständigung und Konsens geprägt ist. Habermas unterscheidet dabei zwischen „kommunikativer“ und „instrumenteller“ Rationalität und analysiert das Verhältnis zwischen Lebenswelt und System.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Begriffen der Kritischen Theorie, insbesondere mit den Konzepten von „Öffentlichkeit“, „kommunikativem Handeln“, „Lebenswelt“, „System“, „Rationalität“ und „Mündigkeit“. Es werden die historischen Entwicklungen und gesellschaftlichen Veränderungen beleuchtet, die im Werk von Jürgen Habermas eine zentrale Rolle spielen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern von Habermas' Theorie des kommunikativen Handelns?
Die Theorie besagt, dass menschliches Handeln primär auf Verständigung und Konsens basiert. Habermas unterscheidet dabei zwischen kommunikativer Rationalität (Verständigung) und instrumenteller Rationalität (Zweckorientierung).
Was bedeutet der Begriff „Strukturwandel der Öffentlichkeit“?
Habermas beschreibt damit den historischen Prozess, in dem die bürgerliche Öffentlichkeit als Ort freier Diskussion entstand und später durch Massenmedien und Kommerzialisierung erodierte (Refeudalisierung).
Wie definiert Habermas das Verhältnis von System und Lebenswelt?
Die Lebenswelt ist der Ort der sozialen Integration und Kommunikation, während das System (Wirtschaft, Verwaltung) über Medien wie Geld und Macht gesteuert wird. Die „Kolonialisierung“ beschreibt das Eindringen des Systems in die Lebenswelt.
Worin unterscheidet sich Habermas von Horkheimer und Adorno?
Während die frühe Frankfurter Schule stark marxistisch geprägt war und die Emanzipation des Proletariats fokussierte, zielt Habermas auf die Mündigkeit des Bürgers im demokratischen Verfassungsstaat ab.
Warum wird Habermas als „Hegel der Bundesrepublik“ bezeichnet?
Dieser Titel reflektiert seine enorme Bedeutung als führender Philosoph und Sozialwissenschaftler, der das intellektuelle Fundament der deutschen Demokratie maßgeblich geprägt hat.
- Arbeit zitieren
- Björn Erichsen (Autor:in), 2003, Die Kritische Theorie der Frankfurter Schule - Jürgen Habermas, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28720