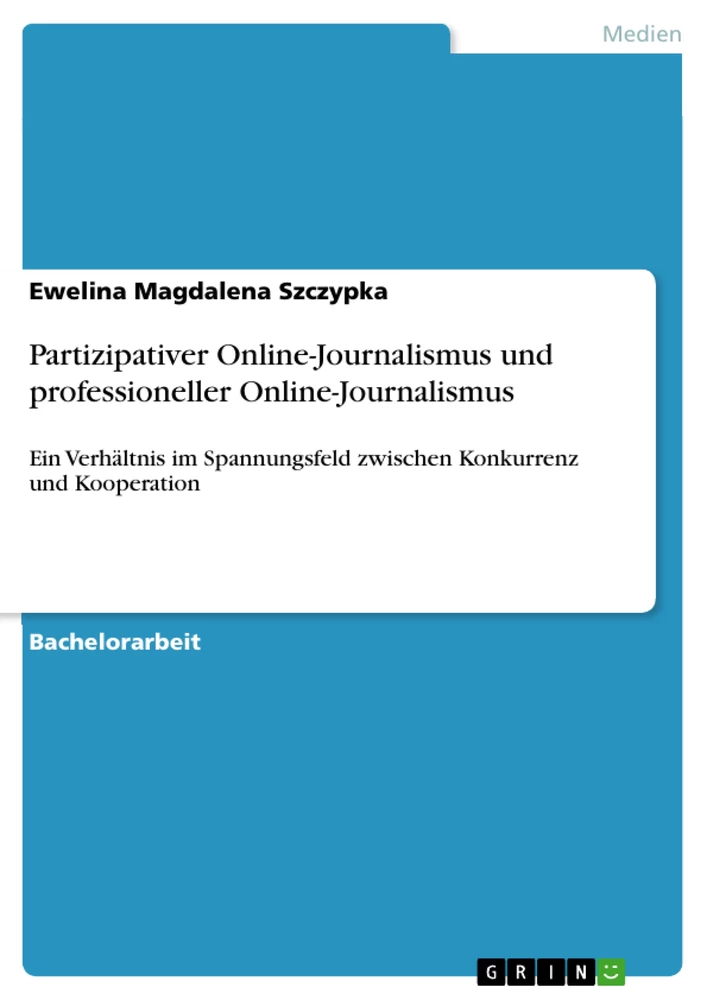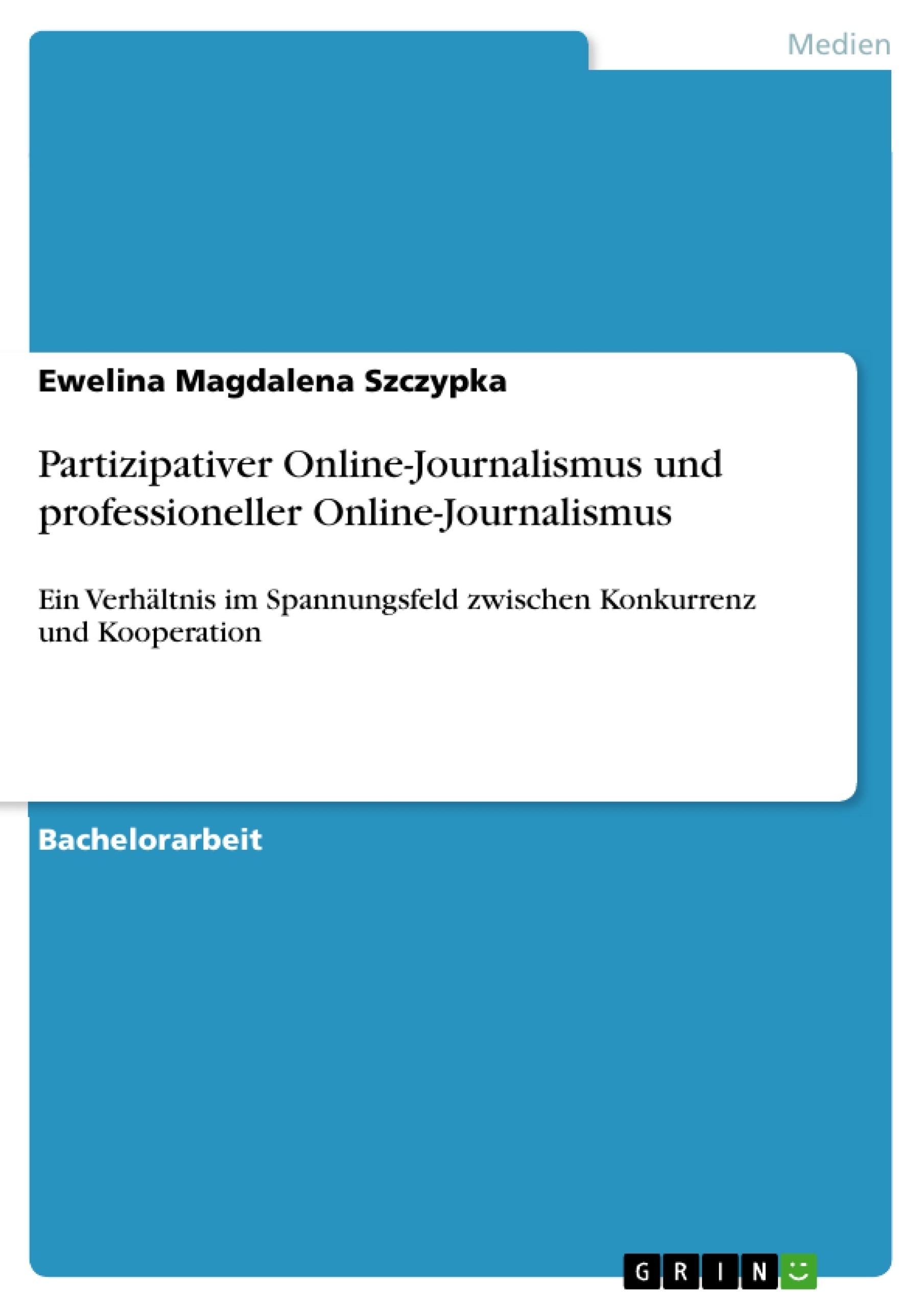Der professionelle Journalismus befindet sich im „Umbruch“, so der Kommunikationswissenschaftler Sven Engesser. Diesen „Umbruch“ verbindet Engesser vor allem mit der Entwicklung des Internets der letzten zwei Jahrzehnte. Er postuliert, dass aufgrund äußerer Kräfte der Journalismus gezwungen sein wird sich zu verändern. Fakt ist, im Jahr 2001 lag der Anteil der Internetnutzer in Deutschland noch bei 37 Prozent (vgl. statista 2014: o.S.). 2013 nutzten bereits 76,5 Prozent der Bevölkerung in Deutschland ab 14 Jahren das Internet (vgl. statista 2014: o.S.) und seit 2014 gibt es 79,1 Prozent Onliner in Deutschland (vgl. van Eimeren, Birgit/Frees, Beate 2014: o.S.). Ferner sind die Barrieren zur Partizipation von Rezipienten an politischer Kommunikation gesunken. Digital-affine Leser beteiligen sich zunehmend mit eigenen Artikeln, Bildern und Videos am Pressewesen. Infolgedessen verlieren die professionellen Medien mehr und mehr ihre Alleinstellung als Schleusenwärter im Nachrichtensektor. (Vgl. Schröder 2011: 20) Spätestens seit 2010, als über das investigative Webangebot WikiLeaks ungefähr 250.000 vertrauliche Dokumente von „Laien“ veröffentlicht wurden, scheint der von Engesser postulierte Umbruch des professionellen Journalismus seinen Weg zu nehmen (vgl. Witte 2010: o.S.). Der bekannteste deutsche Blogger Sascha Lobo behauptet sogar: „WikiLeaks ist eine Art Verlängerung der freien Presse in das Internetzeitalter – als Quelle für investigativen Journalismus.“ (Witte 2010: o.S.) Doch wo führen die Veränderung des Journalismus hin, wenn sich in Zukunft alle am Journalismus beteiligen können? Ist die Partizipation eine Bedrohung für den professionellen Online-Journalismus oder soll sie als Bereicherung verstanden werden? Um diese Fragen zu klären, werden in dieser Bachelorarbeit Definitionen und Qualitätsansätze für den Journalismus erläutert und mithilfe der Literaturanalyse das Verhältnis des professionellen und partizipativen Online-Journalismus eruiert als auch Zukunftsaussichten für den Journalismus detektiert.
Entwurf der Bachelorarbeit
Kapitel 1. & 2.
Im ersten Abschnitt der Arbeit steht die Klärung der Begriffe, des Gegenstandes und der Definitionen. Das Verhältnis zwischen der Profession und der Partizipation hängt unweigerlich mit der Definition und der Qualität des Journalismus zusammen. Insofern wird im zweiten Teil dieser Bachelorarbeit die Qualität des professionellen als auch des partizipativen Online-Journalismus [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Teil
- Professioneller Online-Journalismus
- Partizipativer Online-Journalismus
- Stand der Wissenschaft zum Verhältnis von professionellen Online-Journalismus und partizipativen Online-Journalismus
- Publizistische Qualität im Internet
- Qualität im professionellen Online-Journalismus
- Qualität im partizipativen Online-Journalismus
- Qualitätsbewertung des partizipativen Online-Journalismus
- Partizipativer Online-Journalismus vs. professioneller Online-Journalismus – Konkurrenz und Kooperation
- Treffpunkt Internet – Die Profession im Umgang mit der Partizipation
- Selbst- und Fremdbild
- Konkurrenz zwischen Profession und Partizipation
- Chancen durch Kooperation
- Publizistische Qualität im Internet
- Resümee
- Literaturverzeichnis & Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit dem Verhältnis zwischen professionellem und partizipativem Online-Journalismus im Spannungsfeld zwischen Konkurrenz und Kooperation. Sie analysiert die Entwicklung des Journalismus im Internet und untersucht die Auswirkungen der zunehmenden Partizipation von Rezipienten auf die Profession. Die Arbeit zielt darauf ab, die Qualität beider Formen des Online-Journalismus zu beleuchten und die Herausforderungen und Chancen der Zusammenarbeit zwischen professionellen und partizipativen Akteuren zu erörtern.
- Definition und Qualität des professionellen und partizipativen Online-Journalismus
- Konkurrenz und Kooperation zwischen professionellem und partizipativem Online-Journalismus
- Herausforderungen und Chancen für den Journalismus im digitalen Zeitalter
- Zukunftsaussichten für den Journalismus im Kontext der Partizipation
- Entwicklungen und Trends im Bereich des Online-Journalismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Bachelorarbeit vor und erläutert die Intention der Arbeit. Sie beleuchtet den Wandel des Journalismus im digitalen Zeitalter und die zunehmende Bedeutung der Partizipation von Rezipienten. Die Einleitung führt in die Problematik des Verhältnisses zwischen professionellem und partizipativem Online-Journalismus ein und stellt die Forschungsfragen der Arbeit dar.
Der theoretische Teil der Arbeit definiert den professionellen und partizipativen Online-Journalismus. Er analysiert die unterschiedlichen Qualitätsansätze und die Herausforderungen, die sich aus der zunehmenden Partizipation für den professionellen Journalismus ergeben. Der theoretische Teil legt die Grundlage für die Analyse des Verhältnisses zwischen beiden Formen des Online-Journalismus.
Der dritte Teil der Arbeit befasst sich mit dem Stand der Wissenschaft zum Verhältnis von professionellem und partizipativem Online-Journalismus. Er analysiert die publizistische Qualität beider Formen des Online-Journalismus und untersucht die Herausforderungen und Chancen der Zusammenarbeit zwischen professionellen und partizipativen Akteuren. Dieser Teil der Arbeit beleuchtet die verschiedenen Perspektiven auf das Verhältnis zwischen Profession und Partizipation und diskutiert die Auswirkungen der Partizipation auf die Qualität des Journalismus.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den professionellen Online-Journalismus, den partizipativen Online-Journalismus, die publizistische Qualität, die Konkurrenz und Kooperation zwischen beiden Formen des Online-Journalismus, die Herausforderungen und Chancen des Journalismus im digitalen Zeitalter sowie die Zukunftsaussichten für den Journalismus im Kontext der Partizipation. Die Arbeit analysiert die Entwicklung des Journalismus im Internet und untersucht die Auswirkungen der zunehmenden Partizipation von Rezipienten auf die Profession. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Qualitätsansätze und die Herausforderungen, die sich aus der zunehmenden Partizipation für den professionellen Journalismus ergeben.
Häufig gestellte Fragen
Was ist partizipativer Online-Journalismus?
Es ist eine Form des Journalismus, bei der sich "Laien" oder Rezipienten aktiv durch Blogs, Videos oder Plattformen wie WikiLeaks an der Nachrichtenproduktion beteiligen.
Ist Bürgerjournalismus eine Bedrohung für Profi-Journalisten?
Die Arbeit untersucht, ob Partizipation eine Konkurrenz darstellt oder durch Kooperation eine Bereicherung für die publizistische Qualität sein kann.
Wie hat das Internet die Rolle der Medien verändert?
Professionelle Medien verlieren ihre Alleinstellung als "Schleusenwärter" (Gatekeeper), da Informationen nun von jedermann veröffentlicht werden können.
Wie steht es um die Qualität im partizipativen Journalismus?
Die Arbeit analysiert Qualitätsansätze und hinterfragt, ob Laien-Beiträge professionellen Standards in Bezug auf Recherche und Objektivität genügen.
Welche Zukunftsaussichten hat der Journalismus?
Es wird ein hybrides Modell erwartet, in dem professioneller Journalismus durch investigative Quellen aus der Partizipation (wie WikiLeaks) ergänzt wird.
- Quote paper
- Ewelina Magdalena Szczypka (Author), 2014, Partizipativer Online-Journalismus und professioneller Online-Journalismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/287224