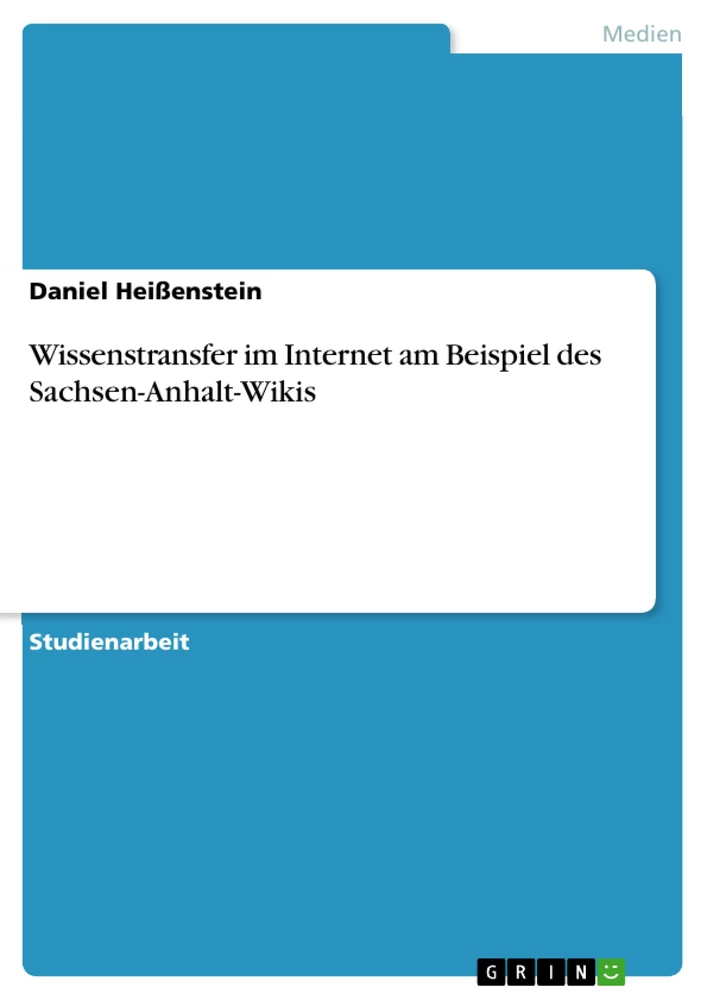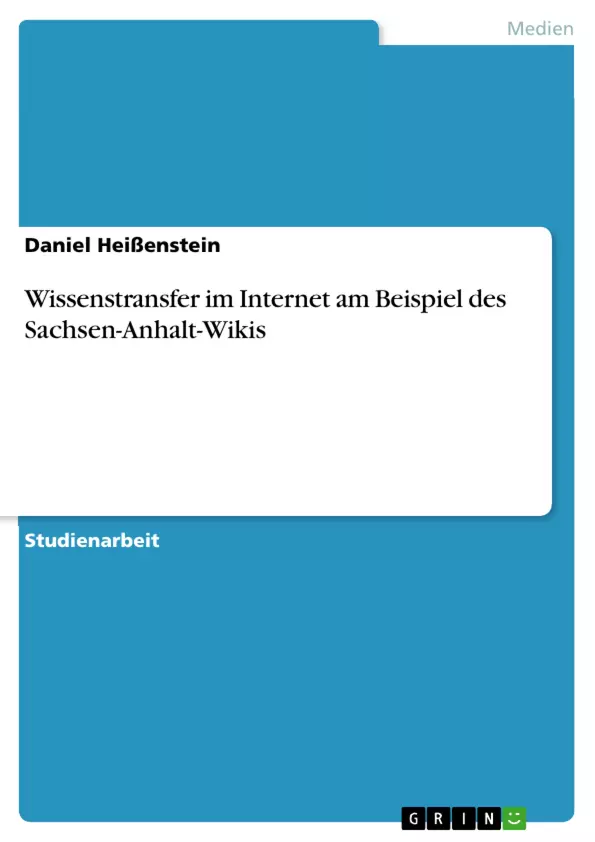„Wissen ist Macht", das schrieb der Philosoph Francis Bacon in seinem Werk „Novum Organum" bereits im 17. Jahrhundert. Im heutigen Informationszeitalter bekommt der jahrhundertealte Ausspruch eine völlig neue Bedeutung. Jeder Mensch hinterlässt in der Online-Welt eine Art digitalen Fußabdruck und viele große Konzerne wie Google oder Facebook, aber auch verschiedene Regierungen und Geheimdienste, versuchen diesen bestmöglich nachzuvollziehen. Das Motto der Datensammler ist dabei, je mehr Wissen man über Personen sammeln kann, desto besser. Gleichzeitig bietet das Internet eine einzigartige Sammlung von Wissen, eine unsortierte Fülle an Informationen und Daten. Wissen, das früher in Enzyklopädien gesammelt wurde, findet sich mittlerweile auf unzähligen spezialisierten Webseiten. Einzelne Projekte wie Wikipedia übertreffen jede analoge Version eines Lexikons und vereinen eine riesige Wissensmenge auf einer Seite. Die schiere Menge an Wissen, die durch das Internet verfügbar ist, sprengt jeden Rahmen. Nur durch Filter- und Auswahlhilfen wie Google kann man als User den Informations- und Wissensdschungel überhaupt überblicken und sich darin fortbewegen. Wissen ist online in vielfältigen Formen und in unendlich scheinender Menge verfügbar. Diese Arbeit nimmt sich des Themas an und beschäftigt sich mit dem Begriff Wissen und Wissenstransfer im Internet. Zunächst wird der Begriff geklärt, welche Eigenschaften er hat und welche Arten von Wissen es gibt. Danach wird Wissenstransfer im Internet allgemein untersucht. Zu der Thematik Wissen gehört in diesem Zusammenhang auch die Wissensverarbeitung und das Wissensmanagement, welche ebenfalls behandelt werden. Ein besonderer Augenmerk dieser Arbeit liegt auf der Wissensform „Wiki", welche allgemein definiert und beschrieben wird. Wichtig ist hierbei, wie der Wissenstransfer in Wikis abläuft. Mithilfe der vorher beschriebenen Modelle und Theorien wird ein ausgewähltes Wiki, das Sachsen-Anhalt-Wiki, auf die obigen Punkte hin untersucht. Bei der Analyse des Portals werden unter anderem die Wiki-Prinzipien und der Wissenstransfer unter die Lupe genommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wissen
- Definition
- Wissensarten und -eigenschaften
- Wissenstransfer
- Wissensverarbeitung
- Wissensmanagement
- Formen der Wissensvermittlung
- Blogs
- Wikis
- Wiki-Prinzipien
- Wissenstransfer mit Wikis
- Anwendung
- Sachsen-Anhalt-Wiki
- Untersuchung Wiki-Prinzipien
- Untersuchung Wissenstransfer
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Thema Wissenstransfer im Internet, am Beispiel des Sachsen-Anhalt-Wikis. Ziel ist es, den Begriff Wissen und Wissenstransfer im Kontext des Internets zu analysieren und zu untersuchen, wie Wissen in Wikis vermittelt und transferiert wird. Dabei wird das Sachsen-Anhalt-Wiki als Fallbeispiel herangezogen, um die Anwendung der Wiki-Prinzipien und des Wissenstransfers in der Praxis zu beleuchten.
- Definition und Eigenschaften von Wissen
- Wissenstransfer im Internet
- Wiki-Prinzipien und ihre Anwendung
- Wissenstransfer in Wikis
- Analyse des Sachsen-Anhalt-Wikis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Wissenstransfer im Internet ein und stellt die Relevanz des Themas im digitalen Zeitalter heraus. Sie beleuchtet die Bedeutung von Wissen in der heutigen Zeit und die Herausforderungen, die sich aus der Fülle an Informationen im Internet ergeben.
Das Kapitel „Wissen" definiert den Begriff Wissen und beleuchtet verschiedene Definitionen aus unterschiedlichen Perspektiven. Es werden verschiedene Wissensarten und -eigenschaften vorgestellt, wie z.B. die Immaterialität, Unendlichkeit und Vermehrung durch Gebrauch. Außerdem werden die Themen Wissensverarbeitung und Wissensmanagement behandelt.
Das Kapitel „Formen der Wissensvermittlung" stellt verschiedene Formen der Wissensvermittlung im Internet vor, mit einem besonderen Fokus auf Wikis. Es werden die Prinzipien von Wikis erläutert und die Funktionsweise des Wissenstransfers in Wikis beschrieben.
Das Kapitel „Anwendung" analysiert das Sachsen-Anhalt-Wiki anhand der zuvor beschriebenen Theorien und Modelle. Es werden die Wiki-Prinzipien und der Wissenstransfer im Sachsen-Anhalt-Wiki untersucht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Wissenstransfer, Internet, Wiki, Sachsen-Anhalt-Wiki, Wissensmanagement, Wissensverarbeitung, Wiki-Prinzipien, Wissensvermittlung, digitale Welt, Informationszeitalter, Wissen und Information.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Wissenstransfer im Internet?
Es beschreibt den Austausch und die Vermittlung von Informationen über digitale Plattformen, die über traditionelle Enzyklopädien hinausgehen.
Was sind die zentralen Wiki-Prinzipien?
Wikis basieren auf Offenheit, gemeinschaftlicher Bearbeitung, einfacher Verlinkung und der ständigen Erweiterbarkeit von Inhalten.
Was ist das Sachsen-Anhalt-Wiki?
Ein regionales Wiki-Projekt, das als Fallbeispiel für den Wissenstransfer und das gemeinschaftliche Wissensmanagement im Internet dient.
Warum ist Wissensmanagement heute so wichtig?
Aufgrund der Informationsflut im Internet helfen Filter- und Auswahlhilfen sowie strukturierte Plattformen, Wissen nutzbar zu machen.
Wie unterscheiden sich Blogs und Wikis?
Blogs sind meist chronologisch und subjektiv, während Wikis auf kollaborative Erstellung und eine vernetzte Wissensstruktur setzen.
- Quote paper
- Daniel Heißenstein (Author), 2014, Wissenstransfer im Internet am Beispiel des Sachsen-Anhalt-Wikis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/287588