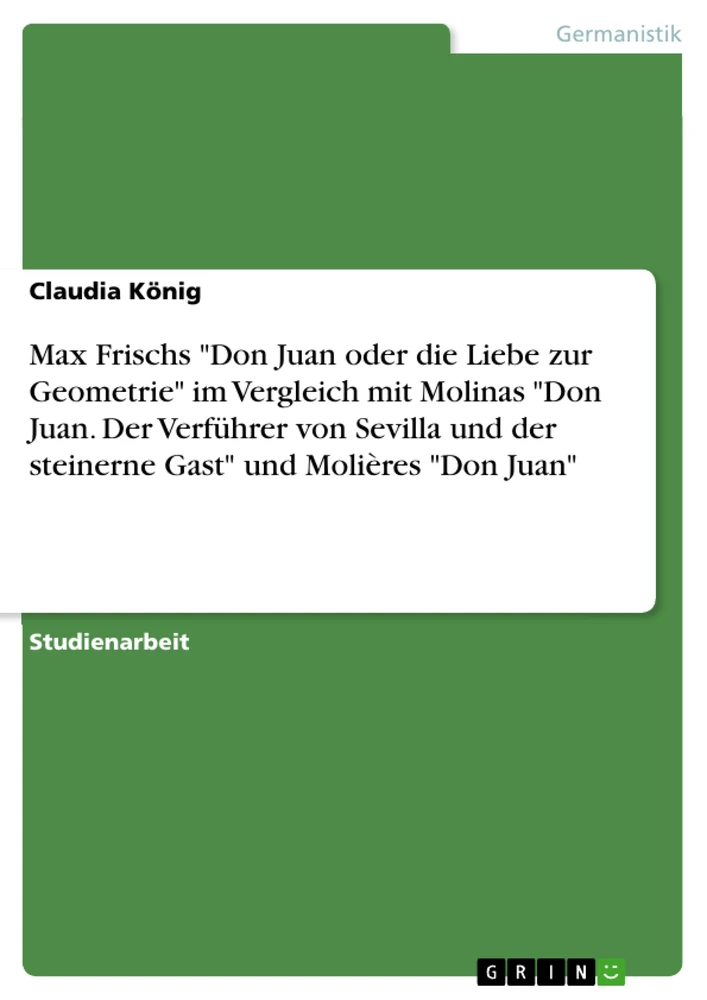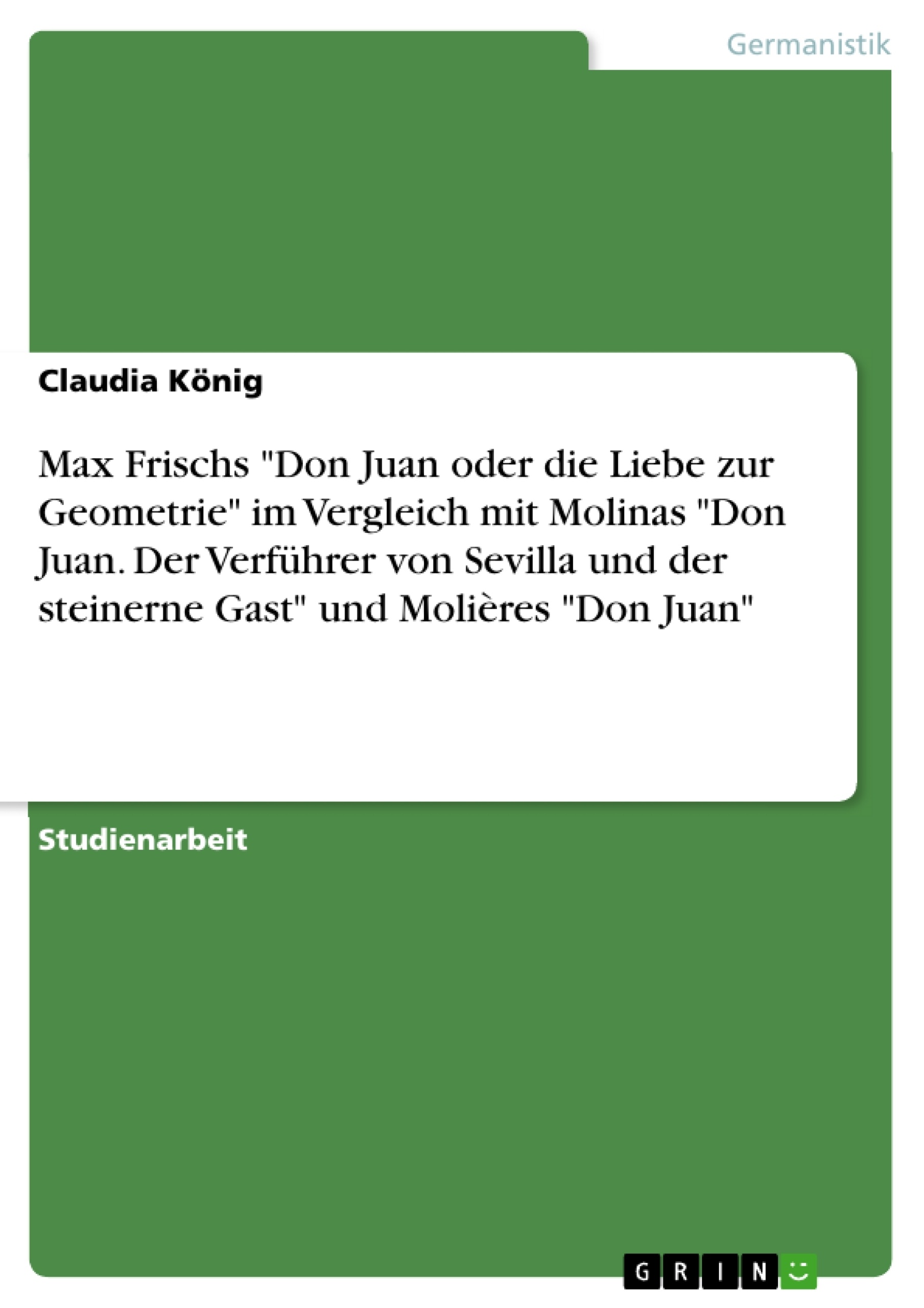Der Don Juan Max Frischs hat eine neue Grundkondition: „Ich liebe. Aber wen?“. Er liebt sich zunächst einmal selbst, ist ein Narziss wie Tirso de Molinas oder Molières Don Juan. Der Don Juan Frischs erlebt allerdings eine Art Identitätskrise, die er bewusst auslebt. Seine Liebe ist ziellos auf jeden gerichtet, sie macht auch vor seinem Freund Roderigo nicht Halt, nur weiß er nicht, was er mit ihr anfangen soll. Ein pubertierender Don Juan demnach, denn der zerstörerische Trieb, den seine literarischen Vorgänger hatten, fehlt ihm.
Tirsos und Molières Don Juan konnten ihre Lebensgrundlage aus der Triebbefriedigung ziehen. Sören Kierkegaard zufolge ließe sich noch differenzieren, ob sie je nach Reflexionsvermögen als Betrüger oder als Verführer agierten: „Von Don Juan muss man den Ausdruck Verführer mit großer Vorsicht gebrauchen, (…) weil er überhaupt nicht unter ethische Bestimmungen fällt. Ich möchte ihn aber lieber einen Betrüger nennen (…). Um Verführer zu sein, bedarf es stets einer gewissen Reflexion und Bewusstheit (…). An dieser Bewusstheit fehlt es Don Juan. Er begehrt, und diese Begierde wirkt verführend; insofern verführt er.“ Ihr Lebensprinzip infrage zu stellen, war ihnen unmöglich: „Ich fühle in mir die Kraft, die ganze Welt zu lieben, und wie Alexander wünschte ich, es gäbe noch eine andere Welt, auf der ich meine Liebeseroberungen ausdehnen könnte.“
Inhaltsverzeichnis
- 1 Die Figur des Don Juan.
- 2 Mittel und Funktion der Satire
- 3 Der Umgang mit dem literarhistorischen Kontext.
- 4 Literatur..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der literarischen Figur des Don Juan und untersucht seine Wandlung von Tirso de Molinas "Don Juan Der Verführer von Sevilla und der steinerne Gast" über Molières "Don Juan" bis hin zu Max Frischs "Don Juan oder die Liebe zur Geometrie". Die Arbeit analysiert die Figur des Don Juan in ihren unterschiedlichen literarischen Kontexten und beleuchtet die Mittel und Funktionen der Satire, die in den einzelnen Werken zum Einsatz kommen.
- Die Entwicklung der Don Juan-Figur in verschiedenen literarischen Epochen
- Die Rolle der Satire als Mittel der Gesellschaftskritik
- Der Einfluss des literarhistorischen Kontextes auf die Darstellung des Don Juan
- Die Bedeutung der Identitätskrise des modernen Don Juan
- Der Konflikt zwischen Liebe und Geometrie in Frischs "Don Juan oder die Liebe zur Geometrie"
Zusammenfassung der Kapitel
1 Die Figur des Don Juan
Dieses Kapitel untersucht die Figur des Don Juan in Max Frischs "Don Juan oder die Liebe zur Geometrie" im Vergleich zu seinen literarischen Vorbildern bei Tirso de Molina und Molière. Es wird die charakteristische Identitätskrise des Don Juan Frischs beleuchtet, die ihn von seinen traditionellen Vorgängern unterscheidet. Der Text analysiert die Liebe des Don Juan Frischs als ein zielloses Streben ohne destruktiven Trieb und kontrastiert ihn mit den Verführer- und Betrügertypen bei Tirso de Molina und Molière. Der Abschnitt beleuchtet außerdem die Rolle der Gesellschaft als Einflussfaktor auf die Entwicklung der Don Juan-Figur und verdeutlicht die Herausforderungen, die Don Juan in seiner Selbstentfaltung durch die Gesellschaft erfährt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Hausarbeit sind: Don Juan, Satire, literarhistorischer Kontext, Identitätskrise, Liebe, Geometrie, Gesellschaft, Verführer, Betrüger, Moral, Moderne.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheidet sich Max Frischs Don Juan von seinen Vorgängern?
Frischs Don Juan leidet an einer Identitätskrise und liebt eigentlich die Geometrie (die Klarheit), während die klassischen Figuren bei Molière oder Molina reine Verführer oder Betrüger sind.
Welche Rolle spielt die Satire in Frischs Werk?
Sie dient dazu, gesellschaftliche Erwartungen und das erstarrte Rollenbild des „großen Verführers“ ironisch zu dekonstruieren.
Was bedeutet der Konflikt zwischen „Liebe“ und „Geometrie“?
Die Geometrie steht für Ordnung, Intellekt und Wahrheit, während die (zwischenmenschliche) Liebe für Don Juan oft mit Lügen und gesellschaftlichem Zwang verbunden ist.
Ist Don Juan bei Frisch ein Verführer?
Er wird von der Gesellschaft in diese Rolle gedrängt, obwohl ihm der zerstörerische Trieb seiner literarischen Vorgänger weitgehend fehlt.
Was kritisiert Frisch an der Gesellschaft?
Er kritisiert, dass die Gesellschaft dem Individuum Rollen aufzwingt, die dessen wahre Selbstentfaltung und Suche nach Wahrheit behindern.
- Quote paper
- Claudia König (Author), 1998, Max Frischs "Don Juan oder die Liebe zur Geometrie" im Vergleich mit Molinas "Don Juan. Der Verführer von Sevilla und der steinerne Gast" und Molières "Don Juan", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/287649