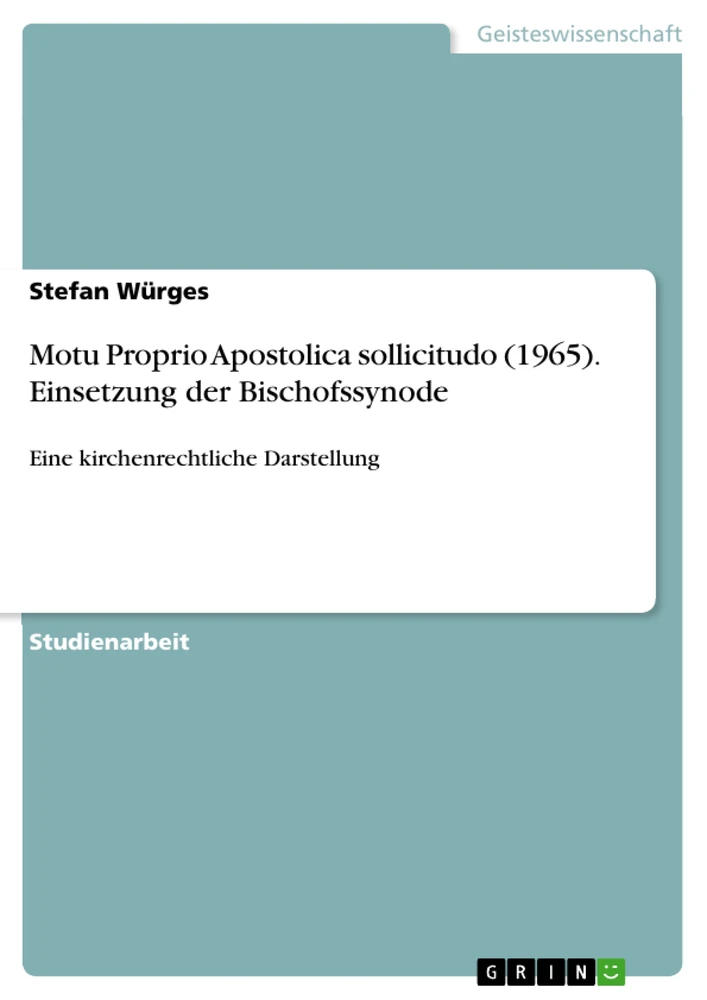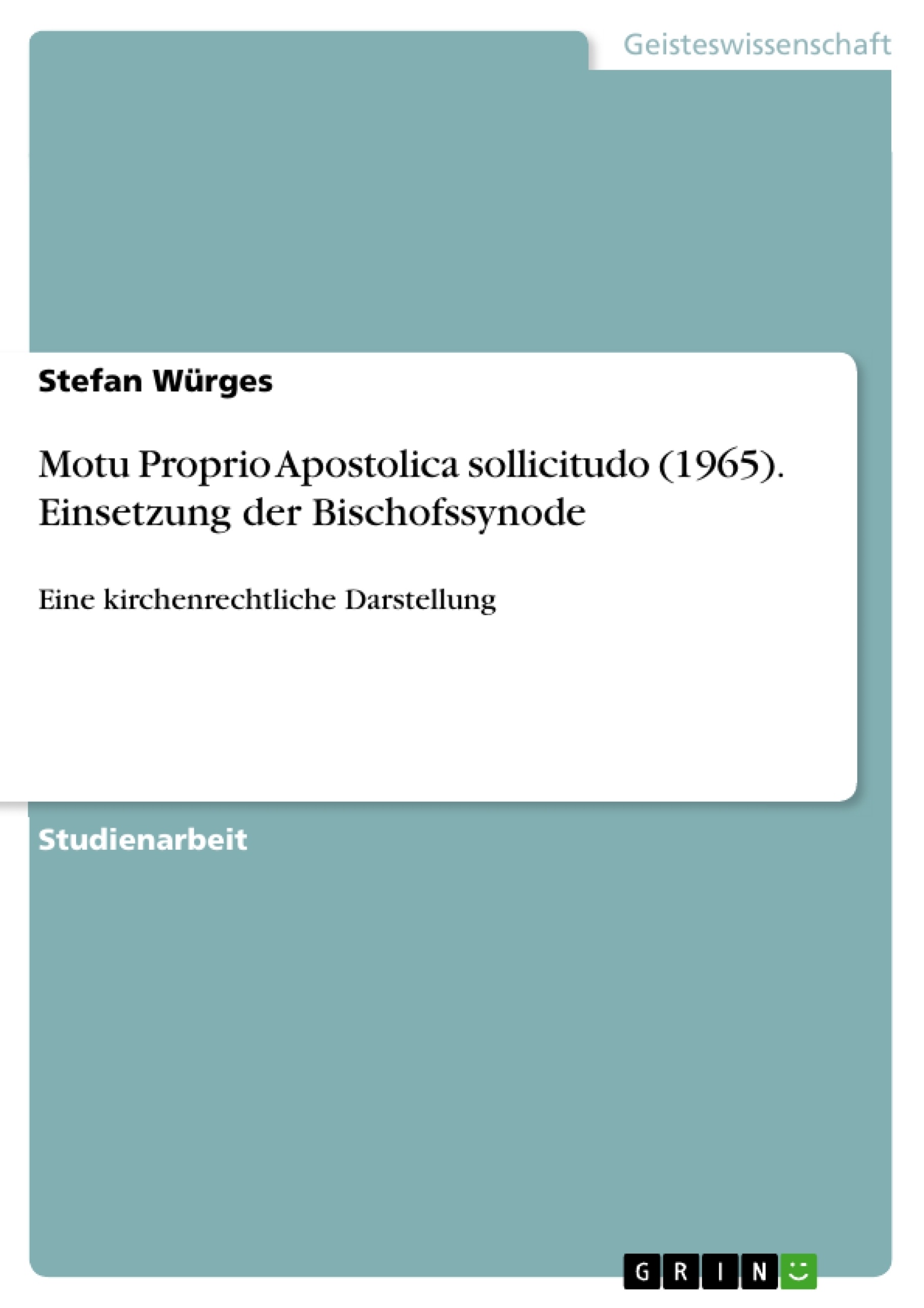Die Bischofssynode erfährt derzeit ein neues Interesse. Papst Franziskus lud zur dritten Außerordentlichen Generalversammlung der Bischofssynode vom 5. bis 19. Oktober 2014 in den Vatikan ein. Sie stand unter dem Thema: „Die pastoralen Herausforderungen der Familie im Kontext der Evangelisierung“.
Diese Generalversammlung war der erste Teil der Bischofssynode, die mit der 14. Ordentlichen Versammlung vom 4. bis 25. Oktober 2015 unter dem Motto „Jesus Christus offenbart das Geheimnis und die Berufung der Familie“ ihren Abschluss finden wird.
Die Bischofssynode wurde in den Medien als bedeutendes Organ der katholischen Kirche dargestellt und stark gewichtet. Eine kirchenrechltiche Darstellung kann hier die ursprüngliche Sicht wieder herstellen, wenn man sich das Motu Proprio Apostolica sollicitudo anschaut und die Kompetenzen der Bischofssynode betrachtet, was mit dieser Seminararbeit geschehen soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Erster Teil: Dokumentenkundliche Ausführungen
- Motu Proprio (MP)
- Normgeber
- Normadressat
- Promulgation
- Verbindlichkeit
- Inkrafttreten
- Inhalt
- Zweiter Teil: Motu proprio Apostolica Sollicitudo
- Normgeber
- Normadressat
- Promulgation
- Verbindlichkeit
- Inkrafttreten
- Inhalt
- Titel und Einleitung
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Einsetzung der Bischofssynode durch das päpstliche Motu Proprio Apostolica Sollicitudo (1965). Sie analysiert die Entstehungsgeschichte der Bischofssynode im Kontext des Zweiten Vatikanischen Konzils und beleuchtet die rechtliche Einordnung des Motu Proprio im kanonischen Recht.
- Die Entstehung der Bischofssynode im Kontext des Zweiten Vatikanischen Konzils
- Die rechtliche Einordnung des Motu Proprio Apostolica Sollicitudo im kanonischen Recht
- Die Rolle der Bischofssynode als Beratungsorgan des Papstes
- Die Bedeutung der Bischofssynode für die Kirche im 20. und 21. Jahrhundert
- Die Entwicklung der Bischofssynode im Laufe der Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung
Die Einführung stellt die Frage nach der bleibenden Wirksamkeit des Kollegialitätsprinzips und die Bedeutung der Communio Ecclesiarum im Kontext des Zweiten Vatikanischen Konzils dar. Sie erläutert, wie Papst Paul VI. mit der Einrichtung der Bischofssynode ein Verfassungsorgan schuf, das sowohl von Befürwortern als auch von Gegnern des Kollegialitätsprinzips angenommen wurde.
Erster Teil: Dokumentenkundliche Ausführungen
Dieser Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der rechtlichen Einordnung des Motu Proprio (MP) im kanonischen Recht. Er behandelt die rechtliche Form, die Promulgation, die Verbindlichkeit und das Inkrafttreten eines MP.
Zweiter Teil: Motu proprio Apostolica Sollicitudo
Dieser Teil konzentriert sich auf das Motu Proprio Apostolica Sollicitudo, das die Errichtung der Bischofssynode für die gesamte Kirche verkündete. Er erläutert die Adressaten, die Promulgation, die Verbindlichkeit und das Inkrafttreten des Dokuments.
Schlüsselwörter
Bischofssynode, Motu Proprio, Apostolica Sollicitudo, Zweites Vatikanisches Konzil, Kollegialität, Communio Ecclesiarum, Kanonisches Recht, Päpstliches Recht, Rechtsgeschichte, Kirche, Kirche im 20. Jahrhundert, Kirche im 21. Jahrhundert.
- Arbeit zitieren
- Stefan Würges (Autor:in), 2013, Motu Proprio Apostolica sollicitudo (1965). Einsetzung der Bischofssynode, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/287711