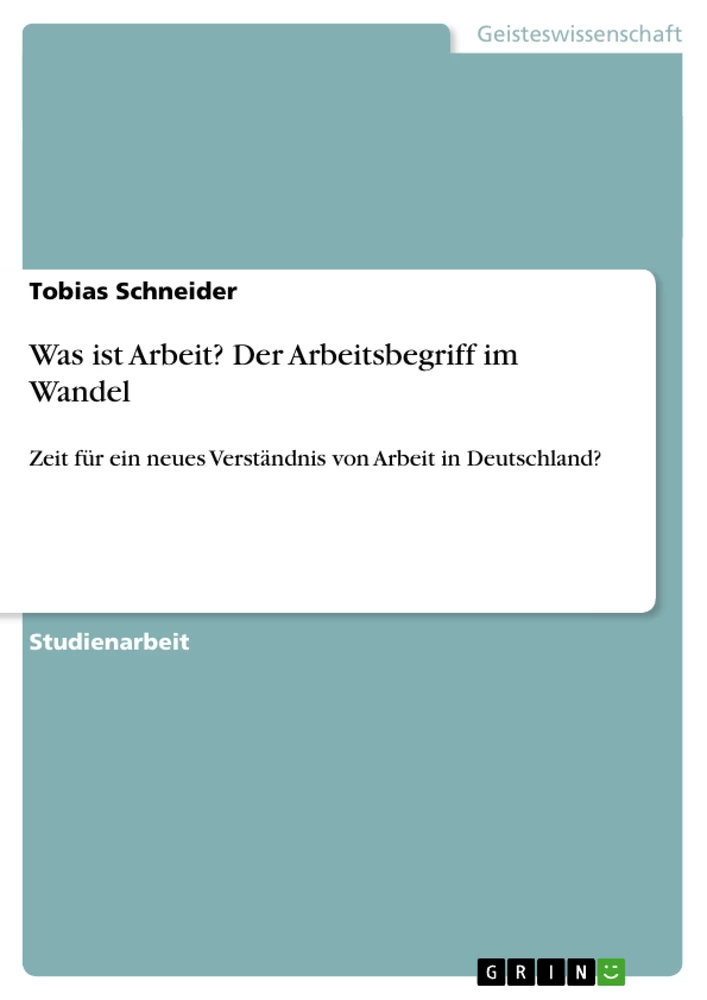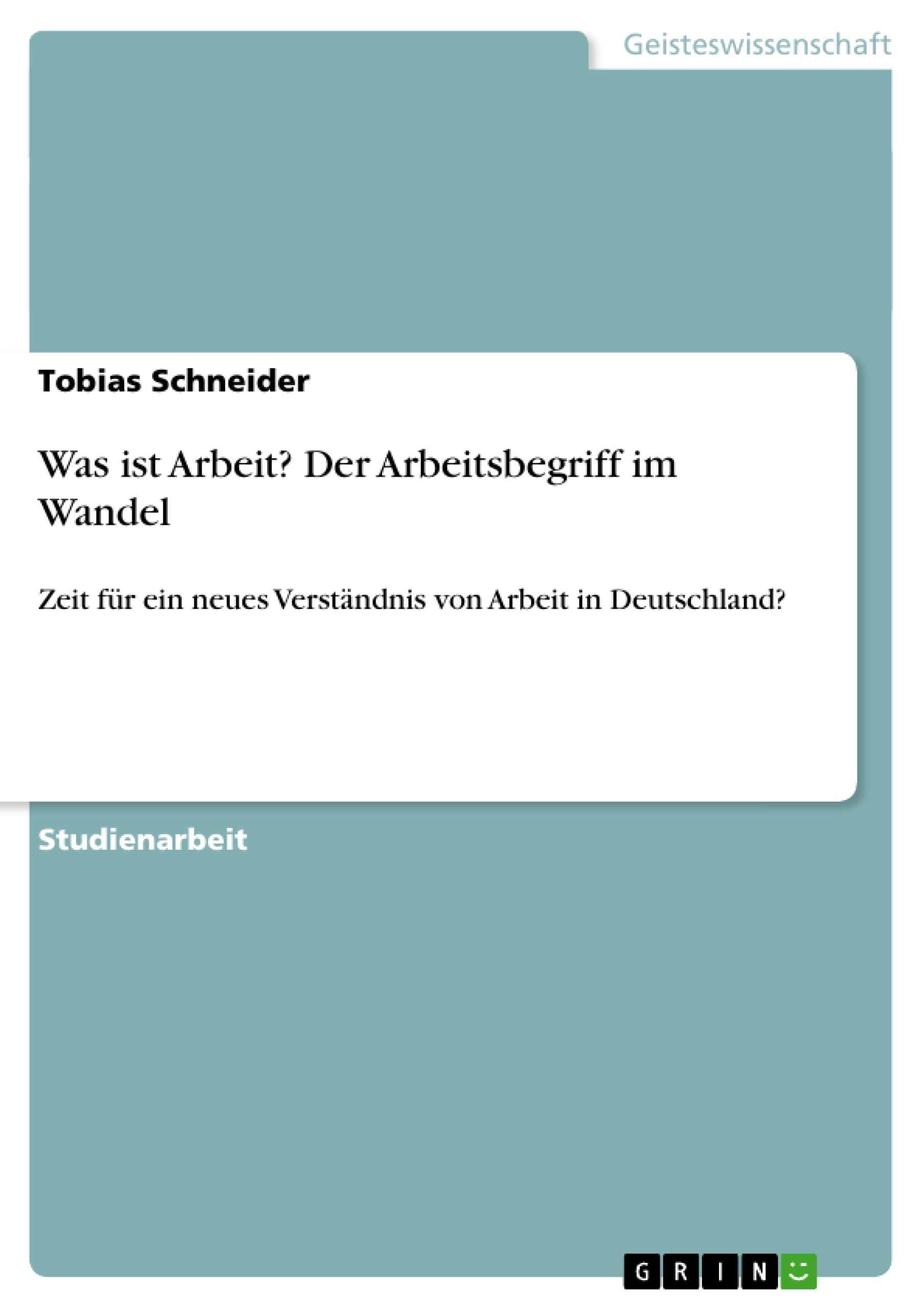Arbeit ist heute eine zentrale Institution unserer Gesellschaft in Deutschland und wohl der meisten weiteren westlich orientierten Industrieländer, weshalb diese auch als Arbeitsgesellschaften bezeichnet werden. Subjektiv wird Arbeit vom Individuum stets als soziale Tatsache wahrgenommen, die sich in vielen Facetten zeigen kann: Lust oder Last, Pflicht oder Menschenrecht, Notwendigkeit oder Selbsterfüllung.
Altkanzler Schröder äußerte sich 2001 in einem Bild-Interview: „Es gibt kein Recht auf Faulheit in unserer Gesellschaft.“ Wer arbeiten könne, aber nicht wolle, dürfe somit nicht mit Solidarität rechnen (Manager-Magazin 2001) .Diese Aussage verdeutlicht das vorherrschende und selten hinterfragte Verständnis von Arbeit in unserer Leistungsgesellschafft: Arbeit ist Lohnarbeit und Voraussetzung für die gesellschaftliche Teilhabe. Erwerbsfähige Menschen müssen einer bezahlten Tätigkeit nachgehen, um ihre eigenen Lebenserhaltungskosten zu finanzieren und um ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu sein. Weiterhin ist sie mit Zwang ausgestattet.
Wer nicht arbeitet erhält unter bestimmten Voraussetzungen zwar Transferleistungen in Form von Hartz IV, die ein Leben unterhalb der Armutsgrenze ermöglichen, dennoch werden Arbeitslose, die angebotene Stellen verweigern, mit weiteren Sanktionen, bis hin zum völligen Aussetzen von Zahlungen, bestraft. Gleichzeitig wird von den Medien in Reportagen und Reality-Shows ein marktkonformes Bild des „faulen Arbeitslosen“ propagiert und reproduziert, welches Vorurteile und einen sozialen Ausschluss dieser befördert und die Erwerbsarbeit in ihrer zentralen Stellung bekräftigt.
Im Folgenden soll verdeutlicht werden, dass es sich lohnt den Begriff der Arbeit in unserer Gesellschaft zu reflektieren und sich deutlich mit ihm auseinanderzusetzen. So wird zuerst die Geschichte des Arbeitsbegriffs verfolgt, daraufhin das Verständnis von Arbeit in Deutschland betrachtet, um letztendlich Gründe aufzubringen, aus denen es sich lohnt, das vorherrschende Arbeitsverständnis grundlegend zu überdenken. Schließlich werden Vorschläge erörtert, wie eine Gesellschaft gestaltet werden kann, die nicht auf dem Primat der Lohnarbeit basiert. Ziel dieser Hausarbeit ist es letztendlich, der verpflichtenden Erwerbsarbeit ihre legitimierende Selbstverständlichkeit zu entziehen und zu einem veränderten Verständnis von Arbeit anzuregen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Arbeitsbegriff im Verlauf der Geschichte
- Normative Herausbildung
- Ökonomische Aufladung
- Vorherrschender Begriff der Arbeit in Politik und Wirtschaft
- Der Arbeitsbegriff in der aktuellen Wirtschaftspolitik
- Der Arbeitsbegriff in der aktuellen Politik der großen Volksparteien
- Der Arbeitsbegriff in der Arbeitssoziologie
- Drei Anläufe zum Aufbrechen des Arbeitsbegriffs
- Erwerbsgesellschaft ohne Erwerbsarbeit – Das System wird sich selbst zum Problem
- Kritik der feministischen Bewegung
- Kritik aus philosophischer Sicht
- Jenseits des konventionellen Arbeitsbegriffs
- Nicht-Arbeit
- Erweitertes Verständnis
- Der Dritte Sektor
- Konzepte für eine Gesellschaft mit einem erweiterten Arbeitsverständnis
- Bürgerarbeit – Ulrich Beck
- Bedingungsloses Grundeinkommen - André Gorz
- Fazit
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Wandel des Arbeitsbegriffs in Deutschland und analysiert die aktuelle Debatte um ein neues Verständnis von Arbeit. Ziel ist es, die vorherrschende Gleichsetzung von Arbeit mit Erwerbsarbeit zu hinterfragen und alternative Konzepte für eine Gesellschaft jenseits des Primats der Lohnarbeit zu erörtern.
- Historische Entwicklung des Arbeitsbegriffs
- Kritik an der dominierenden Erwerbsarbeitsideologie
- Alternative Konzepte für ein erweitertes Arbeitsverständnis
- Die Rolle von Politik und Wirtschaft im Wandel des Arbeitsbegriffs
- Die Bedeutung von Nicht-Arbeit und der Dritte Sektor
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas dar und beleuchtet die aktuelle Debatte um den Arbeitsbegriff in Deutschland. Kapitel 2 verfolgt die Geschichte des Arbeitsbegriffs von der Antike bis zur Gegenwart und zeigt die normative und ökonomische Aufladung des Begriffs auf. Kapitel 3 analysiert das vorherrschende Verständnis von Arbeit in Politik und Wirtschaft, insbesondere in der aktuellen Wirtschaftspolitik und der Arbeitssoziologie. Kapitel 4 beleuchtet drei wichtige Anläufe zum Aufbrechen des traditionellen Arbeitsbegriffs: die Kritik der Erwerbsgesellschaft, die feministische Kritik und die philosophische Kritik. Kapitel 5 erörtert verschiedene Konzepte jenseits des konventionellen Arbeitsbegriffs, wie Nicht-Arbeit, ein erweitertes Verständnis von Arbeit und die Bedeutung des Dritten Sektors. Kapitel 6 stellt Konzepte für eine Gesellschaft mit einem erweiterten Arbeitsverständnis vor, wie Bürgerarbeit nach Ulrich Beck und das bedingungslose Grundeinkommen nach André Gorz.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Arbeitsbegriff, Erwerbsarbeit, Nicht-Arbeit, Arbeitsethik, Kapitalismus, Industrialisierung, Feminismus, Philosophie, Bürgerarbeit, bedingungsloses Grundeinkommen, Dritter Sektor, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Deutschland.
- Citation du texte
- Tobias Schneider (Auteur), 2013, Was ist Arbeit? Der Arbeitsbegriff im Wandel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/287738