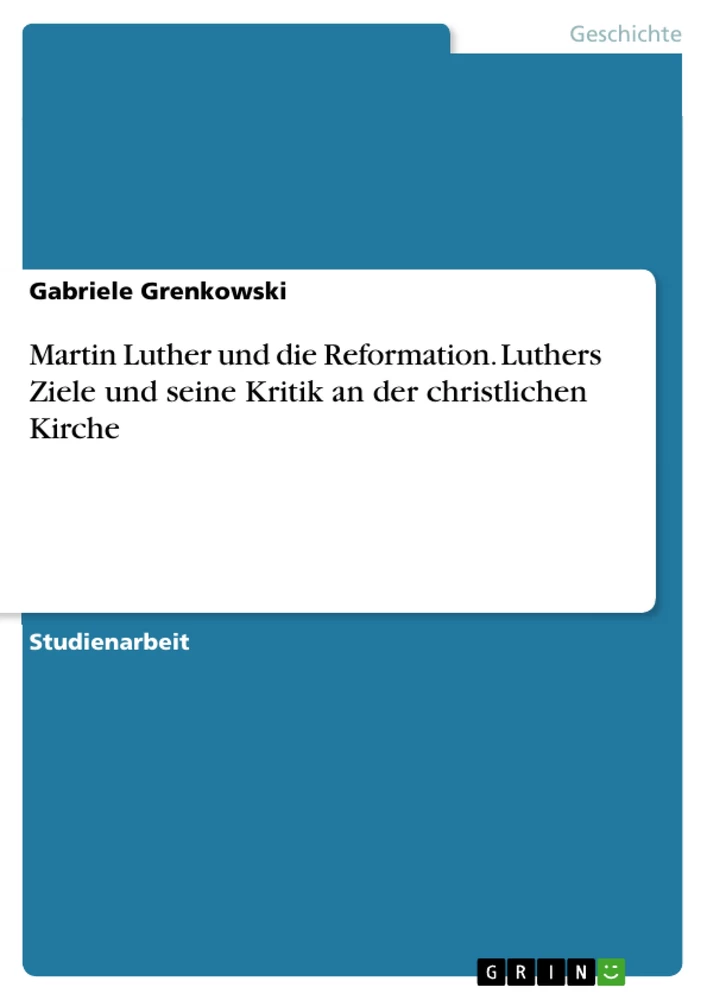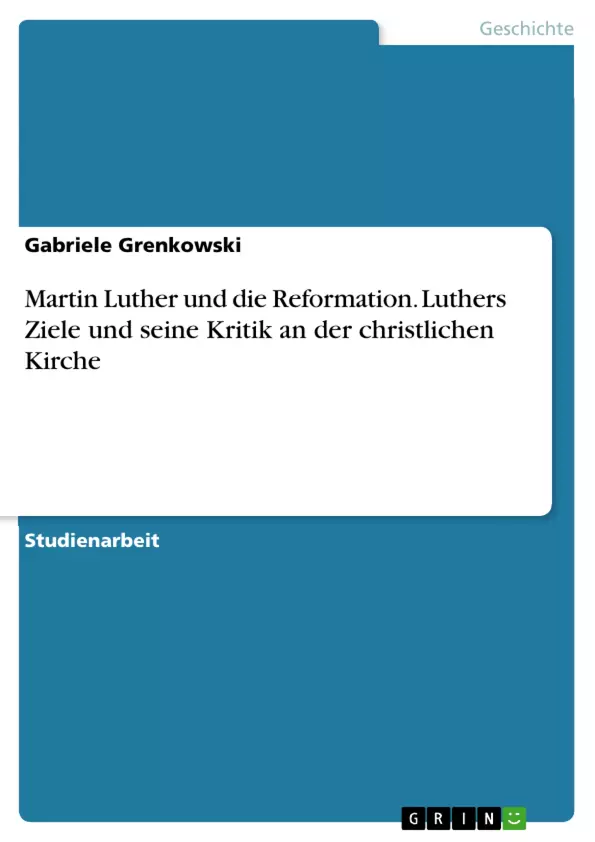Martin Luthers 95 Thesen sowie die Zeit der Reformation kann man wohl zu Recht als eines der bekanntesten Kapitel der deutschen Geschichte bezeichnen. Der vermeintliche „Thesenanschlag“ Luthers an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg ist heutzutage geradezu legendär – auch wenn das Ereignis selbst in der Forschung umstritten ist. Mit seinen Ansichten und seiner Bereitschaft, öffentlich zu diesen zu stehen, leitete Luther eine Phase der Reformation in Deutschland ein und wurde praktisch zum Begründer der protestantisch-christlichen Glaubensrichtung, aus der bis heute neben der evangelischen Kirche eine Reihe anderer Glaubensgemeinschaften hervorgegangen sind, welche heutzutage auf der ganzen Welt zu finden sind.
Doch wie nahm Luthers „Kampagne“ gegen die christliche Kirche im Allgemeinen sowie den Ablasshandel im Besonderen ihren Anfang? Welche Ziele verfolgte Luther ursprünglich mit der Veröffentlichung seiner 95 in Latein verfassten Thesen, sowie dem in Deutsch verfassten und veröffentlichten Sermon von Ablass und Gnade? Hatte Luther wirklich einen derartigen Umbruch, wie er schließlich stattfand, im Sinn und war er sich dessen bewusst, welchen Anklang seine Theologie finden würde? Diese Fragen soll diese Hausarbeit erörtern und möglichst beantworten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Literatur und Forschungsstand
- Luther als Mensch und Mönch
- Kindheit und Jugend
- Die Zeit im Kloster
- Die christliche Kirche und der Ablasshandel
- Was ist Ablass?
- Ablasspredigt
- Luthers Kritik an Kirche und Ablass
- Die Vorgeschichte zu Luthers Thesen und reformatorischem Wirken
- Die 95 Thesen
- Thesenanschlag – Ja oder Nein?
- Der Sermon von Ablass und Gnade
- An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung
- Fazit
- Literatur
- Quellen
- Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit Martin Luthers Kritik an der christlichen Kirche und dem Ablasshandel im Kontext der Reformation. Sie untersucht die Ziele, die Luther mit seiner Kritik verfolgte, und analysiert seine wichtigsten Schriften, darunter die 95 Thesen, den Sermon von Ablass und Gnade sowie "An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung".
- Luthers Leben und Wirken als Mönch
- Der Ablasshandel und seine Kritikpunkte
- Die 95 Thesen und ihre Bedeutung
- Luthers Sermon von Ablass und Gnade
- Die Ziele und Auswirkungen von Luthers Reformation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt den historischen Kontext der Reformation dar. Sie beleuchtet die Bedeutung von Luthers 95 Thesen und die Frage nach seinen ursprünglichen Zielen. Außerdem wird ein Überblick über die wichtigsten Quellen und den Forschungsstand gegeben.
Das zweite Kapitel widmet sich Martin Luther als Mensch und Mönch. Es beleuchtet seine Kindheit und Jugend sowie seine Zeit im Kloster. Dabei werden wichtige Stationen seines Lebens und die Einflüsse, die ihn prägten, dargestellt.
Das dritte Kapitel behandelt die christliche Kirche und den Ablasshandel. Es erklärt das Konzept des Ablasses und beleuchtet die Praxis der Ablasspredigten. Die Kritikpunkte Luthers an der Kirche und dem Ablasshandel werden hier ausführlich dargestellt.
Das vierte Kapitel analysiert Luthers Kritik an Kirche und Ablass. Es untersucht die Vorgeschichte zu seinen Thesen und seinem reformatorischen Wirken. Die 95 Thesen werden im Detail betrachtet, wobei auch die Frage nach dem Thesenanschlag behandelt wird. Außerdem wird Luthers Sermon von Ablass und Gnade sowie sein Werk "An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung" analysiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Martin Luther, Reformation, Ablasshandel, 95 Thesen, Sermon von Ablass und Gnade, "An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung", Kritik an der Kirche, Theologie, Geschichte, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Hauptgrund für Martin Luthers Kritik an der Kirche?
Luthers Kritik richtete sich primär gegen den Ablasshandel und die damit verbundene theologische Fehlentwicklung der christlichen Kirche.
Sind die 95 Thesen wirklich an die Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen worden?
Dies ist in der Forschung umstritten. Die Arbeit untersucht den "Thesenanschlag" als legendäres Ereignis im Vergleich zu den historischen Fakten.
Welche Ziele verfolgte Luther ursprünglich mit seinen Thesen?
Ursprünglich wollte Luther eine akademische Diskussion über den Ablass anregen und die Kirche reformieren, nicht jedoch eine Spaltung der Kirche herbeiführen.
Was ist der "Sermon von Ablass und Gnade"?
Dies ist eine von Luther in Deutsch verfasste Schrift, die seine Kritik am Ablasshandel für das einfache Volk verständlich zusammenfasste.
Welche Rolle spielte Luthers Zeit im Kloster für seine Theologie?
Die Zeit als Mönch prägte sein Ringen um einen gnädigen Gott und bildete das Fundament für seine spätere reformatorische Erkenntnis.
- Quote paper
- B.A. Gabriele Grenkowski (Author), 2014, Martin Luther und die Reformation. Luthers Ziele und seine Kritik an der christlichen Kirche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/287742