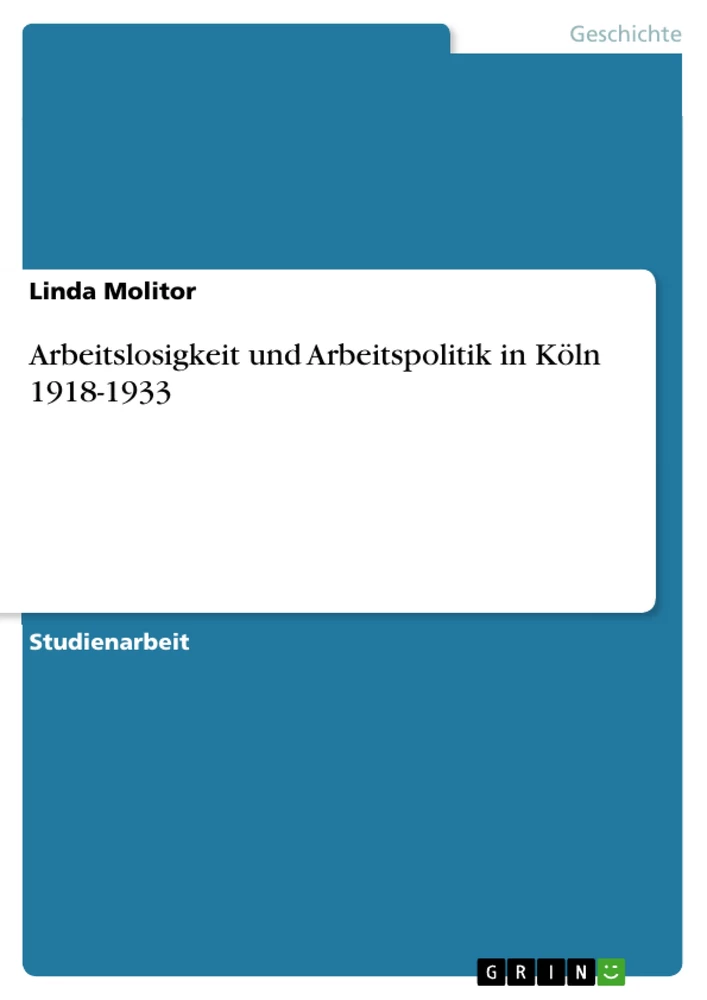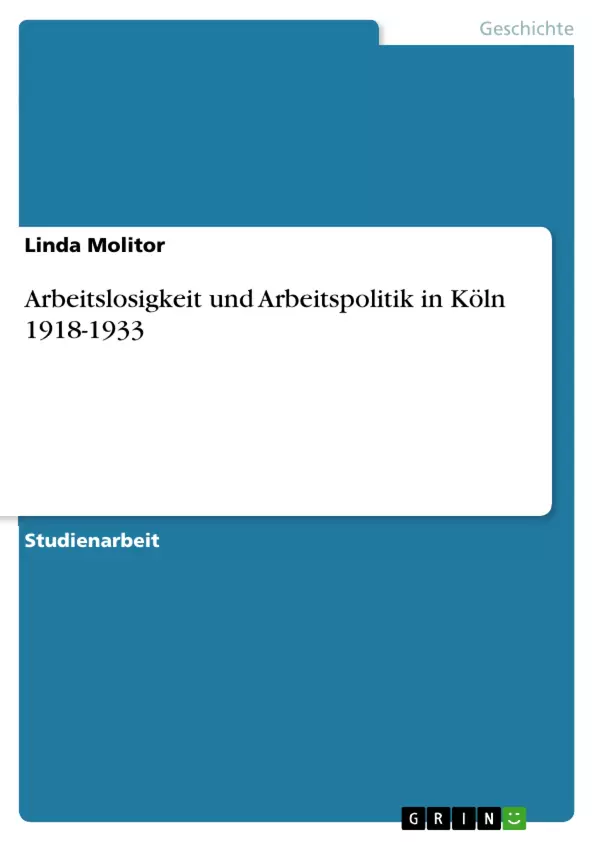Eine unausweichliche Folge der wirtschaftlichen Krise war die Arbeitslosigkeit, welche ihrerseits wiederum Folgen hatte. So stieg nicht nur die Anzahl der Arbeitslosen von 1929 bis 1930 von 2,8 auf 3,5 Millionen an, sondern auch die Zahl der NSDAP-Wähler. Bei den Reichstagswahlen am 14. September 1930 konnten die Nationalsozialisten einen Stimmenzuwachs von fast 16% verbuchen. In Zeiten der Not bauten immer weniger Deutsche auf die demokratische Regierung, ja, gaben ihr sogar die Schuld für ihr Elend und die wirtschaftliche Krisensituation. Je schlechter es den Deutschen ökonomisch ging, desto höher fielen die Wahlergebnisse der radikalen Parteien aus. Insofern ist die Betrachtung der sich entwickelnden und stetig steigenden Arbeitslosigkeit in der Weimarer Republik von großer Bedeutung, allerdings schwer zu erfassen. Einfacher und konkreter – und in mancher Hinsicht interessanter – ist es, diese Entwicklung an nur einer deutschen Stadt zu beobachten.
Hierzu bietet sich die Stadt Köln an – im Hochmittelalter die bevölkerungsreichste Stadt im Deutschen Reich, bedeutendes Handels- und Glaubenszentrum Westeuropas, bis ins 20. Jahrhundert die „stärkste Rheinfestung“ Preußens, im Ersten Weltkrieg „Versorgungszentrum der Westfront“. Nicht nur die geographisch günstige Lage am Rhein verhalf Köln in seiner Geschichte des Öfteren zu einer hervorgehobenen Stellung. Immer wieder ging man hier einen anderen, eigenen Weg, der von dem der Regierung abwich. Vor allem politisch betrachtet blieb die erzkatholische Stadt Köln auch in den wechselhaften Jahren der Weimarer Republik relativ stabil. Anders als bei der reichsweiten Betrachtung konnte die NSDAP hier er spät Stimmen gewinnen, bis 1933 ging traditionell Zentrumspartei als Wahlsieger aus den Kommunalwahlen hervor.
In diesem Zusammenhang ist vor allem Konrad Adenauer zu nennen, der Köln als Oberbürgermeister von 1917 bis ins Jahr der Machtergreifung durch viele Krisen führte. In den zwanziger Jahren „erscheint [er] […] als konservativer Modernisierer“. Vor allem des Kampfes gegen die Arbeitslosigkeit nahm er sich an. Für ihn, als sich selbst gegenüber sehr strengen und pflichtbewussten Menschen, heute würden wir ihn als Workaholic bezeichnen, war Arbeit nicht nur eine finanzielle Notwendigkeit, sondern eine „fundamentale Seinskategorie menschlicher Existenz“, unverzichtbar für den Erhalt menschlicher Moral.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Fragestellung
- Arbeitslosigkeit in Köln in der Weimarer Republik
- Arbeitslosenunterstützung und öffentliches Wohlfahrtswesen
- Die Erwerbslosenfürsorge
- Die Arbeitslosen- und Krisenunterstützung
- Wirtschaftspolitische Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit
- Notstandsarbeiten
- Arbeitspolitische Maßnahmen in Köln
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Köln während der Weimarer Republik. Sie untersucht die Ursachen und Folgen der Arbeitslosigkeit, die Rolle des öffentlichen Wohlfahrtswesens und die wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ergriffen wurden. Ein besonderer Fokus liegt auf der Person Konrad Adenauers, der als Oberbürgermeister von Köln in den zwanziger Jahren eine wichtige Rolle bei der Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen Krisen spielte.
- Die wirtschaftliche und soziale Lage in Köln nach dem Ersten Weltkrieg
- Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Köln
- Die Rolle des öffentlichen Wohlfahrtswesens und der Arbeitslosenversicherung
- Die wirtschaftspolitischen Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
- Der Einfluss von Konrad Adenauer auf die Kölner Arbeitsmarktpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und erläutert den historischen Kontext der Weimarer Republik. Sie beleuchtet die allgemeine wirtschaftliche, politische und soziale Lage in Köln nach dem Ersten Weltkrieg und die Herausforderungen, die sich aus der hohen Arbeitslosigkeit ergaben.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Köln während der Weimarer Republik. Es analysiert die Ursachen der Arbeitslosigkeit, wie z. B. die Folgen des Ersten Weltkriegs, die Inflation und die Weltwirtschaftskrise. Außerdem werden die Auswirkungen der Arbeitslosigkeit auf die Kölner Gesellschaft und die Reaktion der Stadtverwaltung dargestellt.
Das dritte Kapitel behandelt die Arbeitslosenunterstützung und das öffentliche Wohlfahrtswesen in Köln. Es beschreibt die verschiedenen Formen der Unterstützung für Arbeitslose, die Rolle der Erwerbslosenfürsorge und die Einführung der staatlichen Arbeitslosenversicherung im Jahr 1927.
Das vierte Kapitel widmet sich den wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ergriffen wurden. Es analysiert die Rolle der Notstandsarbeiten und die arbeitspolitischen Maßnahmen, die von der Stadt Köln unter der Leitung von Konrad Adenauer durchgeführt wurden.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Arbeitslosigkeit in Köln, die Weimarer Republik, Konrad Adenauer, das öffentliche Wohlfahrtswesen, die Arbeitslosenversicherung, die wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die Notstandsarbeiten und die Folgen der Arbeitslosigkeit für die Kölner Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Wie entwickelte sich die Arbeitslosigkeit in Köln zwischen 1918 und 1933?
Die Arbeitslosigkeit stieg infolge von Inflation und Weltwirtschaftskrise massiv an, was die soziale Not verschärfte und die politische Stabilität bedrohte.
Welche Rolle spielte Konrad Adenauer in dieser Zeit?
Als Oberbürgermeister von Köln (1917-1933) kämpfte Adenauer aktiv gegen die Arbeitslosigkeit, unter anderem durch die Initiierung von Notstandsarbeiten.
Was waren „Notstandsarbeiten“?
Dies waren öffentlich finanzierte Beschäftigungsprogramme, um Erwerbslose in Arbeit zu bringen und gleichzeitig die städtische Infrastruktur zu verbessern.
Warum blieb Köln politisch länger stabil als andere deutsche Städte?
Durch die starke Verwurzelung der katholischen Zentrumspartei konnte die NSDAP in Köln erst relativ spät nennenswerte Wahlerfolge erzielen.
Wann wurde die staatliche Arbeitslosenversicherung eingeführt?
Die reichsweite Arbeitslosenversicherung wurde im Jahr 1927 eingeführt, um die bis dahin oft unzureichende Erwerbslosenfürsorge abzulösen.
- Citation du texte
- Linda Molitor (Auteur), 2014, Arbeitslosigkeit und Arbeitspolitik in Köln 1918-1933, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/287798