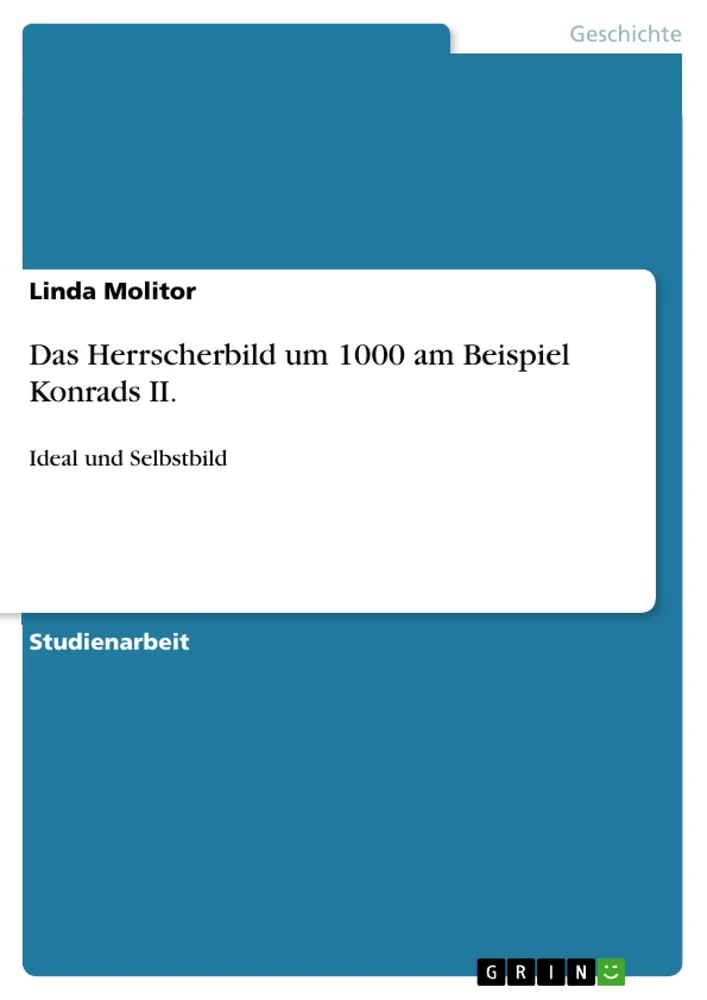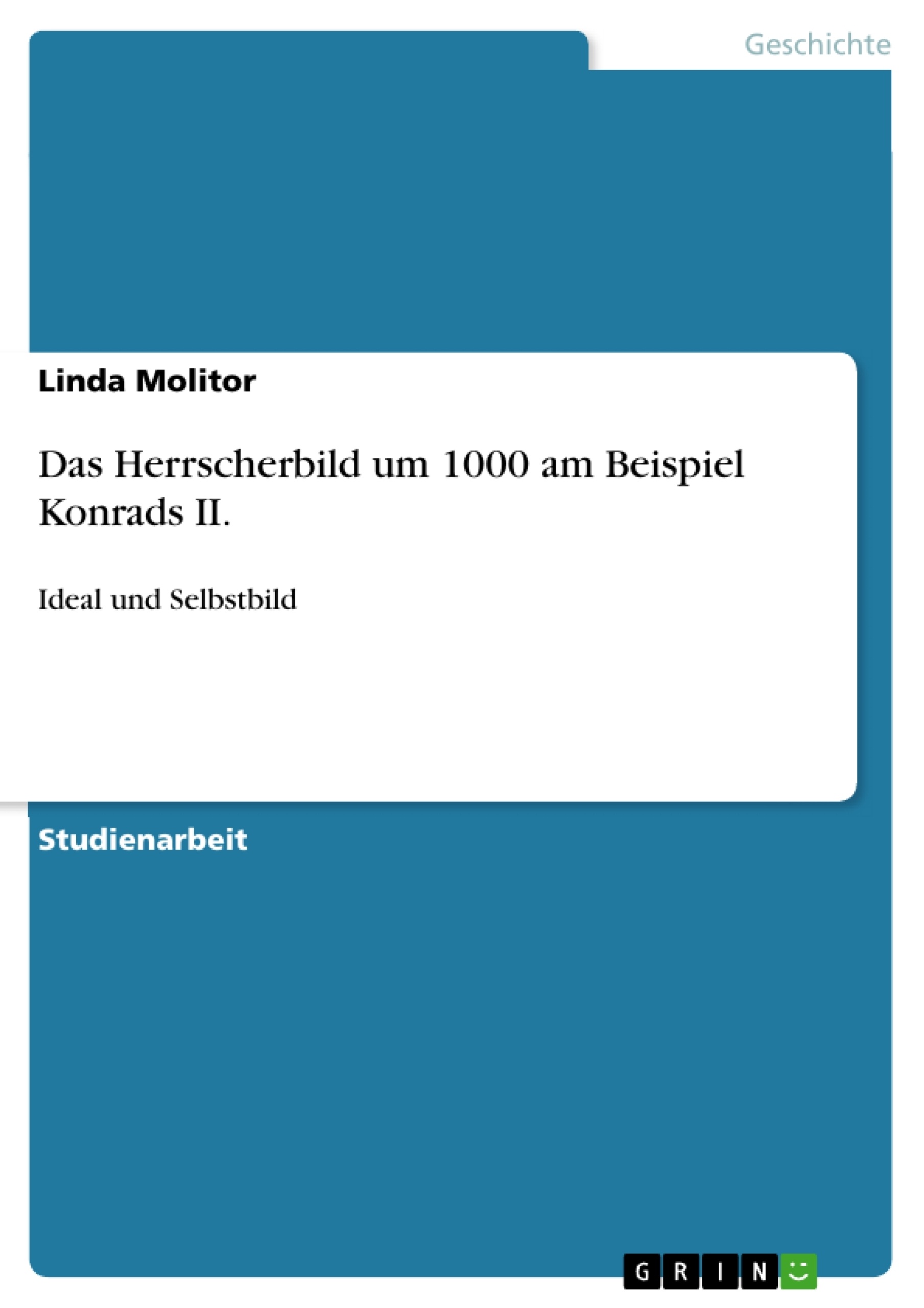Der Tod des kinderlosen Heinrichs II. im Jahre 1024 sollte eine große Veränderung für das Reich bedeuten – das Ende der Ottonen, der Dynastie des großen Herrschers Otto. Anstatt dieser kam eine neue Familie an die Macht, die das folgende Jahrhundert regieren sollte, geprägt von Krisen mit Fürsten und inländischen Oppositionen, vor allem jedoch durch den Investiturstreit und Streitigkeiten mit dem Papst. Der erste Herrscher dieser Dynastie, die wir heute Salier nennen, war Konrad II. Er erreichte während seiner Herrschaftszeit, seine Dynastie zu etablieren und seine Herrschaft zu legitimieren und legte damit den Grundstein für die Regierungen seiner Nachfahren.
In der folgenden Arbeit werde ich aufzeigen, wie Konrad II. dem Herrscherideal seiner Zeit gerecht wurde und wie er sich selbst als „Kaiser dreier Reiche“ sah. Daher wird die Hausarbeit von einer kurzen Biographie Konrads eingeleitet. Es folgt die Darstellung des Herrscherideals um 1000 und die des Selbstbilds Konrads als König und Kaiser.
Als besonders aufschlussreich erweist sich hier die Gesta Chuonradi imperatoris von Wipo, einem Kaplan Konrads. Diese verfasste er sieben Jahre nach Konrads Tod, unter der Regentschaft dessen Sohnes Heinrichs III., woraus man schließen kann, dass sie Negatives auslässt und vieles beschönigt. Die Gesta ist demnach dekonstruktivistisch zu betrachten, da ihr Autor als Mitglied des salischen Hofes einen tieferen Sinn hinter seinen historischen Beschreibungen vermitteln will. Dennoch gibt sie aufschlussreiches Wissen über die Taten Konrads II und die Ansichten dieser Zeit, speziell das Herrscherbild betreffend, preis. Die Gesta wird durchgehend nach der Übersetzung von Werner Trillmich zitiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung – Grundstein einer neuen Dynastie
- Biographie
- Konrad der Ältere - Aufstieg bis 1024
- König Konrad II.
- Kaiser Konrad II.
- Das Herrscherbild um 1000 am Beispiel Konrads II.
- Konrad II. - Ein idealer Herrscher?
- Herrscherliches Selbstverständnis
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Aufstieg Konrads II. zur Herrschaft und seine Rolle als Begründer der salischen Dynastie. Sie beleuchtet Konrads II. Bemühungen, seine Herrschaft zu legitimieren und sein Herrscherideal im Kontext des 11. Jahrhunderts. Die Arbeit analysiert die "Gesta Chuonradi imperatoris" von Wipo kritisch als Quelle.
- Der Aufstieg der Salier und die Ablösung der Ottonen
- Konrads II. Legitimation seiner Herrschaft
- Das Herrscherideal um das Jahr 1000
- Die Rolle der "Gesta Chuonradi imperatoris" als historische Quelle
- Konrads II. Selbstverständnis als Herrscher
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung – Grundstein einer neuen Dynastie: Die Einleitung beschreibt den historischen Kontext des Regierungswechsels von den Ottonen zu den Saliern im Jahr 1024 nach dem Tod Heinrichs II. Sie hebt die Bedeutung Konrads II. als Gründer der neuen Dynastie hervor und betont die Herausforderungen seiner Herrschaft, darunter Konflikte mit Fürsten und der Investiturstreit. Der Aufstieg der Salier aus der adligen Führungsschicht unter den Karolingern wird skizziert, mit Betonung der Bedeutung der Familie und ihres allmählichen Aufstiegs zur Macht. Die Einleitung führt den Leser in die Thematik ein und legt den Fokus auf Konrads II. Rolle beim Aufbau der salischen Dynastie.
Biographie: Konrad der Ältere - Aufstieg bis 1024: Dieses Kapitel beschreibt die frühen Jahre Konrads II., seinen schwierigen Aufstieg unter schwierigen familiären Umständen, seine Erziehung unter Bischof Burchard von Worms und seine strategisch wichtige Heirat mit Gisela von Schwaben. Es wird die anfängliche Zurücksetzung Konrads im Vergleich zu anderen Zweigen der Familie sowie die Spannungen mit Heinrich II. beleuchtet. Das Kapitel betont Konrads politisches Geschick und seine Vorbereitung auf eine mögliche Herrschaftsrolle, obwohl ein Aufstieg zur Königs würde zu dieser Zeit unwahrscheinlich erschien. Die Bedeutung der Ehe für den Ausbau seiner politischen Netzwerke und die Stärkung seines Ansehens wird hervorgehoben.
Biographie: König Konrad II.: Das Kapitel beschreibt die Königswahl Konrads II. im Jahr 1024 nach dem Tod Heinrichs II. Es analysiert die politische Situation, die Wahlprozedur, und die Rolle von Erzbischof Aribo von Mainz. Die Bedeutung der salisch-internen Einigung der beiden konkurrierenden Zweige der Familie wird detailliert dargestellt, sowie das Fehlen einer langen Thronvakanz. Das Kapitel hebt den geschickt inszenierten Charakter der Wahl hervor, der in der "Gesta Chuonradi" dokumentiert ist, und untersucht die Darstellung von Konrads Moral und seinen politisch geschickten Handlungen.
Schlüsselwörter
Salier, Konrad II., Ottonen, Herrscherideal, Legitimation, Gesta Chuonradi imperatoris, Wipo, Investiturstreit, Königswahl, Adel, Dynastie, Heinrich II., Gisela von Schwaben.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Aufstieg Konrads II. und die Salier"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Aufstieg Konrads II. zur Herrschaft und seine Rolle als Begründer der salischen Dynastie. Sie beleuchtet seine Bemühungen, seine Herrschaft zu legitimieren, und sein Herrscherideal im Kontext des 11. Jahrhunderts. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der kritischen Analyse der "Gesta Chuonradi imperatoris" von Wipo als Quelle.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Aufstieg der Salier und die Ablösung der Ottonen, Konrads II. Legitimation seiner Herrschaft, das Herrscherideal um das Jahr 1000, die Rolle der "Gesta Chuonradi imperatoris" als historische Quelle und Konrads II. Selbstverständnis als Herrscher.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, eine Biographie Konrads II. (unterteilt in "Konrad der Ältere - Aufstieg bis 1024", "König Konrad II." und "Kaiser Konrad II."), ein Kapitel zum Herrscherbild um 1000 am Beispiel Konrads II. und ein Fazit.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung beschreibt den historischen Kontext des Regierungswechsels von den Ottonen zu den Saliern, hebt die Bedeutung Konrads II. als Dynastiegründer hervor und betont die Herausforderungen seiner Herrschaft (Konflikte mit Fürsten, Investiturstreit). Der Aufstieg der Salier aus der adligen Führungsschicht wird skizziert.
Worum geht es im Kapitel zur Biographie Konrads II.?
Dieses Kapitel (unterteilt in drei Teile) beschreibt Konrads frühe Jahre, seinen Aufstieg, seine strategisch wichtige Heirat mit Gisela von Schwaben, seine Königswahl 1024 und die Analyse der politischen Situation und Wahlprozedur. Es beleuchtet auch die salisch-interne Einigung und die Darstellung Konrads in der "Gesta Chuonradi".
Was ist der Fokus des Kapitels zum Herrscherbild um 1000?
Dieses Kapitel analysiert Konrads II. Bemühungen, seine Herrschaft zu legitimieren, und untersucht sein Herrscherideal im Kontext des 11. Jahrhunderts.
Welche Rolle spielt die "Gesta Chuonradi imperatoris"?
Die "Gesta Chuonradi imperatoris" von Wipo wird als wichtige historische Quelle kritisch analysiert und ihre Darstellung von Konrads Moral und politischen Handlungen untersucht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Salier, Konrad II., Ottonen, Herrscherideal, Legitimation, Gesta Chuonradi imperatoris, Wipo, Investiturstreit, Königswahl, Adel, Dynastie, Heinrich II., Gisela von Schwaben.
- Quote paper
- Linda Molitor (Author), 2013, Das Herrscherbild um 1000 am Beispiel Konrads II., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/287803