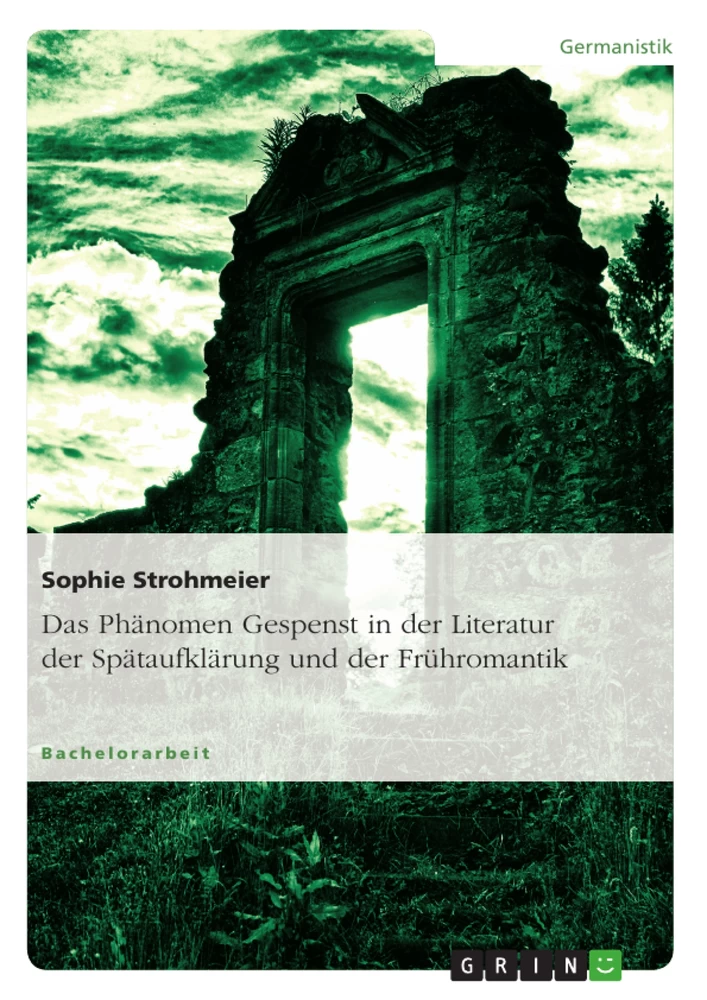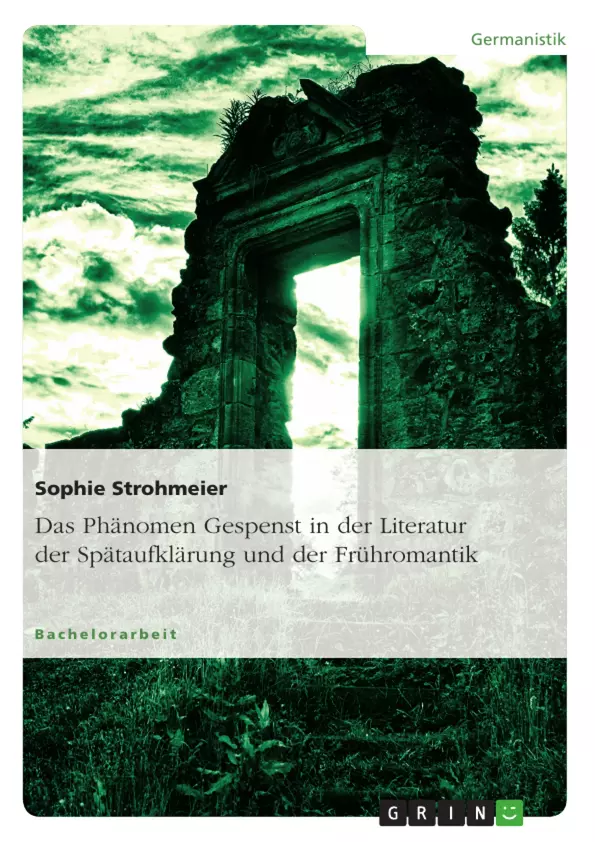Das Gespenst ist ein Phänomen, das den Menschen zu allen Zeiten sowohl inner- als auch außerliterarisch beschäftigt hat und noch immer beschäftigt. Wichtige Aspekte dieser Beschäftigung mit dem Phänomen Gespenst liefern in vielerlei Hinsicht nicht nur die Für- oder Widersprecher seiner Existenz in der Realität, sondern auch die verschiedenen Ausprägungen dieses Diskurses in der Literatur. Der Stellenwert des Übersinnlichen im Leben der Menschen, die Gründe dafür und die Perspektiven darauf finden sich zu jeder Epoche in der Literatur seiner Zeit gespiegelt. Um ein literarisches Phänomen wie das Gespenst zu untersuchen, muss also auch immer die Wechselwirkung zwischen Fiktion und Wirklichkeit betrachtet werden. Auch wenn der Glaube, beziehungsweise Aberglaube an Gespenster sich in allen Epochen und Kulturen beobachten lässt, kann man unzweifelhaft feststellen, dass es immer wieder Zeiten gab, in denen der Diskurs des Gespenstes eine gewisse „Hochkonjunktur“ hatte.
Warum dies gerade auf die Zeit der Spätaufklärung und der Frühromantik, die hier ungefähr auf 1790- 1820 datiert wird, zutrifft und wie diese beiden auf den ersten Blick so verschiedenen Strömungen mit dem Gespenst in Realität und Literatur umgehen, soll in dieser Arbeit an einigen Schlaglichtern gezeigt werden. Während sich auch im zu untersuchenden Zeitraum am Thema der realen Existenz von Gespenstern sprichwörtlich die Geister scheiden, erfahren sie als literarisches Sujet eine weitaus subtilere Behandlung. Seit Ende des 18. Jahrhunderts kann man von einer Etablierung der Aufklärung im Leben der Menschen sprechen und damit sollte eigentlich auch die Auslöschung jeglichen Glaubens an das Übersinnliche einhergehen. Trotzdem erfährt gerade in dieser Zeit der Schauerroman oder im englischen der weitaus besser untersuchte „gothic novel“ in allen Schichten der Gesellschaft eine Popularität, die nicht unbedingt den Glauben als vielmehr ein gesteigertes Interesse am Übersinnlichen zu bestätigen scheint. Gleichzeitig ist die literarische Strömung der Frühromantik im Entstehen begriffen, die eine neue, den Idealen der Aufklärung entgegengesetzte Sicht auf Welt und Poesie verbreitet.
Inhaltsverzeichnis
- Interesse an dem Phänomen Gespenst in Literatur und Realität
- Was ist ein Gespenst
- Allgemeine Merkmale
- Literarische Funktionen
- Die Gespenstergeschichte um 1800
- Gattungsentwicklung
- Die Gespenstergeschichte in der Spätaufklärung
- Die Gespenstergeschichte in der Frühromantik
- Geisterseher und ihre Meinungen über das Gespenst
- Friedrich Nicolai: „Beispiel einer Erscheinung mehrerer Phantasmen“
- Ludwig Tieck
- Johann Heinrich Jung: „Theorie der Geister-Kunde“
- „Das Gespensterbuch“
- Entstehung und Inhalt des Gespensterbuches
- ,,Der Geist des Verstorbenen“
- ,,Die Totenbraut“
- Ergebnisse der Textuntersuchungen
- Die Entwicklung des Gespenstes hin zum 21.Jahrhundert
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit dem Phänomen Gespenst in der Literatur der Spätaufklärung und der Frühromantik. Ziel ist es, die Entwicklung der Gespenstergeschichte in dieser Zeit zu untersuchen und die Rolle des Gespenstes als literarisches Sujet zu analysieren. Dabei werden die Wechselwirkungen zwischen Fiktion und Wirklichkeit sowie die unterschiedlichen Perspektiven auf das Gespenst in beiden Epochen beleuchtet.
- Die Entwicklung der Gespenstergeschichte in der Spätaufklärung und der Frühromantik
- Die literarischen Funktionen des Gespenstes
- Die Rolle des Gespenstes als Medium der Diskurse von Aufklärung und Romantik
- Die fiktionsexternen Faktoren, die das Interesse für das Gespenst in der Zeit um 1800 geweckt haben
- Die Bedeutung des Gespenstes für die Entwicklung der Literatur des 19. Jahrhunderts
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet das Interesse an dem Phänomen Gespenst in Literatur und Realität. Es wird die Bedeutung des Übersinnlichen im Leben der Menschen und die verschiedenen Ausprägungen des Diskurses in der Literatur betrachtet. Das zweite Kapitel definiert den Begriff Gespenst und analysiert seine allgemeinen Merkmale, insbesondere seine Verbindung mit dem Tod und seine Grenzüberschreitung zwischen Körperlichkeit und Unsichtbarkeit. Das dritte Kapitel untersucht die Entwicklung der Gespenstergeschichte um 1800, wobei die Gattungsentwicklung, die Gespenstergeschichte in der Spätaufklärung und die Gespenstergeschichte in der Frühromantik betrachtet werden. Das vierte Kapitel stellt Geisterseher und ihre Meinungen über das Gespenst vor, wobei die Ansichten von Friedrich Nicolai, Ludwig Tieck und Johann Heinrich Jung beleuchtet werden. Das fünfte Kapitel analysiert das „Gespensterbuch“ und seine Entstehung, sowie die beiden Geschichten „Der Geist des Verstorbenen“ und „Die Totenbraut“. Das sechste Kapitel fasst die Ergebnisse der Textuntersuchungen zusammen. Das siebte Kapitel betrachtet die Entwicklung des Gespenstes hin zum 21. Jahrhundert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Phänomen Gespenst, die Spätaufklärung, die Frühromantik, die Gespenstergeschichte, die literarische Funktion des Gespenstes, die Wechselwirkung zwischen Fiktion und Wirklichkeit, das Übersinnliche, der Tod, die Grenzüberschreitung, die Geisterseher, das „Gespensterbuch“, die Entwicklung des Gespenstes.
Häufig gestellte Fragen
Warum waren Gespenstergeschichten um 1800 so populär?
Trotz der Aufklärung gab es ein gesteigertes Interesse am Übersinnlichen, das sich im Schauerroman und in der aufkommenden Romantik als Gegenbewegung zur reinen Vernunft widerspiegelte.
Was unterscheidet das Gespenst der Aufklärung von dem der Romantik?
In der Spätaufklärung dienten Gespenster oft der moralischen Belehrung oder wurden rational erklärt, während die Romantik das Geheimnisvolle und die Grenzüberschreitung betonte.
Was ist das "Gespensterbuch"?
Es ist eine berühmte Sammlung von Erzählungen (z. B. "Die Totenbraut"), die den damaligen Zeitgeist prägte und als Sujet für viele literarische Werke diente.
Wer waren bekannte "Geisterseher" dieser Zeit?
Die Arbeit erwähnt Friedrich Nicolai, der Phänomene rational untersuchte, sowie Johann Heinrich Jung-Stilling mit seiner "Theorie der Geister-Kunde".
Welche literarische Funktion hat ein Gespenst?
Gespenster dienen als Medium, um über Tod, Schuld, das Unbewusste und die Grenzen der menschlichen Erkenntnis zu reflektieren.
- Citar trabajo
- Sophie Strohmeier (Autor), 2014, Das Phänomen Gespenst in der Literatur der Spätaufklärung und der Frühromantik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/287834