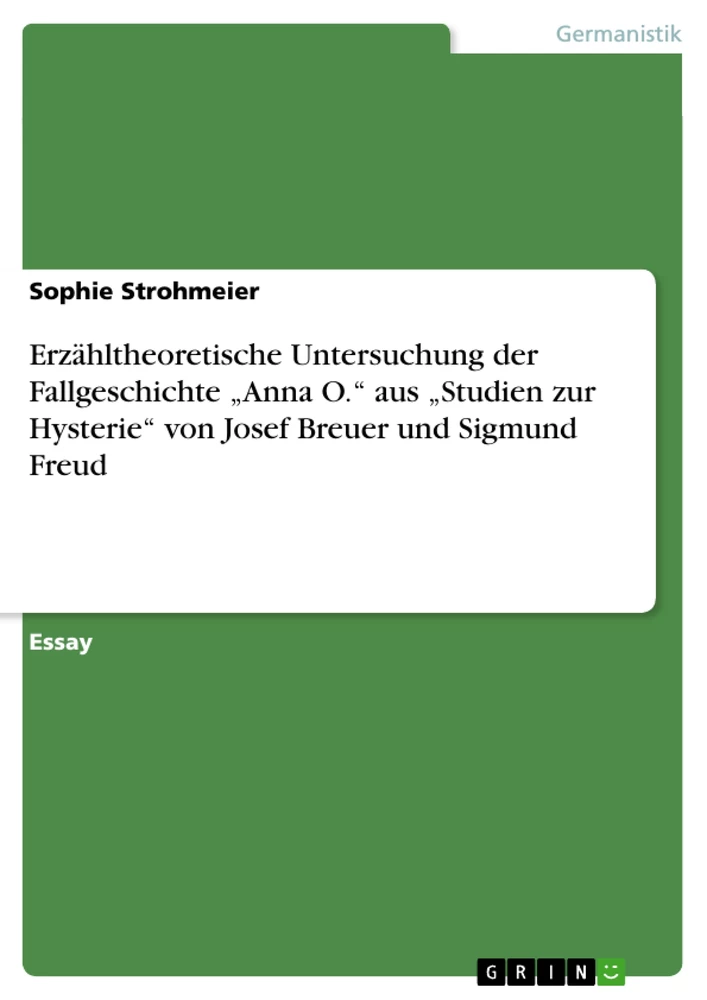Die Fallgeschichte „Anna O.“ erschien 1895 im Gemeinschaftswerk „Studien über Hysterie“ von Josef Breuer und Sigmund Freud. Breuer hatte Bertha Pappenheimer alias Anna O. von Juli 1880 bis zum Juni 1882 behandelt. Die Krankengeschichte gilt als Grundsteinlegung für die Psychoanalyse. Der Text gliedert sich in sechs Teile. Der Erste ist eine Art Einleitung, der Anna O. als Hauptfigur gewissermaßen einführt . Die nächsten vier Teile hat Breuer selbst vorgezeichnet . Wie er jedoch selbst schreibt, hält er die Reihenfolge der Gliederung nicht ganz ein, er hat sie auch für den Krankheits- nicht für den Textverlauf geschrieben, sodass man den Teil A zwischen Teil B und Teil C einordnen müsste.
Außerdem sind Breuers Gliederung noch einige ergänzende Punkte hinzuzufügen: Im zweiten Teil wird außer Anna O.s Zustand bei Beginn der Behandlung und ihren ersten Symptomen die anfängliche Behandlung ihres Zustands durch Erzählen der Phantasien angedeutet . Daraufhin wird im dritten Teil, während Anna Os Behandlung auf dem Land und ihrer Rückkehr in die Stadt, vor allem die Besserung ihres Zustands durch die Talking Cure beschrieben. Im letzten Teil des von Breuer gegliederten Krankheitsverlaufs erläutert er detailliert das Verschwinden der Symptome durch Erzählen des traumatischen Ereignisses.
Inhaltsverzeichnis
- Die Fallgeschichte „Anna O.“
- Erzähltheoretische Untersuchung der Fallgeschichte
- Der Unterschied zwischen erzählter Zeit und Erzählzeit
- Breuers Doppelrolle als Erzähler und Figur
- Inhaltliche und formale Besonderheiten
- Erzählstrategien Breuers
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Fallgeschichte „Anna O.“ von Breuer und Freud aus erzähltheoretischer Perspektive. Ziel ist es, die narrative Struktur des Textes zu analysieren und die Rolle des Erzählers Breuer zu beleuchten. Dabei werden die Besonderheiten der Zeitgestaltung, Fokalisierung und die Position des Erzählers im Verhältnis zur Handlung untersucht.
- Narrative Struktur der Fallgeschichte „Anna O.“
- Rolle des Erzählers Josef Breuer
- Zeitgestaltung und Erzähltempo
- Fokalisierung und Perspektive
- Erzählstrategien und ihre Funktion
Zusammenfassung der Kapitel
Die Fallgeschichte „Anna O.“: Diese Einleitung präsentiert die Fallgeschichte „Anna O.“ aus „Studien über Hysterie“ von Breuer und Freud als Ausgangspunkt der erzähltheoretischen Analyse. Sie beschreibt die grundlegende Struktur des Textes in sechs Teile, wobei die nicht strikt chronologische Anordnung und die Rolle Breuers als Arzt und Erzähler hervorgehoben werden. Die Einleitung deutet bereits auf die zentralen Themen der Analyse hin: Zeitstruktur, Erzählperspektive und die Funktion der Erzählstrategien.
Erzähltheoretische Untersuchung der Fallgeschichte: Dieses Kapitel analysiert die Erzählzeit und die erzählte Zeit in der Fallgeschichte „Anna O.“. Es wird der Unterschied zwischen der langen erzählten Zeit (über Jahre) und der kurzen Erzählzeit (ungefähr eine Stunde) herausgestellt. Die Analyse konzentriert sich auf die Verwendung von Analepsen und Prolepsen, die die chronologische Abfolge unterbrechen und Spannung erzeugen. Die Raffungen der Erzählung bei der Beschreibung von Verbesserungen oder Verschlechterungen des Zustands von Anna O. werden ebenfalls beleuchtet.
Der Unterschied zwischen erzählter Zeit und Erzählzeit: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage der Distanz des Erzählers zum Geschehen. Aufgrund der geringen Anzahl an Dialogen und der Präsenz Breuers als Erzähler wird die narrative Mittelbarkeit des Textes festgestellt. Breuers Rolle als Arzt und Erzähler wird genauer betrachtet, wobei seine Perspektivübernahme und die daraus resultierende Mitsicht betont wird. Die Analyse fokussiert sich auf die narrative Distanz und die unterschiedlichen Erzählweisen Breuers.
Breuers Doppelrolle als Erzähler und Figur: Dieses Kapitel analysiert die Fokalisierung des Textes und zeigt Breuers Doppelrolle als Erzähler und Figur auf. Der Text wird als null-fokalisiert beschrieben, da Breuer die Informationen kontrolliert, die dem Leser zugänglich sind. Die Charakterisierung Anna O.s wird als Beispiel für eine null-fokalisierte Erzählung interpretiert. Die nicht-chronologische Anordnung der Ereignisse und Breuers persönliche Stellungnahmen werden als Ausdruck seiner Mitsicht interpretiert. Die Analyse beschäftigt sich auch mit der Frage, inwiefern Breuers homodiegetische und heterodiegetische Stellung als Erzähler zusammenhängen.
Inhaltliche und formale Besonderheiten: Dieser Abschnitt untersucht inhaltliche und formale Besonderheiten der Fallgeschichte. Die Analyse konzentriert sich auf die beabsichtigte Leserschaft (Fachleute) und den dennoch vorhandenen Versuch, Spannung aufzubauen durch den Einsatz von Prolepsen und Analepsen, sowie persönliche Kommentare Breuers. Die Verwendung von Kursivschrift zur Hervorhebung wichtiger Stellen wird ebenfalls diskutiert. Die Frage nach dem Zweck des Spannungsaufbaus in einem fachwissenschaftlichen Text wird gestellt und im Zusammenhang mit der Etablierung der Psychoanalyse als Wissenschaft diskutiert.
Erzählstrategien Breuers: Das Kapitel befasst sich mit Breuers Erzählstrategien, insbesondere mit der selektiven Darstellung von Symptomen und Traumata. Die Unvollständigkeit der Beschreibungen und Breuers explizite Hinweise darauf werden analysiert. Es wird diskutiert, dass diese Strategie als Vorwegnahme möglicher Kritik an der Behandlung Anna O.s und der Psychoanalyse im Allgemeinen interpretiert werden kann. Der Einfluss der nachträglichen Veröffentlichung der Fallgeschichte und der Kontextualisierung durch Freuds psychoanalytische Theorie wird ebenfalls berücksichtigt.
Schlüsselwörter
Anna O., Fallgeschichte, Studien über Hysterie, Josef Breuer, Sigmund Freud, Erzähltheorie, Fokalisierung, Erzählzeit, erzählte Zeit, Analepse, Prolepse, Psychoanalyse, Erzählerrolle, narrative Mittelbarkeit, homodiegetisch, heterodiegetisch, extradiegetisch, intradiegetisch, Spannungsaufbau, Erzählstrategien.
Häufig gestellte Fragen zu "Erzähltheoretische Analyse der Fallgeschichte 'Anna O.'"
Was ist der Gegenstand der Analyse?
Die Arbeit analysiert die Fallgeschichte "Anna O." von Breuer und Freud aus erzähltheoretischer Perspektive. Der Fokus liegt auf der narrativen Struktur, der Rolle des Erzählers Breuer und den Besonderheiten der Zeitgestaltung, Fokalisierung und der Position des Erzählers im Verhältnis zur Handlung.
Welche Aspekte der Erzähltheorie werden untersucht?
Die Analyse umfasst die Untersuchung der erzählten Zeit im Vergleich zur Erzählzeit, den Einsatz von Analepsen und Prolepsen, die Fokalisierung (insbesondere die null-fokalisierte Erzählung), die narrative Distanz, Breuers Doppelrolle als Erzähler und Figur (homodiegetisch und heterodiegetisch), sowie seine Erzählstrategien und deren Funktion im Kontext der Falldarstellung.
Wie ist die narrative Struktur der Fallgeschichte "Anna O."?
Die Fallgeschichte ist nicht strikt chronologisch aufgebaut. Breuer verwendet Analepsen und Prolepsen, um die chronologische Abfolge zu unterbrechen und Spannung zu erzeugen. Die Erzählzeit ist deutlich kürzer als die erzählte Zeit (Jahre vs. etwa eine Stunde). Es gibt wenige Dialoge, was die narrative Mittelbarkeit und die Präsenz Breuers als Erzähler verstärkt.
Welche Rolle spielt Josef Breuer in der Erzählung?
Breuer fungiert als Erzähler und gleichzeitig als Figur innerhalb der Geschichte. Seine Perspektive prägt die Erzählung stark. Die Analyse untersucht, wie seine Doppelrolle die Erzählung beeinflusst und wie seine persönlichen Stellungnahmen und die Auswahl der dargestellten Informationen die Interpretation der Fallgeschichte formen.
Welche Erzählstrategien verwendet Breuer?
Breuer verwendet selektive Darstellung von Symptomen und Traumata, unvollständige Beschreibungen und explizite Hinweise auf diese Unvollständigkeit. Diese Strategien werden im Kontext der beabsichtigten Leserschaft (Fachleute) und möglicher Kritik an der Behandlung und der Psychoanalyse interpretiert.
Welche inhaltlichen und formalen Besonderheiten werden analysiert?
Die Analyse berücksichtigt die beabsichtigte Leserschaft (Fachleute), den Spannungsaufbau trotz des fachwissenschaftlichen Kontextes (durch Prolepsen und Analepsen), die Verwendung von Kursivschrift und die Frage nach dem Zweck des Spannungsaufbaus in einem solchen Text.
Wie wird die Zeitgestaltung in der Fallgeschichte analysiert?
Die Analyse beleuchtet den Unterschied zwischen der langen erzählten Zeit (über Jahre) und der kurzen Erzählzeit (ungefähr eine Stunde). Die Verwendung von Raffungen bei der Beschreibung von Verbesserungen oder Verschlechterungen des Zustands von Anna O. wird ebenso betrachtet wie der Einfluss der nicht-chronologischen Anordnung auf das Verständnis des Geschehens.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Anna O., Fallgeschichte, Studien über Hysterie, Josef Breuer, Sigmund Freud, Erzähltheorie, Fokalisierung, Erzählzeit, erzählte Zeit, Analepse, Prolepse, Psychoanalyse, Erzählerrolle, narrative Mittelbarkeit, homodiegetisch, heterodiegetisch, extradiegetisch, intradiegetisch, Spannungsaufbau, Erzählstrategien.
Welches ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die narrative Struktur der Fallgeschichte "Anna O." zu analysieren und die Rolle des Erzählers Breuer zu beleuchten. Es geht um die Untersuchung der Zeitgestaltung, Fokalisierung und der Position des Erzählers im Verhältnis zur Handlung.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel, die sich mit der Fallgeschichte "Anna O.", einer erzähltheoretischen Untersuchung, dem Unterschied zwischen erzählter und Erzählzeit, Breuers Doppelrolle, inhaltlichen und formalen Besonderheiten und schließlich Breuers Erzählstrategien befassen. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind enthalten.
- Arbeit zitieren
- Sophie Strohmeier (Autor:in), 2012, Erzähltheoretische Untersuchung der Fallgeschichte „Anna O.“ aus „Studien zur Hysterie“ von Josef Breuer und Sigmund Freud, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/287843