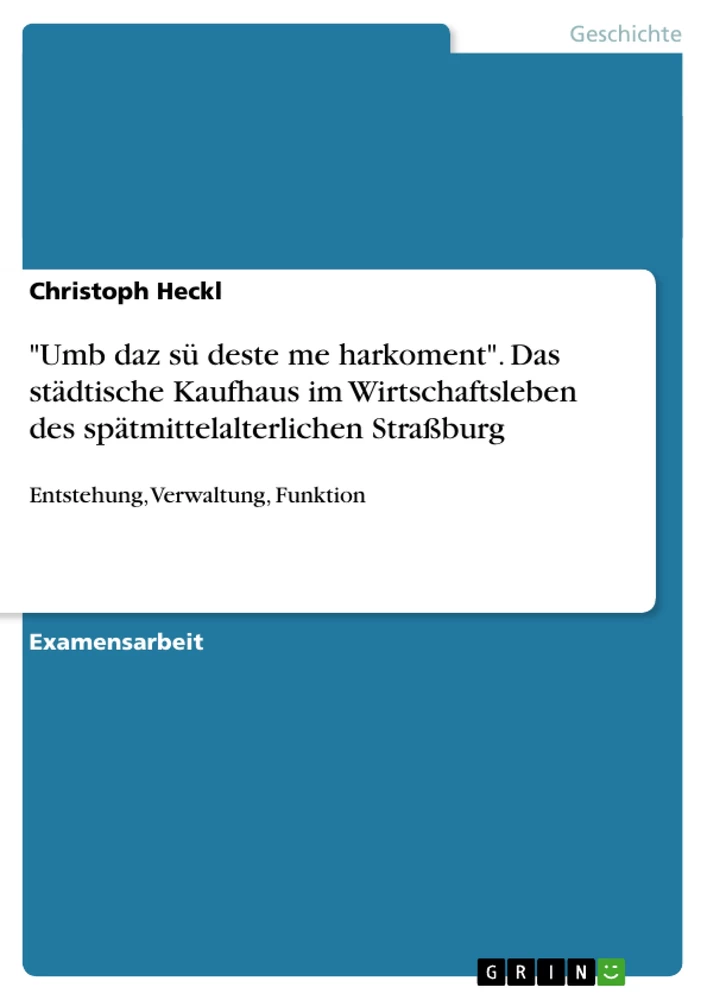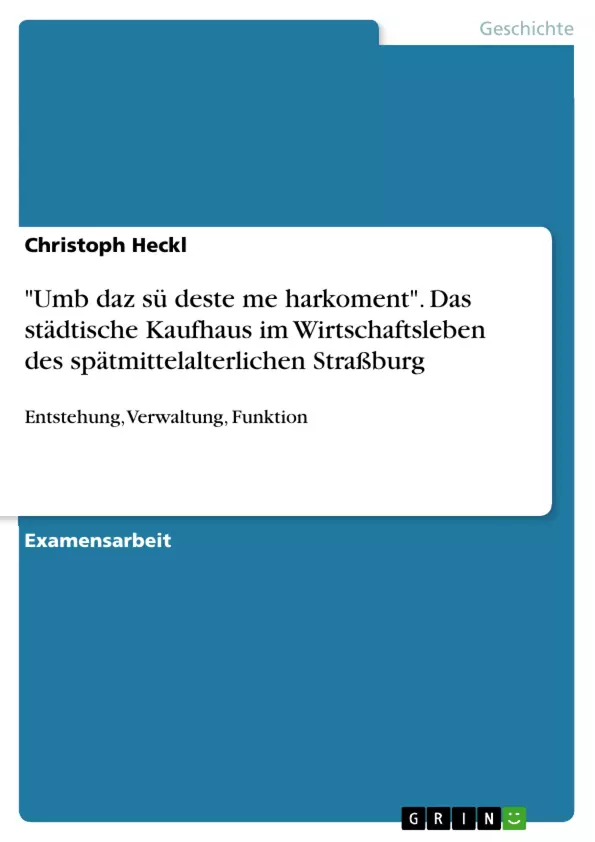Die Einrichtung von städtischen Kaufhäusern wurde in der Forschung als die „wichtigste wirtschaftstopographische Veränderung“ der mittelalterlichen Stadt bezeichnet. Auch in Straßburg markiert die Errichtung des Kaufhauses im Jahr 1358 einen zentralen Einschnitt. Die vorliegende Arbeit stellt einen Versuch dar, die konkrete Bedeutung herauszuarbeiten, die dem Kaufhaus im Gefüge der Straßburger Wirtschaft im Spätmittelalter zukam. Eine Hauptursache der Entstehung von Kaufhäusern – die im ersten Kapitel beschrieben wird – war die Ausweitung des Fernhandels im späten Mittelalter. An diese die wichtigsten Faktoren zusammenfassenden Präliminarien schließt sich ein Überblick über den Handel Straßburgs im Spätmittelalter an. Der folgende Hauptteil der Arbeit spürt zunächst – anhand der wenigen vorhandenen Quellen – der Entstehung des Straßburger Kaufhauses im 14. Jahrhundert nach, um dann seine Baugestalt sowie seine sukzessiven Erweiterungen darzustellen.
Daran anschließend wird in Kapiteln zum Kaufhauspersonal und seinen Aufgaben sowie der Kontrolle durch das Stadtregiment die Verwaltung des Kaufhauses erläutert. Vor diesem Hintergrund rekonstruieren die nächsten Kapitel anhand der verschiedenen überlieferten Zolllisten die unterschiedlichen Handelsabgaben und das Warenangebot. Da mehrere Zolllisten aus dem 15. Jahrhundert vorliegen, lassen sich auch Rückschlüsse auf die Entwicklung des Warensortiments ziehen.
Der Organisation des Handels mit diesen Waren im Kaufhaus widmet sich das folgende Kapitel. Dabei stellt sich als zentrale Frage, ob es in Straßburg einen Kaufhaus- und/oder einen Feilbietungszwang gegeben hat, und weiterhin, inwiefern das Kaufhaus und sein Personal Kontrollaufgaben bei der Erhebung der städtischen Handelsabgaben ausübten. Die Erörterung der Funktion, die dem Kaufhaus in der Messezeit zukam, schließt diesen Teil der Arbeit ab.
In einem letzten Kapitel wird auf Grundlage der Reglementierungen des Kaufhaushandels der Versuch unternommen, Tendenzen in der Handelspolitik der Stadt aufzuzeigen. Von besonderem Interesse ist dabei die Frage, ob sich diese eher handelsförderlich oder eher handelshemmend gestaltete. Die Beantwortung dieser Frage versteht sich als Beitrag, dem Kaufhaus im Gefüge der Straßburger Wirtschaft einen gebührenden Platz zuzuweisen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand
- Quellen
- Entstehung und Funktion von Kaufhäusern
- Straßburg als Handelsstadt im Spätmittelalter
- Das Straßburger Kaufhaus
- Errichtung
- Baugestalt
- Ursprungsbau und Erweiterung
- Einrichtung
- Das Kaufhauspersonal und seine Aufgaben
- Hausmeister und Schreiber
- Unterkäufer
- Knechte
- Aufsicht und Kontrolle
- Der Kaufhaushandel und seine Organisation
- Öffnungszeiten
- Handelsabgaben
- Warensortiment
- Kaufhauszwang
- Stapelrecht und Verkaufszwang
- Handelskontrolle
- Kaufhaushandel in der Messe
- Die Reglementierung des Handels im Kaufhaus als Ausdruck der Handelspolitik des Straßburger Rates
- Handelsförderliche oder -hemmende Zollpolitik?
- Der handelspolitische Reflexionshorizont des Rates
- Schluss
- Literatur- und Quellenverzeichnis
- Quellen
- Literatur
- Anhang
- Quellen
- Straßburger Messeordnung (1415)
- Extract aus einer alten Meẞ Ordnung
- Bildmaterial
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Bedeutung des Straßburger Kaufhauses im Spätmittelalter. Sie untersucht die Entstehung des Kaufhauses, seine Baugestalt, die Organisation des Handels und die Reglementierung des Kaufhaushandels als Ausdruck der Handelspolitik des Straßburger Rates. Die Arbeit zielt darauf ab, die konkrete Bedeutung des Kaufhauses im Gefüge der Straßburger Wirtschaft herauszuarbeiten.
- Entstehung und Entwicklung des Straßburger Kaufhauses
- Organisation des Handels im Kaufhaus
- Reglementierung des Kaufhaushandels
- Handelspolitik des Straßburger Rates
- Bedeutung des Kaufhauses für die Straßburger Wirtschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Forschungsstand zur Geschichte von Kaufhäusern im Spätmittelalter dar und gibt einen Überblick über die Quellenlage. Sie erläutert die Entstehung von Kaufhäusern als Folge der Ausweitung des Fernhandels und beschreibt die Bedeutung des Straßburger Kaufhauses im Kontext der städtischen Wirtschaft.
Das zweite Kapitel widmet sich der Entstehung des Straßburger Kaufhauses im 14. Jahrhundert. Es beleuchtet die Baugestalt des Kaufhauses, seine sukzessiven Erweiterungen und die Einrichtung des Gebäudes.
Das dritte Kapitel behandelt das Kaufhauspersonal und seine Aufgaben. Es beschreibt die Rolle des Hausmeisters, des Schreibers und der Unterkäufer sowie die Kontrolle des Kaufhauses durch das Stadtregiment.
Das vierte Kapitel rekonstruiert anhand von Zolllisten die verschiedenen Handelsabgaben und das Warenangebot im Kaufhaus. Es untersucht die Entwicklung des Warensortiments im 15. Jahrhundert.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit der Organisation des Handels im Kaufhaus. Es analysiert die Frage, ob es in Straßburg einen Kaufhaus- und/oder einen Feilbietungszwang gegeben hat und untersucht die Rolle des Kaufhauses und seines Personals bei der Erhebung der städtischen Handelsabgaben.
Das sechste Kapitel untersucht die Reglementierungen des Kaufhaushandels als Ausdruck der Handelspolitik des Straßburger Rates. Es analysiert, ob die Handelspolitik eher handelsförderlich oder eher handelshemmend war.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Straßburger Kaufhaus, den Handel im Spätmittelalter, die Handelspolitik des Straßburger Rates, die Organisation des Kaufhaushandels, die Reglementierung des Handels, die Bedeutung des Kaufhauses für die Straßburger Wirtschaft, die Baugestalt des Kaufhauses, das Kaufhauspersonal, die Handelsabgaben und das Warensortiment.
Häufig gestellte Fragen
Welche Bedeutung hatte das Kaufhaus im spätmittelalterlichen Straßburg?
Das 1358 errichtete Kaufhaus war ein zentraler Wirtschaftsknotenpunkt für den Fernhandel und diente der Stadt als Instrument zur Kontrolle des Warenverkehrs und zur Erhebung von Zöllen.
Was versteht man unter dem „Kaufhauszwang“?
Der Kaufhauszwang verpflichtete Fernhändler dazu, ihre Waren im städtischen Kaufhaus einzulagern, dort zum Verkauf anzubieten und die entsprechenden Abgaben zu entrichten.
Welche Aufgaben hatte das Kaufhauspersonal?
Zum Personal gehörten Hausmeister, Schreiber und Unterkäufer. Sie waren für die Verwaltung, die Buchführung über die Warenströme und die Aufsicht über den korrekten Handel verantwortlich.
Wie beeinflusste die Zollpolitik den Handel in Straßburg?
Die Zollpolitik des Straßburger Rates schwankte zwischen handelsfördernden Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Stadt und fiskalischen Interessen durch die Erhebung von Handelsabgaben.
Welche Rolle spielte das Kaufhaus während der Messezeit?
Während der Messen war das Kaufhaus der wichtigste Ort für den Austausch internationaler Waren und fungierte als organisatorisches Zentrum für Händler aus ganz Europa.
- Citation du texte
- Christoph Heckl (Auteur), 2014, "Umb daz sü deste me harkoment". Das städtische Kaufhaus im Wirtschaftsleben des spätmittelalterlichen Straßburg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/287902