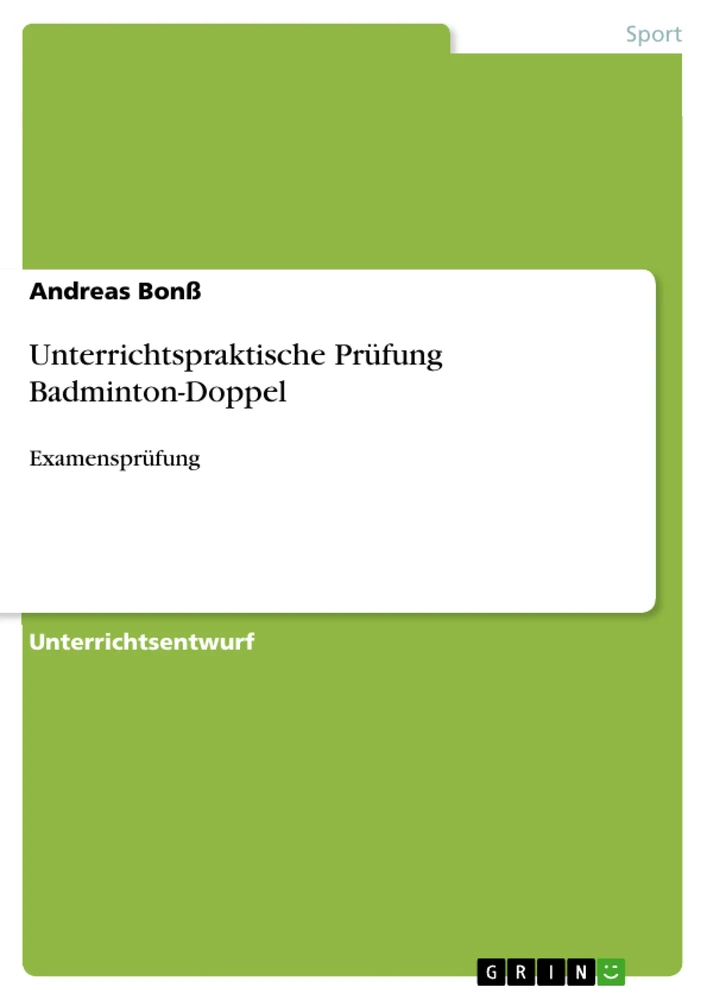Es handelt sich um die Examensprüfung im Fach Sport mit dem Thema Badminton Doppel.
Erweiterung des taktischen Spielverständnisses im Badminton-Doppel. „Drauflosspielen“ war einmal, jetzt spielen wir organisiert und durchdacht Doppel.
Inhaltsverzeichnis
- Einordnung der Stunde in das Unterrichtsvorhaben
- 1./2. Stunde
- 3. Stunde
- 4./5. Stunde
- 6. Stunde
- 7./8. Stunde
- 9. Stunde
- 10./11. Stunde
- Bemerkungen zur Lerngruppe
- Didaktisch-methodischer Kommentar
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Unterrichtskonzept zielt darauf ab, das taktische Verständnis der Schülerinnen und Schüler im Badminton-Doppel zu erweitern. Durch praktische Erprobung und Analyse verschiedener Positionierungen sollen sie sinnvolle Positionierungen in klassischen Spielsituationen entwickeln.
- Entwicklung taktischer Fähigkeiten im Badminton-Doppel
- Analyse von Vor- und Nachteilen verschiedener Positionierungen
- Entwicklung sinnvoller Positionierungen in klassischen Spielsituationen
- Förderung der Zusammenarbeit und Kommunikation im Doppelspiel
- Verbesserung der allgemeinen Spielfähigkeit im Badminton
Zusammenfassung der Kapitel
- Die erste Stunde des Unterrichtsvorhabens beginnt mit einem Leistungscheck, der die wichtigsten Inhalte aus früheren Unterrichtsvorhaben wiederholt. Es werden technische und taktische Grundfertigkeiten wiederholt und ein Königsturnier gespielt.
- Die zweite Stunde des Unterrichtsvorhabens konzentriert sich auf die Regeln des Doppelspiels. Insbesondere wird der kurze Aufschlag als Konsequenz aus den Regeln behandelt.
- Die dritte Stunde des Unterrichtsvorhabens bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, erste Erfahrungen im Doppelspiel zu sammeln. Dabei werden die Probleme, die im Doppelspiel auftreten, aufgezeigt.
- Die vierte und fünfte Stunde des Unterrichtsvorhabens konzentrieren sich auf die Ermittlung sinnvoller Positionierung im Badminton-Doppel. Verschiedene Positionierungen werden praktisch erprobt und analysiert.
- Die siebte und achte Stunde des Unterrichtsvorhabens beleuchten taktische Strategien des Angriffs- und Abwehrverhaltens im Badminton-Doppel. Dazu wird das „Kompassnadel-System“ vorgestellt und angewendet.
- Die neunte Stunde des Unterrichtsvorhabens befasst sich mit Schlagkombinationen im Badminton-Doppel. Es werden erfolgsversprechende Schlagkombinationen vorgestellt und geübt.
Schlüsselwörter
Badminton, Doppelspiel, Taktik, Positionierung, Spielverständnis, Angriff, Abwehr, Kooperation, Kommunikation, Spielfähigkeit, Regelstrukturen, Sportspiele, methodisch-strategisches Lernen, induktives Verfahren, deduktives Verfahren, Kompassnadelsystem
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Unterrichtseinheit zum Badminton-Doppel?
Ziel ist die Erweiterung des taktischen Spielverständnisses, um vom unkoordinierten „Drauflosspielen“ zu einem organisierten und durchdachten Doppelspiel zu gelangen.
Was versteht man unter dem „Kompassnadel-System“ im Badminton?
Es ist ein taktisches System zur Positionierung im Doppel, das den Spielern hilft, sich je nach Spielsituation (Angriff oder Abwehr) optimal auf dem Feld abzustimmen.
Warum wird der kurze Aufschlag im Doppel besonders betont?
Der kurze Aufschlag ist eine taktische Konsequenz aus den Doppelregeln, um dem Gegner keinen direkten Angriffsschlag (Smash) zu ermöglichen.
Welche taktischen Aspekte werden im Training behandelt?
Schwerpunkte sind die sinnvolle Positionierung bei Angriff und Abwehr, die Kommunikation zwischen den Partnern sowie effektive Schlagkombinationen.
Wie ist das Unterrichtsvorhaben strukturiert?
Es beginnt mit einem Leistungscheck, führt über die Regelkunde und Positionierungsexperimente hin zu komplexen taktischen Strategien und Schlagkombinationen.
- Quote paper
- Andreas Bonß (Author), 2012, Unterrichtspraktische Prüfung Badminton-Doppel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/288195