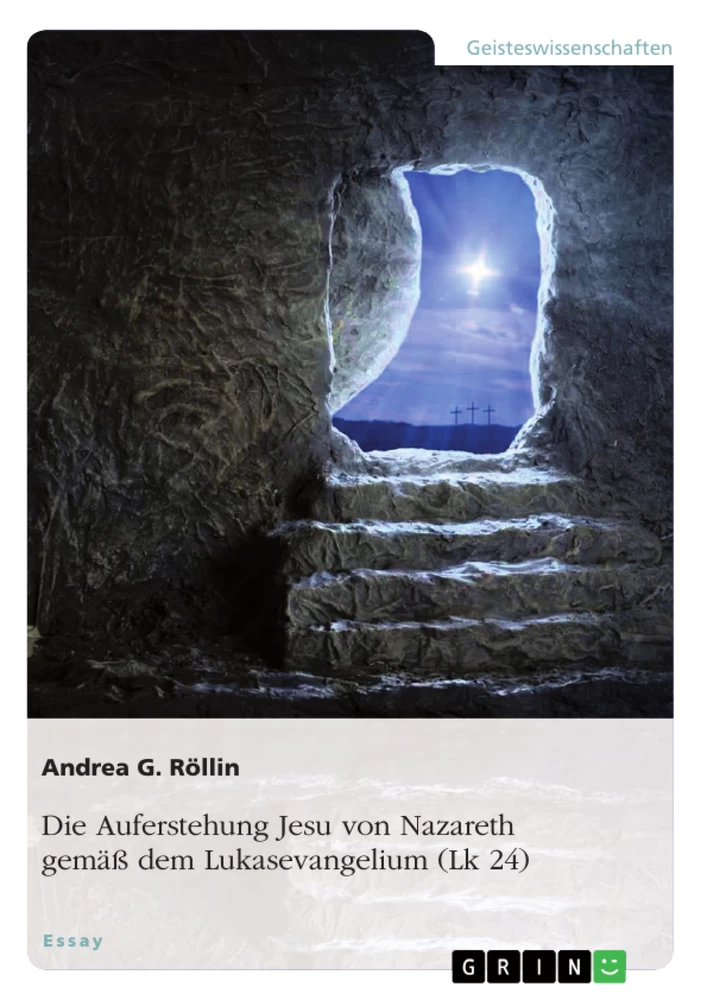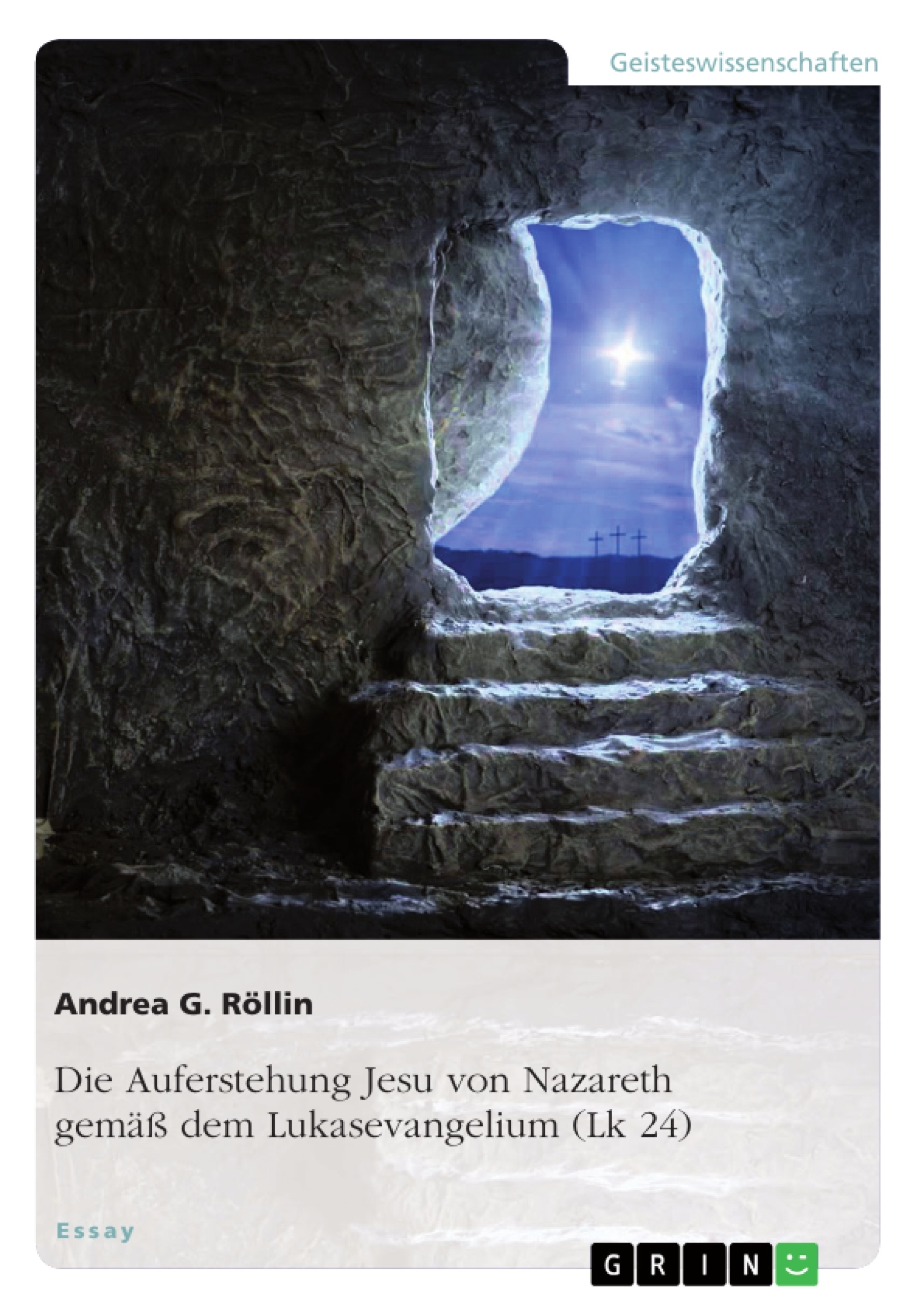Die Auferstehung des am Kreuz gestorbenen Jesus von Nazareth ist zentraler Inhalt des christlichen Glaubens. In diesem Essay wird den Fragen nachgegangen, wie der Evangelist Lukas die Auferstehung überliefert, ob es Personen- oder Sachbeweise für sie laut Lukas gibt und ob sein Bericht geschichtlich nachvollziehbar ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Das leere Grab
- 2 Die fehlenden Auferstehungszeugen am Grab Jesu
- 2.1 Die Grabbesucherinnen
- 2.2 Die Jünger
- 3 Das lukanische Zeugenverständnis
- 4 Der Schriftbeweis des Lukas
- 5 Ist Jesus von Nazareth wahrhaft auferstanden?
- 5.1 Die Überzeugung der Jünger und Jüngerinnen
- 5.2 Auferstehungsbeweis Auferstandener
- 6 Wie geschah die Auferstehung Jesu von Nazareth?
- 7 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht Lukas' Darstellung der Auferstehung Jesu im Lukasevangelium (Lk 24). Die Zielsetzung besteht darin, Lukas' Bericht auf seine geschichtliche Nachvollziehbarkeit und die von ihm dargestellten Personen- und Sachbeweise zu analysieren. Dabei wird insbesondere die Rolle des leeren Grabes, die Zeugenschaft der Jünger und Jüngerinnen sowie die Bedeutung der Heiligen Schrift im Kontext der Auferstehungsbotschaft beleuchtet.
- Lukas' Darstellung des leeren Grabes und dessen Bedeutung für die Auferstehungsbotschaft
- Die Rolle der Zeugen (Frauen und Jünger) in Lukas' Bericht und deren Glaubwürdigkeit
- Der Schriftbeweis und die Interpretation der Heiligen Schrift im Kontext der Auferstehung
- Die Art und Weise, wie Lukas die Auferstehung Jesu beschreibt und deren Glaubhaftigkeit
- Das lukanische Verständnis von Zeugenschaft im Kontext der Auferstehung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Das leere Grab: Lukas präsentiert das leere Grab nicht als Beweis für die Auferstehung, sondern als geschichtlichen Ankerpunkt. Die Reaktion der Frauen und Jünger auf die Nachricht vom leeren Grab unterstreicht dessen geringe Bedeutung für die Gewissheit der Auferstehung. Lukas betont, dass das Verschwinden des Leichnams verschiedene Ursachen haben könnte, wobei die Auferstehung nicht die nächstliegende Erklärung ist. Die Darstellung des leeren Grabes dient dem Evangelisten dazu, den historischen Kontext darzustellen, ohne es als zentralen Beweis zu verwenden.
2 Die fehlenden Auferstehungszeugen am Grab Jesu: Dieses Kapitel analysiert die Rolle der Frauen und Jünger als Zeugen. Lukas betont, dass die Frauen am Grab nicht dem auferstandenen Jesus begegneten und somit keine Augenzeugen sind. Ähnlich verhält es sich mit den Jüngern, deren anfängliche Ungläubigkeit die spätere Glaubwürdigkeit ihres Zeugnisses unterstreichen soll. Lukas demonstriert, dass die Auferstehung nicht durch Zeugenschaft am Grab selbst bezeugt wird.
3 Das lukanische Zeugenverständnis: Lukas definiert die Jünger erst als Zeugen der Auferstehung nach der Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, insbesondere nachdem dieser mit ihnen ass (Lk 24,48). Die unmittelbare Begegnung mit dem Auferstandenen verleiht ihnen die Autorität, als Zeugen aufzutreten. Die Verkündigung der Auferstehung durch diese autorisierten Zeugen beginnt erst nach dieser Begegnung.
4 Der Schriftbeweis des Lukas: Lukas argumentiert, dass die Auferstehung Jesu mit der Heiligen Schrift übereinstimmt. Die Erfüllung der messianischen Prophezeiungen durch die Auferstehung Jesu wird hervorgehoben. Der Evangelist verknüpft die Identität Jesu als Messias mit seiner Auferstehung und zeigt, wie die Schrift die Auferstehung als Gottes Plan bestätigt. Die Schrift dient als wichtiger Beweis für die Auferstehung.
5 Ist Jesus von Nazareth wahrhaft auferstanden?: Dieses Kapitel diskutiert die Überzeugung der Jünger von der Auferstehung. Die Begegnung der Emmaus-Jünger mit dem Auferstandenen, gefolgt von der Nachricht von Simons Erfahrung, bekräftigt ihren Glauben. Obwohl Simons Rolle als Primus fragwürdig ist, da seine Begegnung mit dem Auferstandenen nicht beschrieben wird, dient sie als Bestätigung für die Jünger. Die anschließende Erscheinung Jesu vor allen Aposteln und Jüngern festigt endgültig die Gewissheit der Auferstehung im Jüngerkreis. Die materielle Darstellung des Auferstandenen soll jeden Zweifel an der leiblichen Auferstehung ausräumen.
6 Wie geschah die Auferstehung Jesu von Nazareth?: Lukas beschreibt die Auferstehung als göttliches Handeln, als "Auferweckung". Sie übersteigt die natürlichen Dimensionen und ist somit unerzählbar. Lukas verwendet narrative Elemente, um das Geschehen zu deuten, ohne es direkt zu beschreiben. Der Glaube an die Auferstehung bildet die Grundlage für deren Verkündigung in der Gemeinde, wobei das Schriftverständnis durch das Ereignis der Auferstehung geprägt wird.
Schlüsselwörter
Lukas-Evangelium, Auferstehung Jesu, leere Grab, Zeugen, Jünger, Jüngerinnen, Schriftbeweis, Heilige Schrift, Messias, Auferweckung, Glaubhaftigkeit, historische Nachvollziehbarkeit, leibliche Auferstehung, urchristliches Glaubensbekenntnis, Passivum divinum.
Häufig gestellte Fragen zu "Lukas' Darstellung der Auferstehung Jesu"
Was ist das Thema des Essays?
Der Essay analysiert Lukas' Darstellung der Auferstehung Jesu im Lukasevangelium (Lk 24) hinsichtlich ihrer geschichtlichen Nachvollziehbarkeit und der dargestellten Personen- und Sachbeweise. Besondere Aufmerksamkeit wird dem leeren Grab, der Zeugenschaft der Jünger und Jüngerinnen sowie der Bedeutung der Heiligen Schrift gewidmet.
Welche Kapitel umfasst der Essay?
Der Essay gliedert sich in sieben Kapitel: 1. Das leere Grab; 2. Die fehlenden Auferstehungszeugen am Grab Jesu (inkl. Unterkapitel zu den Grabbesucherinnen und den Jüngern); 3. Das lukanische Zeugenverständnis; 4. Der Schriftbeweis des Lukas; 5. Ist Jesus von Nazareth wahrhaft auferstanden? (inkl. Unterkapitel zur Überzeugung der Jünger und Jüngerinnen und zum Auferstehungsbeweis Auferstandener); 6. Wie geschah die Auferstehung Jesu von Nazareth?; 7. Fazit.
Welche Rolle spielt das leere Grab in Lukas' Darstellung?
Lukas präsentiert das leere Grab nicht als direkten Beweis für die Auferstehung, sondern als historischen Ankerpunkt. Seine Bedeutung für die Gewissheit der Auferstehung wird von Lukas relativiert. Das Verschwinden des Leichnams könnte verschiedene Ursachen haben, die Auferstehung ist nicht die nächstliegende Erklärung für Lukas.
Wer sind die Zeugen der Auferstehung nach Lukas?
Lukas betont, dass die Frauen am Grab keine Augenzeugen der Auferstehung sind. Auch die Jünger werden erst nach ihrer Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, insbesondere nach dem gemeinsamen Mahl (Lk 24,48), als Zeugen definiert. Die unmittelbare Begegnung mit dem Auferstandenen verleiht ihnen die Autorität, als Zeugen aufzutreten.
Welche Bedeutung hat die Heilige Schrift in Lukas' Darstellung?
Lukas argumentiert, dass die Auferstehung Jesu mit der Heiligen Schrift übereinstimmt. Die Erfüllung messianischer Prophezeiungen durch die Auferstehung wird hervorgehoben. Die Schrift dient als wichtiger Beweis für die Auferstehung und verbindet Jesu Identität als Messias mit seiner Auferstehung.
Wie wird die Überzeugung der Jünger von der Auferstehung dargestellt?
Die Begegnung der Emmaus-Jünger und die Nachricht von Simons Erfahrung (obwohl dessen Begegnung nicht detailliert beschrieben ist) bestärken den Glauben der Jünger. Die spätere Erscheinung Jesu vor allen Aposteln und Jüngern festigt endgültig die Gewissheit der Auferstehung.
Wie beschreibt Lukas die Auferstehung selbst?
Lukas beschreibt die Auferstehung als göttliches Handeln, eine "Auferweckung", die die natürlichen Dimensionen übersteigt und somit unerzählbar ist. Er verwendet narrative Elemente, um das Geschehen zu deuten, ohne es direkt zu beschreiben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Essay?
Schlüsselwörter sind: Lukas-Evangelium, Auferstehung Jesu, leere Grab, Zeugen, Jünger, Jüngerinnen, Schriftbeweis, Heilige Schrift, Messias, Auferweckung, Glaubhaftigkeit, historische Nachvollziehbarkeit, leibliche Auferstehung, urchristliches Glaubensbekenntnis, Passivum divinum.
- Arbeit zitieren
- Dr.iur. Andrea G. Röllin (Autor:in), 2014, Die Auferstehung Jesu von Nazareth gemäß dem Lukasevangelium (Lk 24), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/288218