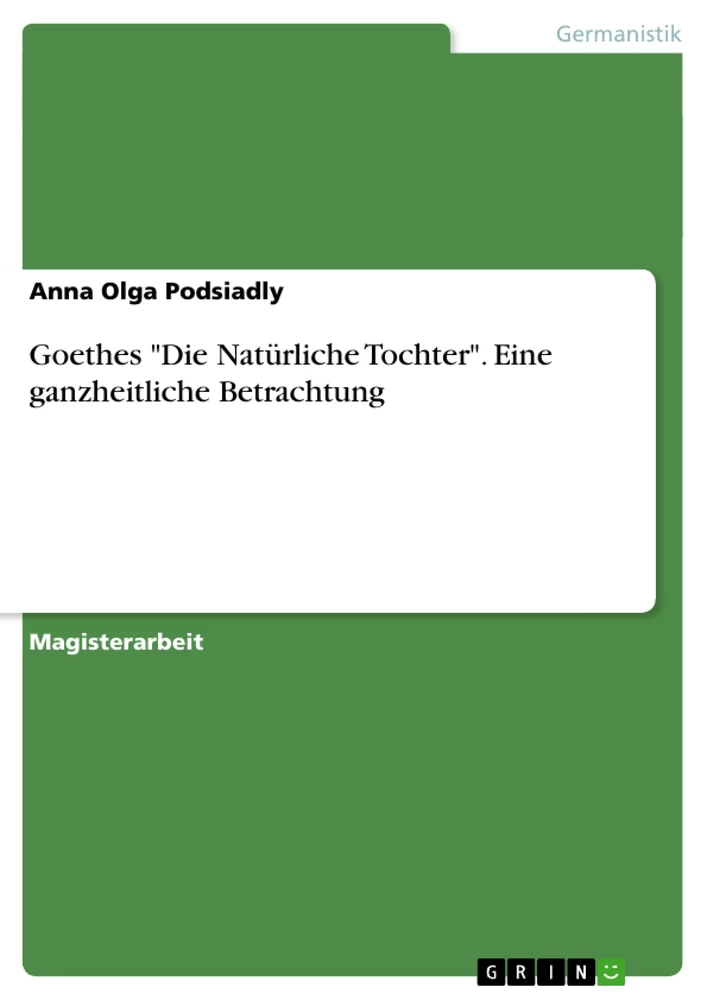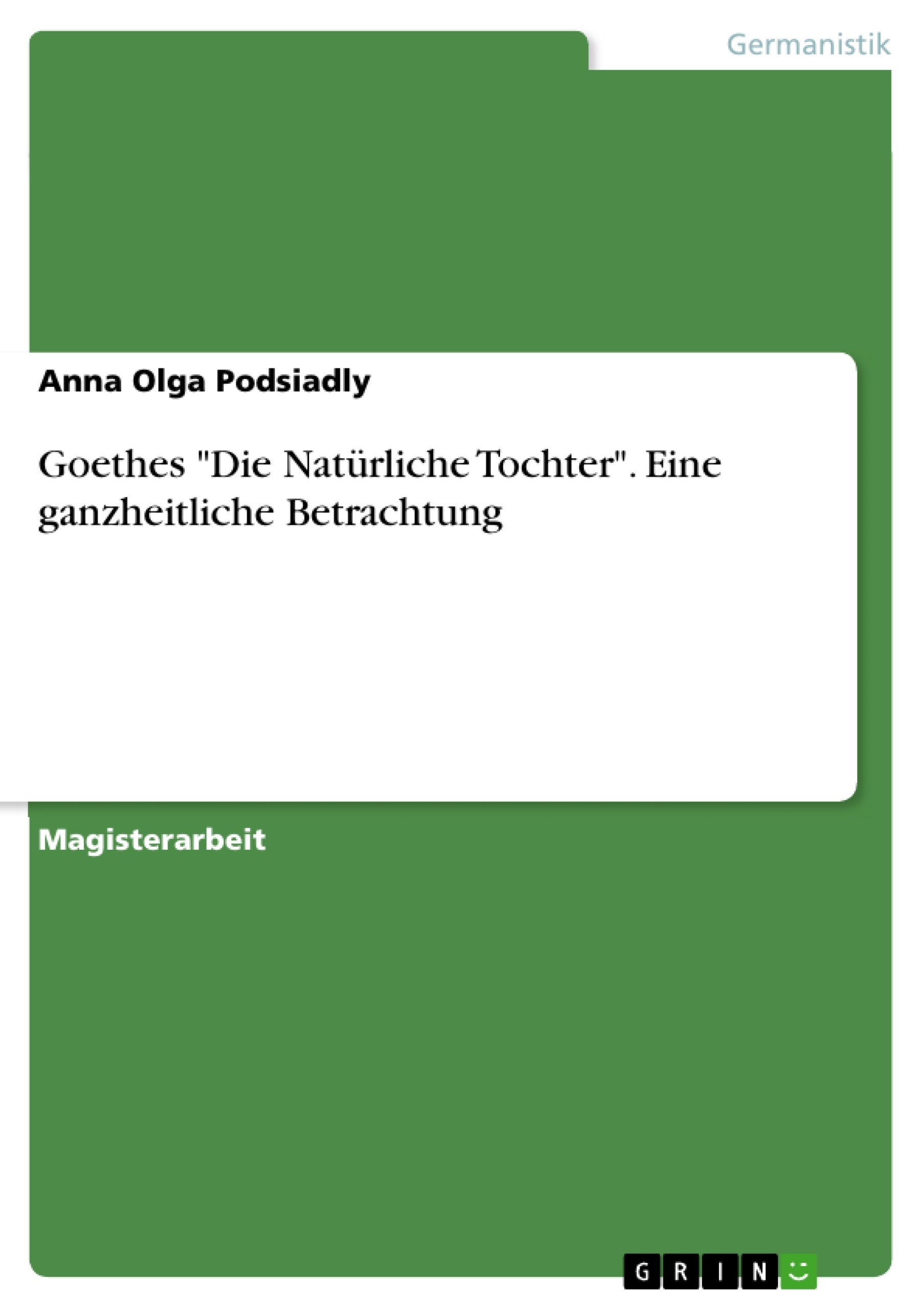„Bewundert viel und viel gescholten“ – dieser Vers, der akteinleitend im Faust II zu lesen ist, kann mühelos auf Goethes Drama "Die natürliche Tochter" übertragen werden. Denn sowohl Ablehnung und vernichtenden Kritik als auch Bewunderung und kritische Würdigung waren und sind die Antworten auf dieses Werk, damals und heute. Die Meinungen und Deutungen polarisieren in einer fast schon absurden Weise, die Natürliche Tochter gilt gleichzeitig als der Höhepunkt in Goethes dramatischem Schaffen – und damit ist keineswegs lediglich der höchste Punkt, der Endpunkt gemeint – aber auch als das Schmerzenskind unter seinen theatralischen Hervorbringungen. Bei der Betrachtung des Dramas muss man sich zunächst zwei wichtige Aspekte vor Augen führen. Zum einen ist der historische Kontext für die Deutung des Stücks signifikant, zum anderen sollte beachtet werden, dass dieses Werk zunächst von Goethe als ein Teil einer Trilogie angedacht und auch so entworfen wurde – es kam jedoch nicht zu einer Fertigstellung, es existiert nur der eine Teil. Zu der geplanten Fortsetzung sind lediglich Entwürfe und unvollständige Aufzeichnungen von Goethe erhalten geblieben. Die unterschiedlichen und zum Teil auch widersprüchlichen Meinungen und Aussagen über dieses Drama – sowohl in der damaligen als auch in der heutigen Zeit – waren und sind durch diese zwei Aspekte bestimmt. Doch gerade diese Gesichtspunkte regen dazu an, das Drama zu lesen und zu deuten. Eine von Goethe selbst nur indirekt auf das Drama bezogene Aussage, in seinem Drama die Französische Revolution in ihren „Ursachen und Folgen dichterisch […] gewältigen“ zu wollen, drängte die Forschungsansätze zur Deutung der Natürlichen Tochter in eine Ecke, von der aus sie das Werk zu beurteilen suchten. Tatsächlich kann man das Drama nicht völlig aus diesem Kontext herausgelöst betrachtet, dieser sollte den Versuch einer Deutung jedoch auch nicht vollends bestimmen.
Der Titel des Dramas lautet "Die Natürliche Tochter", ich werde in der vorliegenden Arbeit jedoch einige Male den verkürzten Titel Natürliche Tochter (o.ä.) verwenden, um eine flüssige Lesbarkeit zu gewähren.
Auch die vorliegende Arbeit unternimmt nicht den Versuch, das Drama aus dem historischen Zusammenhang zu lösen. Es soll jedoch untersucht werden, auf welche Art und Weise Goethes Intention von ihm umgesetzt wurde und welche Schlussfolgerungen daraus gezogen werden können. Welches Ziel verfolgte Goethe mit diesem Drama? [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung Forsche(-nde) Ansichten
- Eine natürliche Tochter - Das Gefäß
- Die Figuren - künstliche Erscheinungen?
- Die Wohlgeborene - Eugenie
- Der Zerrissene – König
- Der Bemühte - Herzog
- Die Schwankende - Hofmeisterin
- Der Bürgerliche - Gerichtsrat
- Betrügerische Gruppierungen - Sekretär und Weltgeistlicher
- Der Deutende - Mönch
- Versagen, Zusagen, Entsagen
- Sprache und Raum
- Das blanke Wort
- Der örtliche Raum
- Französische Revolution - Dichtung und Wahrheit?
- Absichten, Ansichten, Einsichten
- Eine einteilige Trilogie - Ursachen und Folgen
- Blinde Motivation?
- Das tragische, dramatische, klassische, fabelhafte Trauerspiel
- Eine griechische Tochter?
- Theatralische Betrachtungen
- Die dramatische Quintessenz
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Goethes Drama „Die natürliche Tochter“ und untersucht dessen Entstehung, Figuren, Sprache, Raum und historische Einordnung. Ziel ist es, die Intentionen Goethes bei der Gestaltung des Dramas zu ergründen und die Bedeutung des Werkes im Kontext der Französischen Revolution zu beleuchten.
- Die Entstehung des Dramas und die Rolle der Autobiographie von Stéphanie-Louise de Bourbon-Conti
- Die Figurencharakterisierung und die Bedeutung der fehlenden Eigennamen
- Die Rolle von Sprache und Raum in der Gestaltung des Dramas
- Die Einordnung des Dramas in den historischen Kontext der Französischen Revolution
- Die Gattung des Stücks und seine Umsetzbarkeit für das Theater
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die unterschiedlichen Interpretationen des Dramas und führt in die Thematik ein. Das zweite Kapitel widmet sich der Entstehungsgeschichte des Dramas und der Rolle der Autobiographie von Stéphanie-Louise de Bourbon-Conti als Inspirationsquelle. Das dritte Kapitel analysiert die Figurencharakterisierung und die Bedeutung der fehlenden Eigennamen, wobei ein besonderer Fokus auf die Protagonistin Eugenie gelegt wird. Das vierte Kapitel untersucht die Rolle von Sprache und Raum in der Gestaltung des Dramas. Das fünfte Kapitel beleuchtet die Einordnung des Dramas in den historischen Kontext der Französischen Revolution. Das sechste Kapitel befasst sich mit der Gattung des Stücks und seiner Umsetzbarkeit für das Theater.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Goethes Drama „Die natürliche Tochter“, Stéphanie-Louise de Bourbon-Conti, Französische Revolution, Figurencharakterisierung, Sprache, Raum, historische Einordnung, Gattung des Stücks, Theatralität.
- Quote paper
- Anna Olga Podsiadly (Author), 2010, Goethes "Die Natürliche Tochter". Eine ganzheitliche Betrachtung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/288297