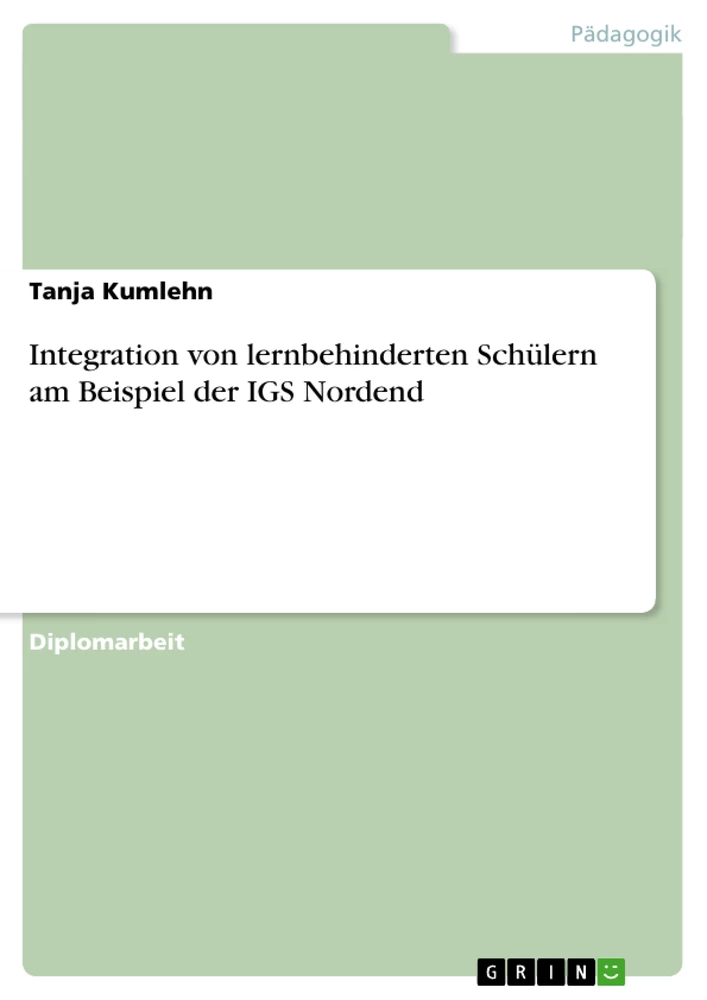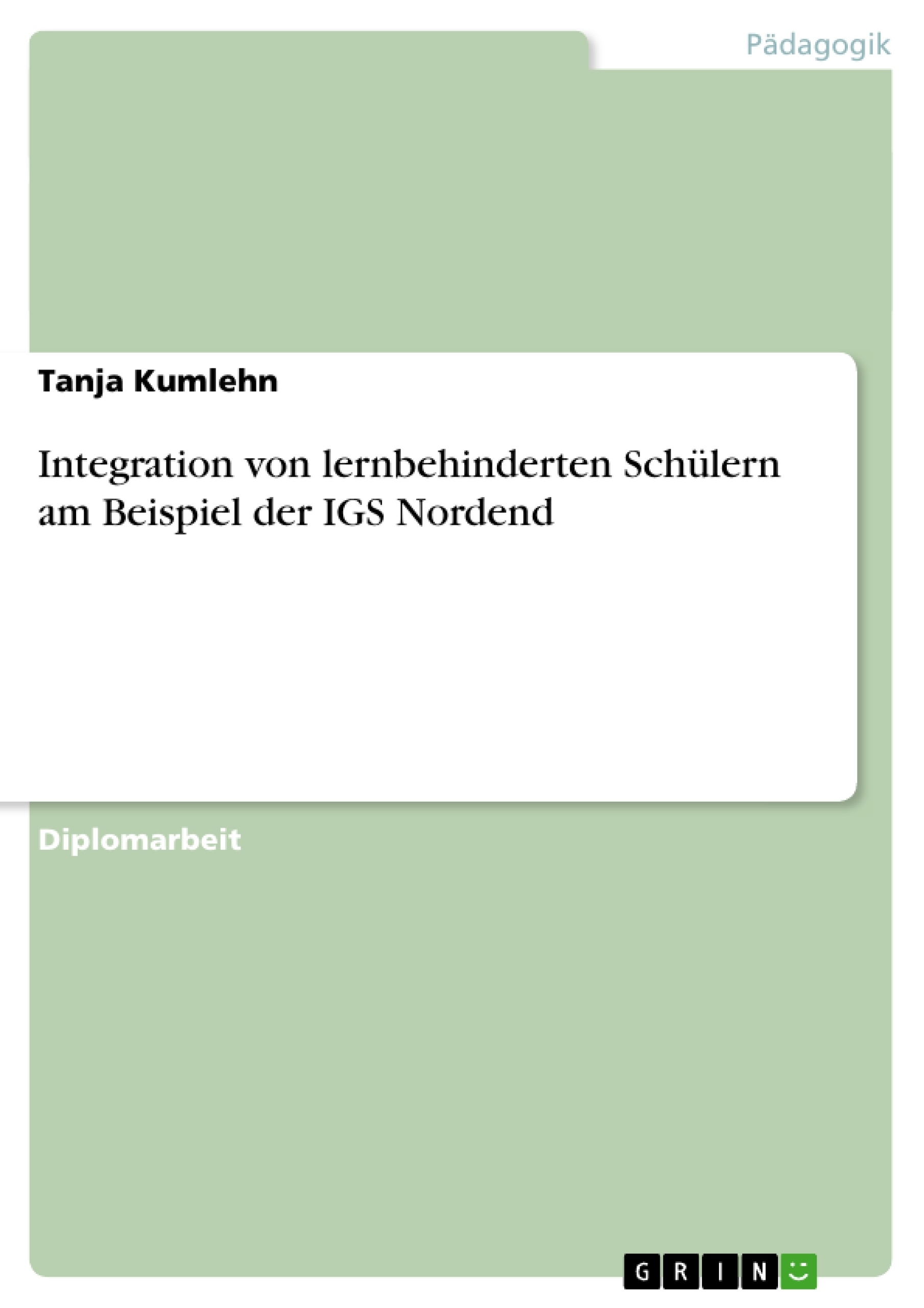[...] Es gilt herauszufiltern, welche Aspekte des gemeinsamen
Unterrichts an dieser Schule - verglichen mit dem Konzept - in der Realität erfolgreich
umgesetzt werden können, und an welchen Stellen die Entwicklung storniert oder hakt, wobei
sich im letzten Fall die Frage nach dem Grund des Problems anschließt. Erst auf einer solchen
Grundlage ist es möglich, Defizite auszugleichen und Veränderungen bzw. Verbesserungen
anzusteuern.
Die Ergebnisse der Untersuchung werden außerdem den Argumenten der Integrationskritiker
gegenübergestellt und einem kurzen Vergleich mit den Ergebnissen früherer Untersuchungen
zum gemeinsamen Unterricht unterzogen.
Nach anfänglichen Überlegungen und gründlicher Abwägung der möglichen Methoden
entschloß ich mich, für diese Untersuchung lediglich eine einzige integrative Klasse
heranzuziehen, an der das Vorgehen beispielhaft verdeutlicht werden soll. Unter Berücksichtigung
der relativ kurzen Zeitspanne, die mir für die Ausführung dieser Arbeit zur
Verfügung steht, scheint eine breitere Vergleichsstudie, welche die Befragung und Beobachtung aller betroffenen Klassen dieser Schule vorsieht, zu umfangreich. Die
Überlegungen zu einer geeigneten Methode führten mich zum Resultat, eine sehr „offene“,
flexible Form der Unterrichtsbeobachtung durchzuführen, die an einigen Stellen durch
Interviews, Gesprächsmitschnitte und einer schriftlichen Schülerbefragung ergänzt wird.
Hierbei stehen die beiden - zunächst grob beschriebenen - Aspekte „Leistung“ und „Sozialer
Umgang“ der Schüler im Mittelpunkt.
Um dem Anliegen der IGS Nordend nach Evaluation und Bilanz hinsichtlich der Entwicklung
des Integrationsgedankens und des gemeinsamen Unterrichts generell an dieser Schule
zumindest ansatzweise gerecht zu werden, werde ich außerdem eine schriftliche Umfrage an
Eltern hinsichtlich des gemeinsamen Unterrichts aus dem Jahr 1999 wiederholen und
dokumentieren, um diesbezüglich deren Meinungen und ihre Zufriedenheit aufspüren zu
können.
In dieser Arbeit werde ich beispielhaft die Situation in einer Klasse - den Integrationsaspekt
betreffend - darstellen und die Umsetzung des Integrationsgedankens kritisch hinterfragen;
nicht zuletzt mit dem Hintergedanken, den betreffenden Lehrern den Blick auf die eigene
Arbeit aus einer anderen Perspektive zu ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- Teil I.
- 2. Behinderung
- 2.1 Definitionen der Behinderung
- 2.1.1 Der Begriff der Lernbehinderung
- 2.2 Wechselwirkungen
- 2.3 Relativität von Behinderung.
- 3. Integration
- 3.1 Zum Integrationsbegriff..
- 3.2 Geschichte der Integration....
- 3.2.1 Rechte von behinderten Menschen.
- 3.2.2 Rechtlicher Hintergrund des Schulbesuchs
- 3.2.3 Erste integrative Einrichtungen
- 3.2.4 Integrative Einrichtungen in Hessen….
- 4. Argumente der Kritiker.
- 4.1 Kritik an der herkömmlichen Schule..
- 4.2 Kritik am Sonderschulwesen.
- 5. Gemeinsamer Unterricht
- 5.1 Veränderte Lernvoraussetzungen
- 5.1.1 Veränderte Gesellschaft.
- 5.1.2 Heterogenität in der Regelklasse
- 5.1.3 Veränderte Anforderungen
- 5.2 Idee des gemeinsamen Unterrichts.
- 5.2.1 Soziales Lernen...
- 5.2.2 Vielfalt und Chancengleichheit
- 5.2.3 Schülerorientierung und selbständiges Lernen.
- 5.2.4 Lernsituationen und Unterrichtsmethoden...
- 5.2.5 Differenzierungen
- 5.2.6 Die Rolle des Lehrenden.....
- 5.2.7 Aktives Lernen...
- 5.2.8 Zivilcourage und Meinungsbildung.
- 5.2.9 Entwicklung als Prozeß
- 5.2.10 IGS und Integration
- 5.3 Gegenargumente …....
- 5.3.1 Kostenaufwand
- 5.3.2 Entwicklungsstörungen.
- 5.3.3 Leistungsmotivation..
- 5.3.4 Vereinzelung.
- 5.3.5 Übergang in die Sekundarstufe.
- 5.4 Bisherige Untersuchungsergebnisse
- 5.4.1 Kostenaufwand.
- 5.4.2 Erfahrungen zum gemeinsamen Unterricht.
- 5.4.3 Selbsteinschätzung der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf....
- 5.4.4 Leistung.
- 5.4.5 Sozial- und Freizeitverhalten ..
- 5.4.6 Unterrichtsdurchführung in der Sekundarstufe.
- Teil II
- 5.4.7 Elterneinstellungen
- 5.4.8 Probleme beim gemeinsamen Unterricht..\li>
- 6. IGS Nordend
- 6.1 Die neue IGS-Generation
- 6.2 Entstehungsgeschichte der IGS Nordend
- 6.3 Gemeinsamer Unterricht
- 6.4 Konzept..\li>
- 6.4.1 Jahrgangsteams.
- 6.4.2 Fachliche Differenzierung
- 6.4.3 Differenzierung der SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
- 6.4.4 Selbständiges Lernen
- 6.4.4.1 Wochenplan und Planarbeit
- 6.4.4.2 Vorhaben.
- 6.4.5 Rituale.
- 6.4.6 Angebote..\li>
- 6.4.7 Berufsorientierung und Schullaufbahnberatung
- 7. Unterrichtsanalyse.
- 7.1 Fragestellung
- 7.2 Untersuchungsmethoden
- 8. Untersuchungsergebnisse.
- 8.1 Zusammensetzung der Schüler..\li>
- 8.2 Lehrer in der Klasse…...
- 8.3 Unterrichtsorganisation
- 8.3.1 Didaktik
- 8.3.2 Unterrichtsformen..\li>
- 8.3.3 Fachpläne ..
- 8.3.4 Selbständigkeit..\li>
- 8.3.5 Arbeits- und Sozialformen…..\li>
- 8.3.6 Rituale und Regeln..\li>
- 8.3.6.1 Montagskreis und Klassenrat.
- 8.3.7 Unterrichtsmittel.
- 8.3.8 Fachliche Differenzierung in der Klasse
- 8.3.9 Differenzierung der SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
- 8.4 Soziale Aspekte
- 8.4.1 Umgang / Sozialverhalten...
- 8.4.2 Respekt...
- 8.4.3 Offenheit und Konfliktfähigkeit
- 8.4.4 Stimmung...
- 8.4.5 Zufriedenheit der SchülerInnen
- 8.5 Behinderungen und Beeinträchtigungen
- 8.5.1 Beschreibung der SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf ...
- 8.5.2 Betreuungsintensität..\li>
- 8.5.3 Wahrnehmung von Anderssein...\li>
- 8.5.4 Umgang mit abweichenden Verhaltensweisen.
- 8.5.5 Soziale Akzeptanz der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf..
- 8.5.6 Soziale Distanz und Freizeitbeziehungen..\li>
- 8.5.7 Entwicklung der SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf.....
- 8.6 Der Leistungsaspekt.
- 8.6.1 Selbsteinschätzung und Leistungsmotivation.
- 8.6.2 Soziales und Lehrinhalte......
- 8.6.3 Entwicklungsstörungen der nichtbehinderten SchülerInnen
- 8.7 Elterneinstellungen ...
- Definitionen und Relativität von Behinderung
- Geschichte der Integration und rechtliche Grundlagen
- Argumente für und gegen den gemeinsamen Unterricht
- Konzepte und Erfahrungen des gemeinsamen Unterrichts an der IGS Nordend
- Analyse der sozialen und leistungsmässigen Auswirkungen des gemeinsamen Unterrichts
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Integration von lernbehinderten Schülern am Beispiel der Integrierten Gesamtschule (IGS) Nordend in Frankfurt am Main. Die Arbeit will untersuchen, wie die Praxis des gemeinsamen Unterrichts an dieser Schule aussieht und wie sie sich zum Integrationskonzept der IGS Nordend verhält.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext der Integration von Schülern mit Behinderung in Frankfurt am Main und die Zielsetzung der Arbeit darstellt. Teil I behandelt die Konzepte von Behinderung und Integration. Kapitel 2 erläutert verschiedene Definitionen von Behinderung und die Relativität des Begriffs. Kapitel 3 beleuchtet die Geschichte der Integration in Deutschland, die rechtlichen Grundlagen und die Entwicklung von integrativen Einrichtungen. Kapitel 4 geht auf die Kritik an der herkömmlichen Schule und am Sonderschulwesen ein. Kapitel 5 beschäftigt sich mit dem gemeinsamen Unterricht und beleuchtet seine Idee, die Vorteile, die Herausforderungen und die Ergebnisse von bisherigen Untersuchungen.
Teil II der Arbeit konzentriert sich auf die IGS Nordend als Fallbeispiel. Kapitel 6 beschreibt die Entstehungsgeschichte der Schule, das Integrationskonzept und die konkrete Umsetzung des gemeinsamen Unterrichts. Kapitel 7 erläutert die Forschungsmethodik der Arbeit. Kapitel 8 präsentiert die Ergebnisse der Unterrichtsanalyse, die sich mit der Zusammensetzung der Schüler, der Unterrichtsorganisation, den sozialen Aspekten, den Behinderungen und Beeinträchtigungen, dem Leistungsaspekt und den Elterneinstellungen auseinandersetzt.
Schlüsselwörter
Integration, Gemeinsamer Unterricht, Lernbehinderung, Integrierte Gesamtschule (IGS), Nordend, Frankfurt am Main, Unterrichtsanalyse, Soziale Aspekte, Leistungsaspekt, Elterneinstellungen, Sonderpädagogischer Förderbedarf.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Integration an der IGS Nordend?
Integration bedeutet hier der gemeinsame Unterricht von Schülern mit und ohne Behinderung, wobei Vielfalt als Chance für soziales Lernen verstanden wird.
Wie wird im gemeinsamen Unterricht differenziert?
Es gibt fachliche Differenzierungen sowie spezielle Fördermaßnahmen für Schüler mit sonderpädagogischem Bedarf, oft unterstützt durch Wochenplanarbeit.
Welche Argumente führen Integrationskritiker an?
Häufige Kritikpunkte sind der hohe Kostenaufwand, mögliche Leistungsrückgänge bei nichtbehinderten Schülern und die Gefahr der Vereinzelung behinderter Kinder.
Welche sozialen Vorteile bietet die Integration?
Sie fördert Respekt, Offenheit, Konfliktfähigkeit und Zivilcourage bei allen Schülern durch den täglichen Umgang mit Heterogenität.
Was ist die Rolle der Jahrgangsteams?
Lehrer arbeiten in Teams eng zusammen, um den Unterricht gemeinsam zu planen und individuell auf die Bedürfnisse der integrativen Klassen einzugehen.
- Citation du texte
- Tanja Kumlehn (Auteur), 2001, Integration von lernbehinderten Schülern am Beispiel der IGS Nordend, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28830