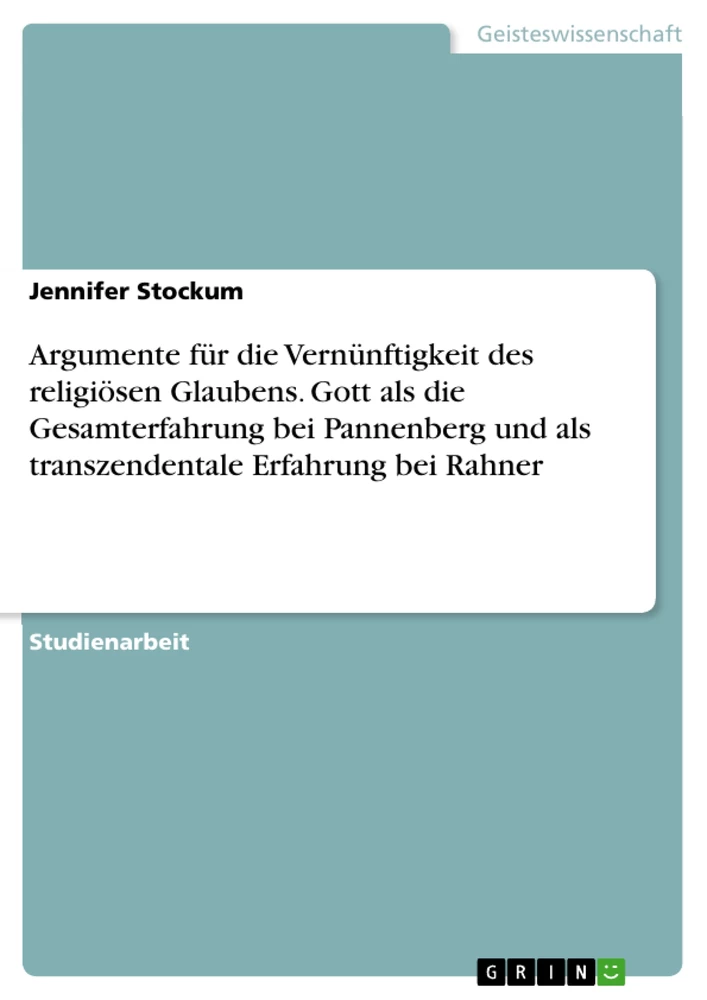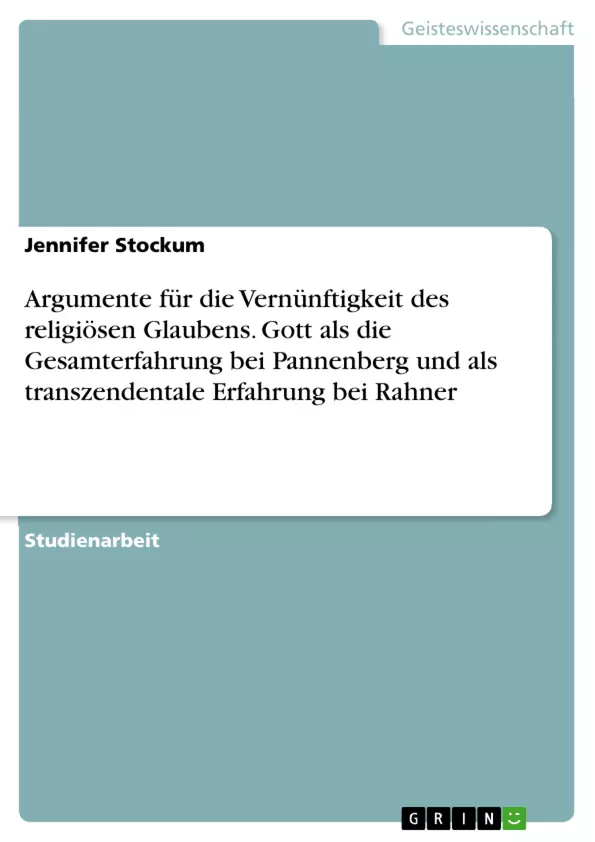„Der Christ von morgen wird ein Mystiker sein oder er wird nicht mehr sein.“ Diese Worte Karl Rahners verdeutlichen, wie wichtig Gotteserfahrungen in unserer heutigen Zeit sind, einer Zeit, in der Traditionen ihre Selbstverständlichkeit verloren haben und somit persönliche religiöse Erfahrungen besonders wichtig sind, den Glauben zu erhalten. Glauben kann nur noch derjenige, der die Gegenwart Gottes spürt, der sich von ihm berührt fühlt, dem er sich offenbart hat. Die Gotteserfahrung wird damit zur Prämisse des Glaubens überhaupt. Gott ist empirisch nicht nachweisbar, umso wichtiger sind demnach andere Wahrnehmungsmöglichkeiten, um ihm zu begegnen, ihn zu erfahren. Zudem müssen sich Gläubige heute oftmals für ihren Glauben rechtfertigen. Es wird ihnen vorgeworfen, dass ihr Glaube gegen die Vernunft sei angesichts des hohen Stellenwerts der Naturwissenschaften. Es stellt sich also die Frage, welche Argumente dagegen gehalten werden können, die die Vernünftigkeit des religiösen Glaubens zumindest nahe legen könnten. Dabei lässt sich zwischen Argumenten unterscheiden, die sich auf die theoretische z. B. der Bezug auf Tradition und Autorität oder auf die praktische Vernunft z. B. der Verweis auf die Nützlichkeit der Religion beziehen. Zu den Begründungen der theoretischen Vernunft gehören auch erkenntnistheoretische Argumente aus der Erfahrung, mit denen sich Wolfhart Pannenberg und Karl Rahner in ihren Arbeiten beschäftigt haben.
Um zum Glauben zu gelangen oder um ihn zu stärken sind Erfahrungen ein wichtiges Mittel. Immer wieder berichten Menschen von intensiven Erlebnissen, die sie mit Gott in Verbindung bringen und religiös deuten. Im Christentum werden solche Menschen als Mystiker bezeichnet. Allerdings wird nicht allen Menschen ein solches außergewöhnliches Erlebnis zu teil. Jedoch können auch alltägliche und banale Erfahrungen religiös interpretiert werden. Auch die Gesamtheit der Erfahrungen können auf diese Weise mit Gott in Verbindung gebracht werden. Hier setzt Wolfhart Pannenberg mit seiner Theorie an, die im ersten Teil der Arbeit erläutert wird. In Anlehnung an Bultmann definiert er Gott als die „alles bestimmende Wirklichkeit“, die sich dem Menschen im Verlauf der Geschichte offenbart. Eine Sonderform stellt die transzendentale Erfahrung Karl Rahners da, die Gegenstand des zweiten Teils ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Wolfhart Pannenberg: Gott als die „alles bestimmende Wirklichkeit“
- 1.1 Die alles bestimmende Wirklichkeit
- 1.2 Gottes Offenbarung in der Geschichte
- 1.3 Offenbarung in Jesus Christus
- 2. Karl Rahner: „Der Vorgriff auf das Sein“ und die „transzendentale Erfahrung“
- 2.1 Menschliche Erfahrung als Ausgangspunkt der Gotteserfahrung
- 2.2 Die „transzendentale Erfahrung“ und der „Vorgriff auf das Sein“
- Schluss
- Literatur
- Internetquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Argumente für die Vernünftigkeit des religiösen Glaubens, indem sie die Theorien von Wolfhart Pannenberg und Karl Rahner analysiert. Beide Theologen argumentieren, dass Gotteserfahrungen eine zentrale Rolle für den Glauben spielen. Pannenberg definiert Gott als die „alles bestimmende Wirklichkeit“, die sich in der Geschichte offenbart, während Rahner die „transzendentale Erfahrung“ als Grundlage für die Gotteserfahrung betrachtet.
- Die Bedeutung von Gotteserfahrungen für den Glauben
- Die Rolle der Vernunft und Erfahrung in der Theologie
- Die Definition von Gott als „alles bestimmende Wirklichkeit“ bei Pannenberg
- Die „transzendentale Erfahrung“ und der „Vorgriff auf das Sein“ bei Rahner
- Die Verbindung von Glaube und Erfahrung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Gotteserfahrung und die Bedeutung für den Glauben ein. Sie stellt die Frage nach der Vernünftigkeit des religiösen Glaubens und erläutert die Bedeutung von Erfahrungen für den Glauben. Die Einleitung stellt die beiden Theologen Pannenberg und Rahner vor, deren Theorien im weiteren Verlauf der Arbeit analysiert werden.
Das erste Kapitel befasst sich mit Wolfhart Pannenberg und seiner Theorie von Gott als der „alles bestimmenden Wirklichkeit“. Pannenberg argumentiert, dass die Gesamtheit der erfahrbaren Welt auf eine letzte Instanz, Gott, verweist, die für die Sinntotalität der Wirklichkeit verantwortlich ist. Die Offenbarung Gottes geschieht für Pannenberg in der Geschichte, die der Mensch mit Hilfe seiner Vernunft erfassen kann.
Das zweite Kapitel behandelt die „transzendentale Erfahrung“ von Karl Rahner. Rahner betont die Bedeutung von Gotteserfahrungen für den Glauben und argumentiert, dass Glaubensaussagen erst in Verbindung mit Erfahrung „wirklich verstehbar“ werden. Die „transzendentale Erfahrung“ ist für Rahner ein „Vorgriff auf das Sein“, der dem Menschen die Möglichkeit eröffnet, Gott zu erfahren.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Gotteserfahrung, die Vernünftigkeit des religiösen Glaubens, die „alles bestimmende Wirklichkeit“ bei Pannenberg, die „transzendentale Erfahrung“ bei Rahner, die Rolle der Vernunft und Erfahrung in der Theologie sowie die Verbindung von Glaube und Erfahrung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Wolfhart Pannenbergs Begriff der „alles bestimmenden Wirklichkeit“?
Pannenberg definiert Gott als die Macht, die die gesamte Wirklichkeit bestimmt und sich dem Menschen durch den Verlauf der Geschichte offenbart.
Was ist die „transzendentale Erfahrung“ nach Karl Rahner?
Rahner sieht darin einen „Vorgriff auf das Sein“, eine grundlegende menschliche Erfahrung, die Gott als das Ziel menschlichen Erkennens und Wollens spürbar macht.
Ist religiöser Glaube heute noch vernünftig?
Die Arbeit zeigt auf, dass Glaube nicht gegen die Vernunft stehen muss, sondern durch erkenntnistheoretische Argumente aus der Erfahrung begründet werden kann.
Welche Rolle spielt die Geschichte in Pannenbergs Theologie?
Für Pannenberg ist die Geschichte der Ort der Offenbarung Gottes; die Vernunft hilft dem Menschen, diese Zeichen in der Welt zu deuten.
Was meinte Rahner mit „Der Christ von morgen wird ein Mystiker sein“?
Er betonte, dass in einer Zeit schwindender Traditionen der Glaube nur durch eine persönliche, tiefe Gotteserfahrung lebendig bleiben kann.
- Citar trabajo
- Jennifer Stockum (Autor), 2014, Argumente für die Vernünftigkeit des religiösen Glaubens. Gott als die Gesamterfahrung bei Pannenberg und als transzendentale Erfahrung bei Rahner, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/288336